|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht "Synagogen im Lahn-Dill-Kreis"
Aßlar mit
(Wetzlar-)Hermannstein (Lahn-Dill-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Aßlar bestand eine jüdische
Gemeinde bis nach 1933. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18.
Jahrhunderts zurück. Erstmals werden um 1650 Juden am Ort
genannt. Im benachbarten Hermannstein
bestand bis um 1884 gleichfalls eine Gemeinde, die dann jedoch mit Aßlar
zusammengelegt wurde.
1825 wird als Gemeindevorsteher Jessel Herz genannt, der in diesem Jahr
im Alter von 65 Jahren starb.
1853 wurde Aßlar zum Sitz eines der acht Synagogenbezirke im
Kreis Wetzlar bestimmt. Zur jüdischen Gemeinde in Aßlar gehörten auch die in
Biskirchen, Edingen, Werdorf,
Kölschhausen, Ehringshausen und
Katzenfurt lebenden jüdischen Personen. Alle
Gemeinden in den acht Synagogenbezirken waren der Synagogengemeinde in
Wetzlar
zugeteilt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt (zusammen mit Hermannstein): 1812 46, 1816 55 (10-11 Familien),
1823-24 53 jüdische Einwohner, 1835 55 (5,9 % von insgesamt 929), 1843 48, 1846
54, 1851
60, 1875 7 Familien mit 2 Kindern, 1910 31 (3,1
% von insgesamt 2.422). Als Familiennamen treten in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts aus: auf: Feitel (Feidel), Herz Isac (Isaak), Süßmann, Meier,
Rosenthal, Kahn, Wolf u.a. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte die Annahme
fester neuer Familiennamen. Jacob Isaak nannte sich nun Jakob Lindenbaum, Nathan
Feidel nun Nathan Mildenberg, Abraham Katz nun Abraham Kahn.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Bis 1885 wurden die Toten der jüdischen Gemeinde Aßlar in
Werdorf beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war im 19. Jahrhundert
vermutlich zeitweise ein Religionslehrer angestellt, der
zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Nachweise wurden jedoch noch nicht gefunden. Die jüdische Gemeinde gehörte zum Rabbinat in
Marburg.
Um 1924, als noch 19 jüdische Einwohner gezählt wurden (0,7 % von
insgesamt 2.886 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Julius Kahn und
Emanuel Lindenbaum. Auch 1932 bildeten die beiden den Vorstand, wobei
Julius Kahn als 1. Vorsitzender und Emanuel Lindenbaum als Schatzmeister
eingetragen ist. Die Gemeinde Aßlar war bereits 1924 nicht mehr selbständig,
sondern eine Filialgemeinde zur Gemeinde in Wetzlar. Julius Kahn hatte aus
diesen Grund einen Sitz in der Repräsentanz der Gemeinde Wetzlar inne.
1933/36 lebten noch drei jüdische Familien in Aßlar. In
Hermannstein lebten noch zwei Familien mit etwa zehn Personen. Die Haushaltsvorsteher
waren als Viehhändler tätig. Bis zu Beginn der Deportationen sind die meisten
der jüdischen Einwohner von Aßlar verzogen oder ausgewandert. Die Hermannsteiner jüdischen Einwohner konnten nach den USA beziehungsweise nach
Südamerika auswandern.
Von den in Aßlar geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gertrud Becker geb. Brodreich (1899), Sabine Danzig
geb. Mildenberg (1877), Berta Engel geb. Lindenbaum (1876), Emma Lindenbaum (1872),
Siegmund Lindenbaum (1883), Bertha Mildenberg (1878), Hermann Mildenberg (1868),
Louis Mildenberg (1897), Norbert Mildenberg (1894), Johanna Rosenbaum geb. Kahn
(1878), Cilly Weinhausen geb. Kahn (1896).
Am 10. Mai 2010 wurden in Aßlar zwei "Stolpersteine"
verlegt für Sabine Danzig und Bertha ("Billa") Mildenberg (vor dem
Haus Oberstraße 24a). Die Initiative ging von dem Runden Tisch "Zur
Spurensicherung jüdischen Lebens in Aßlar" aus (siehe Bericht,
zugänglich über LInk in der Literaturliste).
Von den in Hermannstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Amalie (Malchen,
Juliue) Isselbächer geb. Simon (1890), Rosa Levi geb. Mendelsohn (1885), Julie
(Julchen) Mainzer geb. Simon (1888), Eva Michel (1871), Isack Simon (1859),
Jakob Simon (1856).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Berichte
Bestände im Museum Jüdischer Altertümer in
Frankfurt (1938)
 Aus einem Artikel über die Bestände des Museums im "Gemeindeblatt
der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom April 1938 S. 10:
"Aus Friedberg sind zu nennen: ein Besomimturm, der das Datum 1651
trägt, wahrscheinlich aber schon im 16. Jahrhundert entstanden ist, ein
prachtvolles Toraschild und eine reich ornamentierte silberne Torakrone,
aus Wetzlar und dem benachbarten Aßlar: zwei schöne Toraweiser,
Frankfurter Arbeiten um 1735, und ein seltenes gotisches Gießgefäß in Bronze
aus dem 14. Jahrhundert, das zur Handwaschung am Eingang der Synagoge von
Wetzlar sich befand." Aus einem Artikel über die Bestände des Museums im "Gemeindeblatt
der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom April 1938 S. 10:
"Aus Friedberg sind zu nennen: ein Besomimturm, der das Datum 1651
trägt, wahrscheinlich aber schon im 16. Jahrhundert entstanden ist, ein
prachtvolles Toraschild und eine reich ornamentierte silberne Torakrone,
aus Wetzlar und dem benachbarten Aßlar: zwei schöne Toraweiser,
Frankfurter Arbeiten um 1735, und ein seltenes gotisches Gießgefäß in Bronze
aus dem 14. Jahrhundert, das zur Handwaschung am Eingang der Synagoge von
Wetzlar sich befand." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Berthold Bornheim (1924)
 Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 17. Januar 1924: "Unter großer
Anteilnahme der ganzen Einwohnerschaft wurde in Aßlar (Kreis Wetzlar)
Herr Berthold Bornheim, der den Folgen einer im Kriege erlittenen
Gastvergiftung zum Opfer fiel, zu Grabe getragen. In seinem Nachruf
betonte ein Offizier des Regiments besonders die treue Kameradschaft,
deutsche Gesinnung und große Tapferkeit des Verstorbenen, der bei einem
Gefecht unter eigener Lebensgefahr seinen tödlich getroffenen Hauptmann
aus dem Feuer geholt hat." Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 17. Januar 1924: "Unter großer
Anteilnahme der ganzen Einwohnerschaft wurde in Aßlar (Kreis Wetzlar)
Herr Berthold Bornheim, der den Folgen einer im Kriege erlittenen
Gastvergiftung zum Opfer fiel, zu Grabe getragen. In seinem Nachruf
betonte ein Offizier des Regiments besonders die treue Kameradschaft,
deutsche Gesinnung und große Tapferkeit des Verstorbenen, der bei einem
Gefecht unter eigener Lebensgefahr seinen tödlich getroffenen Hauptmann
aus dem Feuer geholt hat." |
Zur Geschichte der Synagoge
Im 18. Jahrhundert nahm die Zahl der jüdischen Bewohner in
Aßlar und umgebenden Orten so zu, dass 1758 eine Synagoge (beziehungsweise ein
Betsaal) in Aßlar eingerichtet werden konnte.
Die Synagoge in Aßlar wurde vermutlich bis Anfang des 20. Jahrhundert genutzt. 1922
wurde sie nicht mehr für gottesdienstliche Zwecke verwendet. Dennoch blieb das
Gebäude bis nach 1933 erhalten. 1936 wurde sie verkauft:
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1936:
"Die Synagoge in Aßlar im Kreise Wetzlar ist zum Abbruch verkauft
worden. In Aßlar wohnen nur noch drei jüdische Familien." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1936:
"Die Synagoge in Aßlar im Kreise Wetzlar ist zum Abbruch verkauft
worden. In Aßlar wohnen nur noch drei jüdische Familien." |
Das Synagogengebäude wurde 1937 wegen
Baufälligkeit abgebrochen. Auf dem Gelände wurde ein Gärtchen angelegt, das
bis heute besteht. Der genaue Standort der Synagoge war auf dem Grundstück in
der Oberstraße nicht direkt an der Straße, sondern am Ende eines kurzen
Zufahrtsweges an einem Innenhof.
Adresse/Standort der Synagoge: Oberstraße
(früher Obergasse) 13
Fotos
Fotos/Darstellungen/Pläne
sind noch keine vorhanden. Über Hinweise oder Zusendungen freut sich
der
Webmaster der "Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |
|
| |
|
|
"Stolpersteine"
in Aßlar -
verlegt im Mai 2010
(Foto: Uta Barnikol-Lübeck in einem
Artikel in mittelhessen.de) |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Persönliche Erinnerungen
an
die Familie Lindenbaum
(erhalten von Haim Lindenbaum, Haifa) |
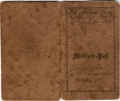 |
| |
"Militair-Paß"
von Jakob Lindenbaum 1866 (geb. 1843), registriert in einem
Ersatz-Bataillon des 2. Nassauischen Infanterie-Regiments Nr. 88
im XI.
Armee Corps
(der Link führt zu einem Wikipedia-Artikel). Jakob Lindenbaum war
der Vater des langjährigen
Gemeindevorstehers Emanuel Lindenbaum (oben
für 1924/32 genannt). |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Legitimationskarte
für Jacob Lindenbaum (geb. 22.8.1911 in Aßlar) als Reisender der Firma
Versand Erzgebirgischer Strumpffabriken Berlin Tempelhof für Bestellungen
auf Strumpfwaren (Ausstellungsdatum nicht klar erkennbar [1932?]). Dieser
Jacob Lindenbaum war der Sohn des langjährigen Gemeindevorstehers Emanuel
Lindenbaum (oben für 1924/32 genannt) |
| |
|
|
- wie oben
abgebildet:
Militärpass für Jakob Lindenbaum aus Asslar, im Militär seit 1866, im
Kriegseinsatz 1870/71
-
Militärpass für Unteroffizier Emanuel Lindenbaum (geb. 7.11.1877 in
Asslar, Schuhmacher, verheiratet mit Cilla geb. Stern; ins Militär
eingetreten 1898; Gefreiter ab 1900, Unteroffizier 1915) mit Angaben zum
Militärdienst im 1. Weltkrieg.
-
Soldbuch für Unteroffizier Emanuel Lindenbaum aus dem Ersten Weltkrieg
- Dazu ein
Verzeichnis der Bekleidungs- und Ausrüstungs-Stücke des Buchinhabers vom
8.6.1918.
-
Dokument vom
10.8.1918 über
die Versetzung von Srgt. Lindenbaum zum Infanterieregiment 87.
- Originale
Geburtsurkunde (1911) für Jakob Lindenbaum, geb. 22.8.1911 in Asslar,
Sohn von Schuhmachermeister Emanuel Lindenbaum und der Zibora geb. Stern
- Weitere
Geburtsurkunde (von 1930) für Jakob Lindenbaum, geb. 22.8.1911 in Asslar.
-
Abgangszeugnis der Freiherr vom Stein-Schule in Wetzlar für Jakob Lindenbaum
im Schuljahr 1926/27
-
Zeugnis des Manufakturwaren- Herren- und
Damenkonfektions-/Modewarengeschäftes Salli Marx in Frankenberg für
Jakob Rosenbaum, Lehrling bei Salli Marx vom 1.5.1927 bis 31.10.1929,
Verkäufer und Lagerist vom 1.11.1929 bis 1.5.1930.
-
Zeugnis des Hamburger Dekorations-Fachschule, die von Jakob Lindenbaum
vom 15.5.1930 bis 15.8.1930 besucht wurde.
-
Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und
Handlungsagenten von 1930 für Jakob Lindenbaum (ausgestellt in
Frankenberg).
- wie oben abgebildet:
Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und
Handlungsagenten von 1932 für Jakob Lindenbaum (ausgestellt in Berlin
1932, mit Passfoto)
-
Mitgliedsausweis des Gewerkschaftsbundes der Angestellten / der Deutschen
Angestellten-Krankenkasse 1931-1933 für Jakob Lindenbaum
- Zeugnis
des Manufaktur-, Kurz-, Weiss- und Wollwaren, Herrenartikel- und
Lebensmittelgeschäftes Leo Stern in Ziegenhain für Jakob Lindenbaum, wo
er vom 15.10.1930 - 30.6.1931 tätig war.
-
Zeugnis des Modehauses Salomon in Gießen vom 20.8.1931 für Jakob Lindenbaum,
vom 3.6.1931 bis 20.8.1931 im Modehaus als Dekorateur tätig.
-
Dokument zur Einstellung von Jakob Lindenbaum bei der Firma Manufakturwaren
/ Möbel Leopold Rapp in Groß-Umstadt (1932)
-
Steuerkarte 1933 für den Kaufmann Jakob Lindenbaum (geb. 22.8.1911 in
Asslar, Karte der Gemeinde Groß-Umstadt)
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 49-50. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirk Gießen und Kassel. 1995 S. 109-110. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 369-370. |
 | Beitrag "Die Juden in Aßlar" (pdf-Datei)
|
 | Keine Angaben zu Aßlar in den Publikationen von Thea Altaras. |
 | Bericht "Spuren jüdischen Lebens - Gunter Demnig
verlegt Stolpersteine" aus der Website des Evangelischen
Kirchenkreises Braunfels (eingestellt
als pdf-Datei) bzw. auf der Website
des Evangelischen Kirchenkreises |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Asslar
Hesse. Jews lived there from the 18th century and (together with those in
Hermannstein) numbered 55 in 1835. By 1910 the community had dwindled to 31 and
most of the remaining Jews left before Wordwar II.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|