|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht über die
Synagogen im Kreis Fulda
Heubach (Gemeinde
Kalbach, Kreis Fulda)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(erstellt unter Mitarbeit des Fördervereins
Landsynagoge Heubach e.V.: www.synagoge-heubach.de)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Heubach bestand eine jüdische Gemeinde bis um 1935/38. Ihre Entstehung
geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1702 wird ein jüdischer
Viehhändler namens Feistelmann genannt. Eine Gemeinde mit den zur Abhaltung von
Gottesdiensten notwendigen Zehnzahl religionsmündiger jüdischer Männer dürfte
seit Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden sein.
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert
wie folgt: 1835 65 jüdische Einwohner, 1861 97 (13,0 % von insgesamt
747 Einwohnern), 1871 88 (12,5 % von 705), 1885 86 (10,7 % von 806), 1905 70
(10,1 % von 696). Jüdische Wohnhäuser am Ort waren Ende des 19./Anfang
des 20. Jahrhunderts u.a. die Gebäude mit den heutigen Anschriften Frankenstr.
2 (Familie Benedikt Adler), Friedensstraße 4 (Familie Mordechai Goldschmidt), 5
(Familie Markus Adler), 13 (Familie Simon Goldschmidt), 20 (Familie Moses Adler
III), Kirchweg 5 und 7 (Familie Moses Adler II), Oberzeller Str. 2 (Familie
Goldschmidt), Rathausgasse 1 (Familie Leopold Kahn), 2 (Familie Lazarus Stern),
4 (Familien Meier und Moses Goldschmidt).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule
(bis 1923) und ein rituelles Bad (im Untergeschoss des Synagogengebäudes). Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war bis 1923 ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Im 19.
Jahrhundert gab es zeitweise einen gemeinsamen Religionslehrer für Heubach und
die Nachbargemeinde Uttrichshausen. Unter
den Lehrern sind noch bekannt: David Albrecht (um 1885/87) und Jakob
Rothschild (mindestens seit 1895 bis zur Zurruhesetzung 1921). Die Toten der jüdischen
Gemeinde wurden in Altengronau
beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk in Hanau.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Jakob Adler (geb.
3.2.1884 in Heubach, gef. 21.4.1917, beigesetzt Kriegsgräberstätte Sissonne/Frankreich).
Um 1924, als noch 40 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (5
% von insgesamt etwa 800 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde der
Viehhändler Simon Goldschmidt. Auch 1932 und bis zur Auflösung der
Gemeinde 1937 war er noch als Gemeindevorsteher tätig. Am Ort wurde er als
"Judenbürgermeister" bezeichnet; bereits sein Vater und Großvater
hatten die Stellung inne. In Heubach war auch auch Mitglied des Kriegervereins,
möglicherweise war er zeitweise auch Mitglied der Gemeindevertretung.
1933 lebten noch 31 jüdische Personen in Heubach (4,8 % von insgesamt
652 Einwohnern). In den folgenden Jahren
ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien
weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1938 waren noch 15 jüdische
Personen am Ort. Bereits einige Jahre zuvor waren auch die beiden noch in Oberzell
noch lebenden jüdischen Familien der Gemeinde in Heubach zugeteilt worden.
1937/37 wurde die jüdische Gemeinde Heubach aufgelöst. Unter den letzten, die
aus Heubach emigrieren konnten, war Emil Goldschmidt, der im März 1940 den Ort
verließ.
Von den in Heubach geborenen und/oder längere
Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen
(Angaben nach den Listen von Yad Vashem,
Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie dem Gedenkbuch
Heubach nach www.synagoge-heubach.de): David
Adler (1878), Hermann Adler (1875), Karoline (Helene) Adler geb. Mansbach
(1876), Rosa Adler geb. Goldschmidt (1894), Simon Adler (1882), Aron Albrecht
(1885), Nathan Albrecht (1887), Regina Bergmann geb. Goldschmidt (1895), Rosa
Blum geb. Rothschild (1895), Regina Blumhof geb. Goldschmidt (1860), Paula
Dessauer geb. Adler (1893), Mathilde Fuchs geb. Adler (1886), Abraham (Aron)
Goldschmidt (1884), Abraham Goldschmidt (1892), Adolf Goldschmidt (1890),
Benjamina Goldschmidt geb. Strauß (1874), Hermann Goldschmidt (1878), Jenny
Goldschmidt (1904), Nathan Goldschmidt (1868), Regine Goldschmidt geb. Strauß
(1866), Salomon Goldschmidt (1867), Selma Goldschmidt geb. Guttmann (1880),
Simon Goldschmidt (1870), Simon Goldschmidt (1876, Gemeindevorsteher), Simon
Goldschmidt (1880), Rosa Hanauer geb. Goldschmidt (1874), Rosa Heilbrunn geb.
Goldschmidt (1890), Ruda (Rita) Italie geb. Adler (1912), Hanna Kahn geb. Adler
(1880), Amalia (Malchen) Klebe geb. Adler (1879), Sophie Knoth geb. Goldschmidt
(1877), Berta Mosheim geb. Kahn (1907), Hannchen Nussbaum geb. Goldschmidt
(1873), Jettchen Rosenzweig geb. Adler (1882), Sofie Rothschild geb. Adler
(1885), Marie (Maria Anna) Salomon (1915), Jette Seelig geb. Adler (1860),
Jeanette Stern (1867), Regina Stern geb. Grünebaum (1878), Sophie Jette Kahn
geb. Stern (1874), Zerline Stern (1869).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers, Vorsängers und
Schächters 1879 / 1882
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879:
"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrerstelle zu Heubach
und Uttrichshausen ist erledigt. Der Wohnsitz des Lehrers ist in Heubach
und hat derselbe wöchentlich zweimal in dem 1/2 Stunde entfernten
Uttrichshausen Religionsunterricht zu erteilen. Bewerber um diese Stelle
wollen ihre Meldungsgesuche mit den erforderlichen Zeugnissen versehen,
binnen drei Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt 600 Mark
nebst freier Wohnung und 1 1/2 Klafter Holz jährlich und ansehnlichen
Nebeneinkünften. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879:
"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrerstelle zu Heubach
und Uttrichshausen ist erledigt. Der Wohnsitz des Lehrers ist in Heubach
und hat derselbe wöchentlich zweimal in dem 1/2 Stunde entfernten
Uttrichshausen Religionsunterricht zu erteilen. Bewerber um diese Stelle
wollen ihre Meldungsgesuche mit den erforderlichen Zeugnissen versehen,
binnen drei Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt 600 Mark
nebst freier Wohnung und 1 1/2 Klafter Holz jährlich und ansehnlichen
Nebeneinkünften.
Hanau, den 4. September 1879. Königliches israelitisches Vorsteheramt.
Hamburger." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1882:
"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrer-, Vorsänger- und
Schächterstelle bei der Synagogengemeinde zu Heubach, im Kreise
Schlüchtern, ist erledigt und soll baldtunlichst wieder besetzt werden.
Das jährliche Einkommen besteht in 800 Mark Gehalt nebst freier Wohnung
im Schulhause und 5 Meter Schulholz. Das unständige Einkommen für
Schächten, Privatunterricht etc. wird auf wenigstens 200 Mark jährlich
veranschlagt, jedoch keine Bürgschaft hierfür geleistet.
Bewerbungsgesuche sind innerhalb 14 Tagen an uns zu richten und können
nur solche Bewerber berücksichtigt werden, welche für ihre Befähigung
zum Lehrfache genügende amtliche Zeugnisse besitzen oder imstande sind,
bei der von Königlicher Regierung in Kassel bestellten
Prüfungskommission für israelitische Religionslehrer zu Hanau eine
genügende Prüfung zu bestehen. Hanau, den 26. Mai 1882. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1882:
"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrer-, Vorsänger- und
Schächterstelle bei der Synagogengemeinde zu Heubach, im Kreise
Schlüchtern, ist erledigt und soll baldtunlichst wieder besetzt werden.
Das jährliche Einkommen besteht in 800 Mark Gehalt nebst freier Wohnung
im Schulhause und 5 Meter Schulholz. Das unständige Einkommen für
Schächten, Privatunterricht etc. wird auf wenigstens 200 Mark jährlich
veranschlagt, jedoch keine Bürgschaft hierfür geleistet.
Bewerbungsgesuche sind innerhalb 14 Tagen an uns zu richten und können
nur solche Bewerber berücksichtigt werden, welche für ihre Befähigung
zum Lehrfache genügende amtliche Zeugnisse besitzen oder imstande sind,
bei der von Königlicher Regierung in Kassel bestellten
Prüfungskommission für israelitische Religionslehrer zu Hanau eine
genügende Prüfung zu bestehen. Hanau, den 26. Mai 1882.
Das
israelitische Vorsteheramt. Hamburger." |
| Auf Grund dieser Ausschreibung wurde der
Lehrer David Albrecht angestellt. |
Lehrer Jakob Rothschild tritt in den Ruhestand
(1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Februar 1921:
"Heubach v.d. Rhön, 30. Januar (1921). Nach langer segensreicher
Tätigkeit an der hiesigen öffentlichen Volksschule und in der Gemeinde,
tritt unser Lehrer Herr J. Rothschild in den Ruhestand. Er verlegt seinen
Wohnsitz nach Zwingenberg a.d.
Bergstraße. Mit Bedauern sieht die Gemeinde diesen Mann aus seinem
Dienste scheiden. Herr Rothschild erfreute sich großer Beliebtheit nicht
nur in jüdischen Kreisen. Möge ihm in seiner neuen Heimat ein
glücklicher Lebensabend beschieden sein." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Februar 1921:
"Heubach v.d. Rhön, 30. Januar (1921). Nach langer segensreicher
Tätigkeit an der hiesigen öffentlichen Volksschule und in der Gemeinde,
tritt unser Lehrer Herr J. Rothschild in den Ruhestand. Er verlegt seinen
Wohnsitz nach Zwingenberg a.d.
Bergstraße. Mit Bedauern sieht die Gemeinde diesen Mann aus seinem
Dienste scheiden. Herr Rothschild erfreute sich großer Beliebtheit nicht
nur in jüdischen Kreisen. Möge ihm in seiner neuen Heimat ein
glücklicher Lebensabend beschieden sein." |
| Hinweis: Bericht zum Tod der Frau von Lehrer Jakob
Rothschild (1924) auf der Seite
zu Zwingenberg. |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Verlobungsanzeige von Mally Adler und Dr. Rudolf
Freudenberger (1923)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923: "Gott
sei gepriesen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923: "Gott
sei gepriesen.
Mally Adler - Dr. med. Rudolf Freudenberger.
Verlobte.
Heubach / Schüchtern -
Bergen - Frankfurt am Main /
Thüngen.
7. Elul 5683" (= 19. August 1923). |
| Hinweis: Hochzeitsanzeige und weitere
Informationen auf der Seite zu Thüngen. |
Verlobungsanzeige von Selma Katz und David Rothschild
(1927)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 30. Juni 1927: "Baruch HaSchem - Gott sei gepriesen Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 30. Juni 1927: "Baruch HaSchem - Gott sei gepriesen
SELMA KATZ
DAVID ROTHSCHILD
Verlobte
New York
New York
Heubach v. d. Rhön
Eckardroth Kreis Schlüchtern.
Juni 1927." |
Verlobungsanzeige von Selma Daube und Binyamin (Willi) Katz (1935)
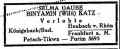 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1935: "Selma
Daube - Binyamin (Willi) Katz. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1935: "Selma
Daube - Binyamin (Willi) Katz.
Verlobte. Königsbach/Baden - Heubach
v. Rhön / Frankfurt am Main.
Petach-Tikwa - Purim 5695." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war nach einem Bericht von 1836 ein Betsaal in einem
kleinen Zimmer eines jüdischen Wohnhauses eingerichtet. Als die jüdische
Gemeinde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts größer wurde, wurde der Neubau
eines Synagoge nötig. Nachdem 1840 die frühere Zehntscheuer in der
Ortsmitte abgebrochen worden war, erwarb die jüdische Gemeinde das Grundstück
und erbaute auf ihm ein Synagogengebäude mit Schulstube, Lehrerwohnung und
rituellem Bad. Die Baupläne wurden im Frühjahr 1841 von
Landbaumeister Spangenberg aus Steinau angefertigt. 1843 wurde die Synagoge
fertiggestellt und eingeweiht.
Das Synagogengebäude wurde 1937 von
der politischen Gemeinde gekauft (den Kaufvertrag unterzeichnete Vorsteher Simon
Goldschmidt) und entging dadurch der Zerstörung beim Novemberpogrom 1938. Die
Ritualien sind nach Schlüchtern verbracht worden, wo sie beim Novemberpogrom
vernichtet wurden.
Das Synagogengebäude wurde zum Rathaus der Gemeinde umgebaut und als solches bis
1972 verwendet. Da 1971 Heubach in die Gemeinde
Uttrichshausen eingemeindet wurde, wurde das Rathaus Heubach nicht mehr gebraucht. Jahrelang blieb das Gebäude ungenutzt und
wurde zunehmend baufällig, zuletzt war ein Motorradclub eingezogen. Das
Grundstück war bereits vom hessischen Straßenbauamt zur Straßenerweiterung
gekauft worden. Mitte der 1980er-Jahre bestand kurzzeitig der Plan, das Gebäude
abzubrechen und nach Gießen zu versetzen, um dort wiederum als Synagoge
verwendet zu werden. Wenig später begannen Überlegung zu einer
Renovierung und einer neuen Nutzung am Ort. Vom "Fortbildungszentrum für Handwerk
und Denkmalpflege Probstei Johannesberg, Fulda" wurde im Auftrag des
Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 1990 ein Gutachten erstellt, in dem
Vorschläge zur Renovierung auf Grund der Untersuchungen der Bausubstanz
erarbeitet wurden.
Auf Grund der intensiven Bemühungen u.a. des
"Fördervereins Landsynagoge Heubach e.V." konnte die ehemalige
Synagoge in den Jahren 2005/06 umfassend renoviert werden. Das Hessische
Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Landkreis Fulda stellten für
die insgesamt 740.000 € kostende Herrichtung des Gebäudes Zuschüsse in Höhe
von je 200.000 € zur Verfügung. Große Beiträge stellten auch das Landesamt für Denkmalpflege (100.000 €), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
(85.000 €), der Förderverein Landsynagoge Heubach (65.000 €), die
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck (50.000 €), die Gemeinde Kalbach (65.000
€), die Stiftung Sparkasse Fulda (100.000 €) und der Kreisausschuss Fulda
(5.000 €) zur Verfügung. Seit der Fertigstellung des Gebäudes
in Frühjahr 2006 wird die ehemalige Synagoge Heubach als kulturelle
Begegnungsstätte verwendet.
Adresse/Standort der Synagoge: Friedenstr. 9
Kontaktmöglichkeit zum Förderverein: Förderverein Landsynagoge
Heubach e.V. c/o Johanna Rau, E-Mail
Fotos / Pläne
(Quelle der Fotos von 1985/1990 und der Rekonstruktionszeichnungen: Altaras
1988/1994 und aus dem Archiv des Fördervereins Landsynagoge Heubach e.V.)
Haus der Betsaales
ab 1836 |
 |
|
In dem gegenüber
der späteren Synagoge gelegenen ehemaligen jüdischen Wohnhaus
(auf Foto
linker Gebäudeteil) befand sich seit 1836 der Betsaal der Gemeinde |
| |
|
Das Synagogengebäude
zwischen 1937 und 2005
|
 |
 |
| |
Foto aus der Zeit der
ehemaligen Synagoge
als Rathaus (Förderverein) |
Westliche Trauseite und
Nordgiebel
(1985, Altaras) |
| |
|
|
 |
 |
 |
Östliche Traufseite des
ehemaligen Synagogengebäudes (1985/90)
(Altaras) |
Das Gebäude vor Beginn der
Restaurierung (Förderverein) |
| |
|
| Rekonstruktionen
der Grundrisse |
|
 |
 |
 |
Obergeschoss mit Frauenempore
und Lehrerwohnung |
Erdgeschoss mit Betsaal der
Männer,
Schulraum und Teil der Lehrerwohnung |
Untergeschoss und Grundriss des
rituellen
Bades im Untergeschoss der Synagoge:
1 Tauchbecken, 2 Kessel zur
Aufbereitung
zusätzlichen Wassers, 4 Brunnen,
5 Holzröhrenleitung von
einem Brunnen
am Heubach, 6 Pumpe |
| |
|
| |
|
| |
|
|
Die ehemalige Synagoge nach
der Renovierung
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 31.5.2007) |
|
 |
 |
 |
| Blick auf die
ehemalige Synagoge von Westen |
Die bei der Restaurierung
wiederhergestellten
hohen Seitenfenster des Betsaals |
| |
| |
|
 |
 |
 |
Eingangstüren (links zur
Lehrerwohnung /
Schule / Frauenempore; rechts zum
Betsaal der Männer |
Blick von der Frauenempore in
den Betsaal.
Zwischen den hohen Fenstern befand
sich der Toraschrein |
Bemalung oberhalb des
ehemaligen Toraschreines |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
Im Bereich des Toraschreines
hebräisch
und deutsch: "Erkenne, vor wem Du stehst"
|
Frauenempore |
Blick in den Betsaal zur
Empore; vorne ein
Lesepult mit einem Memorbuch für die
früheren
jüdischen Einwohner Heubachs |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Der Sternenhimmel |
Bemalungen der Decke und der
Wände
aus unterschiedlichen Zeiten |
Der ehemalige Schulraum |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Das rituelle Bad
mit dem Tauchbecken |
Ein Raum der ehemaligen
Lehrerwohnung |
| |
|
| |
 |
|
| |
Beim Synagogengebäude:
ehemalige
jüdische Wohnhäuser |
|
| |
|
|
Das
Synagogengebäude im April 2018
(Fotos in hoher Auflösung;
erstellt am 3.4.2018 von J. Hahn) |
 |
 |
| |
Blick von
Westen auf das Synagogengebäude |
Blick von
Osten |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Der
Eingangsbereich |
Links Eingangstür
|
Hinweistafeln am
Eingang |
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
2007:
Denkmalpreis für Heubach.
Wirtschaftsminister Corts zeichnet Förderverein der Landsynagoge aus -
Pressemitteilung.
Der Förderverein Landsynagoge Heubach ist für die Erhaltung und
Umgestaltung der ehemaligen Synagoge in dem Kalbacher Ortsteil mit dem
Hessischen Denkmalschutzpreis 2007 ausgezeichnet worden. Das Engagement
des Vereins wird nicht mit einem Geldpreis belohnt, sondern ist "nur" mit
der Anerkennung nebst einer Urkunde verbunden. Das tut der Freude in
Kalbach keinen Abbruch: "Wir haben ja das Geld schon vorher als Förderung
bekommen", sagt Pfarrerin Johanna Rau, die Vorsitzende des Fördervereins,
nach der Rückkehr aus Rüdesheim. Dort hatte der Hessische Minister für
Wissenschaft und Kunst, Udo Corts (CDU), gestern die insgesamt zehn
Preisträger aus ganz Hessen vorgestellt.
Die
Auszeichnung, so Corts, würdige denkmalpflegerische Leistungen, "die über
das denkmalschutzrechtlich Gebotene hinausgehen und überregionale
Bedeutung beanspruchen können."
Das Gebäude stand jahrelang leer
Der
Heubacher Förderverein war mit einer kleinen Delegation nach Rüdesheim
gefahren, der sich neben aktuellen und früheren Vorstandsmitgliedern auch
der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Stefan Burkard, sowie der frühere Bürgermeister
Kalbachs, Karl-Heinz Kaib, angeschlossen hatten.
Die
1843 gebaute ehemalige Synagoge in Heubach, die in den 30er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts von der jüdischen Gemeinde verkauft worden war,
diente danach bis zur Gebietsreform als Rathaus Heubachs. Das Gebäude
stand jahrelang leer, bevor es von 2003 bis 2006 saniert wurde, um darin
eine kulturelle Begegnungsstätte einzurichten. An dem Projekt habe sich
der Förderverein der Landsynagoge Heubach mit seiner Vorsitzenden,
Johanna Rau, mit beispielhaftem Engagement beteiligt", begründet Corts
die Auszeichnung.
Das
Bauwerk war für insgesamt 740.000 Euro restauriert worden. "Die
Verleihung des Denkmalschutzpreises unterstreicht, welche Bedeutung dieses
Projekt überregional hat", unterstreicht Kalbachs Bürgermeister Dag
Wehner (CDU). "Ohne das umfassende Engagement des von Rau geführten
Vereins wäre das Haus möglicherweise abgerissen worden", sagt Wehner.
Der
Verein freue sich über die Auszeichnung. Die Feier habe auch ein
Zusammentreffen mit vielen Wegbegleitern und Förderern des Projekts ermöglicht.
Das habe gezeigt, wie viele Menschen und Institutionen an der Erhaltung
der Heubacher Synagoge beteiligt seien, bilanziert Rau.
Jetzt
schaut der Verein nach vorne: Weil der diesjährigen "Tag des offenen
Denkmals" unter dem Motto "Historische Sakralbauten" steht, freuen sich
die Heubacher am 9. September auf viele Besucher.
|
| |
2008:
 Internationale Ehrung für hessische Pfarrerin Internationale Ehrung für hessische Pfarrerin
Die kurhessen-waldeckische Pfarrerin Johanna Rau wurde mit dem
"Obermayer German Jewish History Award" ausgezeichnet.
F u l d a (idea) – Die kurhessen-waldeckische Pfarrerin Johanna Rau (Oberkalbach bei Fulda) hat die Landsynagoge in Kalbach-Heubach vor dem Verfall bewahrt. Dafür erhielt sie eine hohe internationale Auszeichnung - den
"Obermayer German Jewish History Award" (Obermeyer-Preis für Deutsch-Jüdische Geschichte).
Die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit dem Jahr 2000 an Deutsche vergeben, die sich um die jüdische Geschichte und Kultur besonders verdient gemacht haben. Der Preis wurde von dem US-amerikanischen Unternehmer Arthur Obermayer (West Newton bei Boston) gestiftet, dessen Vorfahren aus Creglingen/Tauber stammen. Der Jury gehört auch der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper (SPD), an. Die Preisträger müssen von Jüdinnen und Juden vorgeschlagen werden, die außerhalb Deutschlands leben. Als Vorsitzende eines Fördervereins hat sich die 43-jährige Theologin für die Rettung der Synagoge engagiert. Das Preisgeld kommt der Arbeit zugute, sagte sie gegenüber
ideaHessen. Das Haus war von 2000 bis 2004 für 780.000 Euro denkmalgerecht saniert und zu einer kulturellen Begegnungsstätte umgebaut worden. Das Geld war von der öffentlichen Hand, der kurhessen-waldeckischen Kirche und Privatspendern zur Verfügung gestellt worden. 2006 hatte das Projekt den Hessischen Denkmalschutzpreis erhalten. Auch die Kirchengemeinde nutzt die ehemalige Synagoge für Veranstaltungen. Bereits während ihres Studiums hatte sich die Theologin in den jüdisch-christlichen Dialog eingebracht und auch ein Jahr in Jerusalem verbracht.
"Das Christentum ist ohne das Judentum nicht zu denken. Den größten Teil unserer Bibel, das Alte Testament, haben wir mit den Juden
gemeinsam", sagte sie zu ihrer Motivation. Seit 1998 teilt sie sich mit ihrem Ehemann, Pfarrer Hubertus
Marpe, die Pfarrstelle Oberkalbach.
Quelle: Idea vom 15. Februar 2008. Artikel |
| |
| Veranstaltungen in der
ehemaligen Synagoge in Heubach 2009 I |
Artikel in der "Fuldaer Zeitung" (Artikel)
vom 15. Januar 2009:
KALBACH-HEUBACH "Was ist das größte Gebot?" – dieser Frage geht der Förderverein Landsynagoge Heubach bei einer Veranstaltungsreihe nach, in der eine Jüdin, ein Christ, eine Muslimin und ein Bahai zu dieser Thematik Stellung nehmen.
"Wir haben diesen Fragenkreis gewählt, weil die ehemalige Heubacher Synagoge ja als ein Ort der Begegnung und des Austauschs genutzt werden
soll", erläutert die Vorsitzende des Fördervereins, Pfarrerin Johanna Rau (Heubach/Bad Wildungen). Die Auseinandersetzung mit dem
"größten Gebot" der monotheistischen Religionen findet an vier Abenden im Juni und Juli
statt.
Wie Rau weiter erläuterte, wird sich eine weitere Veranstaltungsreihe im Mai mit dem biblischen Buch der Psalmen befassen. An vier Abenden wird der aus Heubach stammende evangelische Pfarrer Karl-Josef Gruber
("Koarbalze Karl"), der zurzeit am Marburger Bibelseminar "Auslegung des Alten
Testaments" unterrichtet, in die Gedankenwelt der Psalmen einführen. Den Auftakt des Veranstaltungsprogramms für 2009 bildet ein Vortrag, in dem der Germanist und Historiker Dr. Christoph Münz am kommenden Samstag, 17. Januar, zum Thema
"Im Schatten von Auschwitz – Jüdische und christliche Theologie im Angesicht des
Holocaust" spricht. Der Abend versteht sich auch als Beitrag zum Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Dieser Tag wird in Deutschland seit 1996 als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen.
Musikalischer Abend. Am Sonntag, 25. Januar, wird unter dem Motto: "Mir lejbn ejbik – wir leben
ewig!" ein musikalischer Abend geboten. Ab 19.30 Uhr gestalten Linde Weiland, die ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Fulda, und die Sänger des Freundeskreises
"Jediduth" (Freundschaft) die Veranstaltung mit Legenden, Anekdoten und Liedern.
Für den Sonntag, 8. März, ist ein entwicklungspolitischer Abend geplant, in dem die Eheleute Carmen Kugele und Werner Köhler (Oberkalbach) am Beispiel ihres Einsatzes in Laos über die Arbeit des Deutschen Entwicklungsdienstes berichten. Zudem stellen sie das für Jugendliche gedachte Programm
"Weltwärts" vor. Das Klarinettenensemble Windstärke 12 aus Bad Orb wird am Samstag, 2. Mai, konzertieren.
Alle Veranstaltungen finden in der Begegnungsstätte Ehemalige Landsynagoge Heubach (Friedensstraße 9, Kalbach-Heubach) statt; der Eintritt ist frei; es wird um eine Spende gebeten.
Zudem sind Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude möglich. Terminvereinbarungen sind per E-Mail über
info@synagoge-heubach.de
oder telefonisch unter (06 61) 40 23 82 möglich. Auf der Homepage sind auch Details zu den Veranstaltungen zu finden. |
| |
|
August 2015:
Erster jüdischer Gottesdienst nach etwa 80 Jahren in der Synagoge
|
Artikel von in der "Main-Post" vom 30.
August 2015: "Heubach. Nach 80 Jahren erstmals wieder jüdischer
Gottesdienst in der Synagoge
Erstmals seit rund acht Jahrzehnten hat in Heubachs ehemaliger Synagoge
wieder ein jüdischer Gottesdienst stattgefunden. Der Egalitäre Minjan, eine
liberale Gruppierung innerhalb der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, war
zu der Feier nach Heubach gekommen.
Die Idee dazu war konkret geworden, nachdem die Rabbinerin des Egalitären
Minjans, Dr. Elisa Klapheck, im vergangenen Jahr bei einem Vortrag Gast des
Fördervereins der Landsynagoge unter Vorsitz von Hartmut Zimmermann
war.Gemeinsam mit der Gemeindegruppe gestalteten Rabbinerin Klapheck und
Kantor Daniel Kempin die Feier. Sie war geprägt von dem besonderen Anliegen
dieses Datums, denn sie fand nach dem jüdischen Kalender am Tag Tischa beAw,
dem 9. Tag des Monats Aw statt, der für jüdische Menschen mit besonderem
Gedenken verknüpft ist. An diesem Tag, so berichtet die Überlieferung,
ereigneten sich mehrere dramatische, schlimme Ereignisse der jüdischen
Geschichte: Sowohl die Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem durch
Nebukadnezar als auch die des zweiten Tempels durch die Römer fielen auf
dieses Datum, erläuterte Klapheck. Die ernste Tradition dieses Feiertages
biete daher auch einen Bezug, einen Ort wie die frühere Synagoge der
Heubacher Gemeinde zu besuchen an jüdisches Leben anzuknüpfen.
Erinnern bringt Stärke. Mit den auf Hebräisch angestimmten Versen
'Hüter Israels, behüte den Rest Israels, damit Israel nicht untergehe'
eröffnete Kantor Kempin die Feier. Danach las die Gottesdienstgemeinde, zu
der auch einige Mitglieder des Fördervereins gehörten, Vers um Vers
wechselnd, den Beginn des 137. Psalms. Die Rabbinerin richtete dabei das
Augenmerk besonders auf den Vers 'Sollte ich dich vergessen, Jerusalem, so
versage meine Rechte.' Dieser Satz sei eine Aufforderung sich zu erinnern,
das Schreckliche nicht auszublenden. Denn aus dem Gedenken erwachse Kraft
und Stärke, wohingegen Verdrängen und Ausblenden eine Schwächung zur Folge
habe. Wie zuvor den Psalm, so las die Gemeinde im Wechsel später auch das
dritte, mittlere Kapitel aus den Klageliedern Jeremias, in denen der Prophet
die Lage Israels im babylonischen Exil schildert. Danach stimmte der Kantor
das Kaddisch an. Am Ende stand nochmals der 137. Psalm - mit Kempins
klangvoller Stimme erklang 'By The Rivers Of Babylon' mit der
hitparaden-vertrauten Melodie, mit der Boney M. das Lied einst weltbekannt
gemacht hatten.
Tradition wird lebendig. 'Vielleicht ist es unsere Pflicht, als
Egalitärer Minjan immer wieder einmal solche Orte zu besuchen und
Gottesdienst zu feiern', fasste Rabbinerin Klapheck ihre Eindrücke zusammen.
Es sei eine Chance, an Stätten mit jüdischer Vergangenheit und Tradition zu
gehen, die heute ohne Juden seien und dort jüdisches Leben wieder lebendig
werden zu lassen."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 364-365. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 33-34. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 40-41. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1996 S. 23-24. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 436-437. |
 | Hans Hermann Reck: Die ehemalige Landsynagoge zu
Heubach. Bauforschung an einem Kulturdenkmal des mittleren 19. Jahrhunderts.
Artikel in: Denkmalpflege & Kulturgeschichte Nr. 4. 2005. S. 16-22. |
 | Johanna Rau: Geschichte der jüdischen Gemeinde
Heubach. Online
zugänglich. |
 | 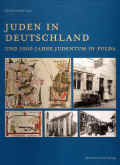 Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.
Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.
hrsg. von Michael Imhof. Zukunft Bildung Region Fulda e. V.
Erschienen im Michael Imhof Verlag
Petersberg 2011.
24 x 30 cm, 440 Seiten, 700 S/W und 200 Farbabbildungen, Hardcover. ISBN 978-3-86568-673-2
(D) 44,00 € CHF 62,90 (A) 45,25 €
Zu Heubach Beitrag von Johanna Rau S. 325-333. |
Hinweis auf familiengeschichtliches Werk
Nathan M. Reiss
Some Jewish Families
of Hesse and Galicia
Second edition 2005
http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |
 |
 |
| |
In diesem Werk
eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familien Goldschmidt, Hess
und Levi-Kann in Heubach, Sterbfritz,
Uttrichshausen und Züntersbach ("The
GOLDSCHMIDT, HESS and LEVI-KANN Families of Heubach, Sterbfritz,
Uttrichshausen, and Züntersbach" S. 143-170) (
Nachkommen bis um 2000) mit zahlreichen Abbildungen
u.a.m. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Heubach an
der Rhoen Hesse-Nassau. The community opened a synagogue in 1835
and grew to 97 (13 % of the total in 1861). Having shrunk to 31 in 1933, it
disbanded and no Jews remained after 1938.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|