|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht über die
Synagogen im Kreis Fulda
Uttrichshausen (Gemeinde
Kalbach, Kreis Fulda )
Jüdische Geschichte / Synagoge
(erstellt unter Mitarbeit von Michael Mott, Fulda)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Uttrichshausen bestand eine kleine jüdische Gemeinde
bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts. 1913 wurde sie aufgelöst.
Bereits im 17./18. Jahrhundert lebten Juden am Ort. Erstmals werden in
der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1633/1641) anlässlich von
Erbstreitigkeiten zwischen dem Grafen von Hanau und dem Hochstift Fulda Juden am
Ort erwähnt. Nach 1720
verzog von Uttrichshausen nach Brückenau
Isaak Sißel, um sich dort als einer der ersten nach der Ausweisung der Juden 1671
aus dem Hochstift Fulda niederzulassen. Vielleicht waren bereits seine
Vorfahren im Hochstift Fulda oder in Brückenau ansässig
gewesen. 1734 kaufte der "Jud mosch" ein Haus vom "Süssel Jud" in
Uttrichshausen. Aus dem 18. Jahrhundert liegen zahlreiche weitere Erwähnungen
jüdischer Einwohner am Ort vor.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1818 sieben jüdische Familien (genannt werden vier Familien Katz
und je eine Familie Goldstein, Goldschmidt und Levi), 1835 68 jüdische
Einwohner (von insgesamt 853 Einwohnern), 1840 70 (von insgesamt 1006
Einwohnern), 1861 61, 1875 59, 1885 acht jüdische Häuser mit zehn Familien, 1893
34 jüdische Einwohner (in sieben Familien), 1894 37 (in acht Familien), 1896 35
(in acht Familien), 1897 39 (in acht Familien), 1898 40 (in acht Haushaltungen),
1899 48 (in neun Haushaltungen), 1901 45 (in acht Haushaltungen), 1903 46 (in
neun Haushaltungen; von insgesamt 800 Einwohnern; 1905 35.
An Einrichtungen bestanden eine kleine Synagoge und ein Schulraum für
den Unterricht der Kinder. Ein eigener Lehrer war wahrscheinlich zu keiner
Zeit vorhanden. 1879 wurde gemeinsam mit Heubach
ein Lehrer angestellt, der seinen Wohnort in Heubach hatte (siehe Ausschreibung
der Stelle unten). Das "Statistische Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen
Gemeindebundes" von 1887 notiert dann auch (S. 14; ebenso 1889 S. 28), dass der
Religionsunterricht der jüdischen Kinder in Uttrichshausen durch Lehrer David
Albrecht von Heubach erteilt wurde. 1892
waren es sieben jüdische Kinder in Uttrichshausen, die inzwischen durch Lehrer
Jakob Rothschild aus Heubach unterrichtet
wurden (1894/1898 sechs Kinder,1899 acht Kinder, weiterhin durch Jakob
Rothschild unterrichtet).
Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Altengronau
beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk
Hanau. Die
Beziehungen zwischen Heubach und Uttrichshausen waren allerdings nicht so eng,
da es beispielsweise kaum eheliche Beziehungen zwischen den beiden Orten gegeben
hat, wie Johanna Rau in der "Geschichte der jüdischen Gemeinde
Heubach" hervorhebt.
Als Gemeindevorsteher wird um 1892/1903 genannt: S. Sondheimer.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind mehrere jüdische Familien von
Uttrichshausen verzogen (nach Fulda, Neuhof und
Flieden). Im Jahr der Auflösung der Gemeinde
1913, als noch 23 Personen der Gemeinde angehörten, war Vorsteher der
Gemeinde Samuel Goldmeier (dies nach der Angaben des "Handbuches der jüdischen
Gemeindeverwaltung" von
1924/25).
Die meisten jüdischen Einwohner haben wohl noch in den 1920er-Jahren
Uttrichshausen verlassen. In der NS-Zeit konnten mehrere der jüdischen Einwohner
in die USA, nach England oder nach Palästina/Israel emigrieren.
Von den in Uttrichshausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Flora Bähr geb. Katz
(1894), Louis (Lazarus) Goldmeier (1874), Nathan Goldmeier (1879), Frieda
Gottlieb geb. Sondheimer (1883), Frieda Heß geb. Katz (1903), Benny Katz
(1892), Lina Katz (1900), Max Katz (1895), Paula Katz (1898), Sara Kaufmann geb.
Katz (1888), Selma Rosenthal (1889), Hannchen Strauß geb. Katz (1896), Paula
Wahlhaus geb. Goldmeier (1897).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Hinweis auf einen Bericht zur
Auflösung der Gemeinde (1913)
Anmerkung: Jahrgang 1913 der Zeitschrift "Der Israelit" ist online leider
nicht zugänglich, daher konnte der Artikel in compactmemory
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/nav/index/title/ nicht eingesehen
werden.
 Aus
den "Mitteilung des Gesamtarchivs der Deutschen Juden" 1914 S. 186: Hinweis
auf "Uttrichshausen... Bericht über die Auflösung der Gemeinde (Der
Israelit LIV nr. 38 S. 9)." Aus
den "Mitteilung des Gesamtarchivs der Deutschen Juden" 1914 S. 186: Hinweis
auf "Uttrichshausen... Bericht über die Auflösung der Gemeinde (Der
Israelit LIV nr. 38 S. 9)." |
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1879 - gemeinsam mit Heubach
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879: "Bekanntmachung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879: "Bekanntmachung.
Die israelitische Religionslehrerstelle zu Heubach und Uttrichshausen
ist erledigt. Der Wohnsitz des Lehrers ist in Heubach
und hat derselbe wöchentlich zweimal in dem 1/2 Stunde entfernten Uttrichshausen
Religionsunterricht zu erteilen. Bewerber im dieser Stelle wollen ihre
Meldungsgesuche mit der erforderlichen Zeugnissen versehen, binnen drei
Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt 600 Mark nebst freier
Wohnung und 1 1/2 Klafter Holz jährlich und ansehnlichen
Nebeneinkünften.
Hanau, den 4. September 1879. Königliches israelitisches Vorsteheramt. Hamburger." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod des aus Uttrichshausen stammenden langjährigen Gemeindevorstehers
in Neuhof David Sondheimer (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember 1928: "Neuhof
bei Fulda, 1. Dezember (1928). Einen schweren, unersetzlichen Verlust
hat unsere kleine Gemeinde erlitten. Unser Gemeindeoberhaupt, unser
langjähriger Führer Sondheimer ist nicht mehr. Am verflossenen
Donnerstag unternahm der noch im besten Mannesalter, allerdings schon
länger leidende Mann, eine Geschäftsreise nach seinem Geburtsorte Uttrichshausen.
Ahnungslos und wohlgemut betrat er die nächste Bahnstation Kerzell, um
nach vollbrachtem Tagewerk wieder zu seiner Familie heimzukehren. Da
ereilte ihn jäh der Tod. Was Herr Sondheimer für unsere Gemeinde
bedeutete, wird man erst mit der Zeit wahrnehmen. Er war es, der nach dem
frühen Ableben des allverehrten Lehrers Kaufmann Rothschild - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - mit Umsicht und Geschick die
Leitung der führerlosen Gemeinde in die Hand nahm und auf Weitererhaltung
der religiösen Bräuche und Satzungen bedacht war. Trotz schwerster
Kämpfe ließ er sich niemals bereden, von dem geraden Weg der Pflicht
abzugehen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember 1928: "Neuhof
bei Fulda, 1. Dezember (1928). Einen schweren, unersetzlichen Verlust
hat unsere kleine Gemeinde erlitten. Unser Gemeindeoberhaupt, unser
langjähriger Führer Sondheimer ist nicht mehr. Am verflossenen
Donnerstag unternahm der noch im besten Mannesalter, allerdings schon
länger leidende Mann, eine Geschäftsreise nach seinem Geburtsorte Uttrichshausen.
Ahnungslos und wohlgemut betrat er die nächste Bahnstation Kerzell, um
nach vollbrachtem Tagewerk wieder zu seiner Familie heimzukehren. Da
ereilte ihn jäh der Tod. Was Herr Sondheimer für unsere Gemeinde
bedeutete, wird man erst mit der Zeit wahrnehmen. Er war es, der nach dem
frühen Ableben des allverehrten Lehrers Kaufmann Rothschild - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - mit Umsicht und Geschick die
Leitung der führerlosen Gemeinde in die Hand nahm und auf Weitererhaltung
der religiösen Bräuche und Satzungen bedacht war. Trotz schwerster
Kämpfe ließ er sich niemals bereden, von dem geraden Weg der Pflicht
abzugehen.
Um den plötzlich Verstorbenen klagt eine liebende Gattin nebst vier noch
unversorgten Kindern. Welch großer Beliebtheit sich der so jäh
Dahingeschiedene allenthalben erfreute, das konnte man aus dem
Leichenbegängnis erkennen.
Von nah und fern hatten sich zahlreiche Freunde und Verehrer des
Dahingeschiedenen eingefunden, um dem treuen Freunde die letzte Ehre zu
erweisen.
Die Beteiligung seitens der Gemeinde, auch der christlichen Bevölkerung
war eine allgemeine. 'Ein Mensch gleich in seinem Leben der strahlenden am
Horizont auf- und niedergehenden Sonne'. Das war der Text der Trauerrede
des Lehrers Weinberg in Flieden, worin er der andächtig lauschenden
Trauergemeinde den Lebensgang und das segensreiche Wirken des
Heimgegangenen schilderte.
Im Auftrage des Herrn Provinzialrabbiners Dr. Cahn in
Fulda dankte der
Herr Kreisvorsteher Dr. Herz, Fulda dem dahingeschiedenen treuen
Mitarbeiter für die der Gemeinde und der Jüdischkeit geleistete
Mitarbeit. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Bäckerei Lazarus
Goldmeier II. (1898)
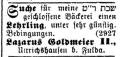 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1898: "Suche für meine
Schabbat und Feiertag geschlossene Bäckerei einen Lehrling,
unter sehr günstigen Bedingungen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1898: "Suche für meine
Schabbat und Feiertag geschlossene Bäckerei einen Lehrling,
unter sehr günstigen Bedingungen.
Lazarus Goldmeier II., Uttrichshausen bei Fulda." |
Anzeige der Metzgerei Meier Katz
(1900)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1900:
"In meiner Sabbat und Festtagen streng geschlossenen Metzgerei, kann ein
starker Junge braver Eltern unter günstigen Bedingungen in
die Lehre treten.
Meier Katz, Uttrichshausen, Station Neuhof, Reg.-Bezirk Kassel." |
Zur Geschichte der Synagoge
1813 erwarben die jüdischen Familien im Bereich der alten Wasserburg das Haus
Nr. 87 und richteten darin eine Synagoge ein. Bis in die Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg wurden Gottesdienste abgehalten.
Nach Auflösung der jüdischen Gemeinde und der Synagoge 1913 kamen der
Tora-Schrank und eine Tora-Rolle an das "Gumpertz'sche Siechenhaus" nach
Frankfurt am Main (Röderbergweg 62-64); zur Geschichte dieser Einrichtung:
https://www.juedische-pflegegeschichte.de/gumpertzsches-siechenhaus-1888-1941-juedische-pflege-fuer-die-aermsten-der-armen-im-frankfurter-ostend/.
Eine Torarolle und ein Tora-Schrank
aus der Synagoge in Uttrichshausen kommen nach Frankfurt (1913)
 Mitteilung
im "Rechenschaftsbericht des Vereins 'Gumpertz'sches Siechenhaus' und der
'Minka von Goldschmidt-Rothschild-Stiftung" (Frankfurt) 1913 S. 25: "Für
die Anstalts-Synagoge wurden gestiftet: ... Mitteilung
im "Rechenschaftsbericht des Vereins 'Gumpertz'sches Siechenhaus' und der
'Minka von Goldschmidt-Rothschild-Stiftung" (Frankfurt) 1913 S. 25: "Für
die Anstalts-Synagoge wurden gestiftet: ...
Von der Israelitischen Gemeinde Uttrichshausen, durch Herrn Lehmann David,
eine Sefer Thora (Tora-Rolle) mit Mäntelchen (Tora-Umhüllung) und ein
Tora-Schrank." |
Das Gebäude der ehemaligen Synagoge in Uttrichshausen wurde zu
einem Wohnhaus umgebaut und blieb auch nach 1945 erhalten, bis es Anfang des
Jahres 2000 abgebrochen wurde.
Adresse der (abgebrochenen) Synagoge:
Talbrückenstraße 6.
Fotos
Es sind derzeit
noch keine
Fotos zur jüdischen Geschichte in Uttrichshausen vorhanden; über
Hinweise und Zusendungen
freut sich der Webmaster der "Alemannia
Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |
| |
|
|
Begräbnisse auf dem jüdischen Friedhof Altengronau - "Haus der Ewigkeit" auch
für Juden aus Uttrichshausen
(Beitrag von Michael Mott / Fulda im September 2021; mit Fotos von Michael Mott)
|
Die Bestattungen der jüdischen Mitbürger der
Synagogengemeinde des geschichtsträchtigen Rhönortes Uttrichshausen Gemeinde
Kalbach/Rhön im Süden des Landkreises Fulda, fanden auf dem
Israelitischen Bezirks-, Verbands- oder
Sammelfriedhof in Altengronau (heute: Gemeinde Sinntal im
Main-Kinzig-Kreis, Hessen) statt, der 1661/1662 (Akte von 1671) eingerichtet
worden war. Für den "Judentotenhof" gab es einen eigenen Vorsteher.
Malerisch über dem Tal der Schmalen Sinn auf dem Grauberg südöstlich,
traditionsgemäß außerhalb der Ortschaft, am Waldrand gelegen, diente er
mehreren Gemeinden als Begräbnisplatz, darunter auch aus dem benachbarten
Bayern. Auf diesem knapp 9.000 Quadratmeter großen eindrucksvollen
Bergfriedhof befinden sich 1.491 erfasste Grabstätten aus der Zeit zwischen
1691(1684?) und 1937. Er ist ein Besuch wert, und ist einer der schönsten
der rund 300 jüdischen Friedhöfe in Hessen; manche sagen, er vermittele ein
Gefühl der Ewigkeit.
Dieser israelitische Totenhof, dessen Grabsteine nicht wie üblich geostet,
sondern nach Süden ausgerichtet sind, ist für Juden ebenso bedeutsam wie
die Synagoge. Hier finden sich 59 Grabsteine (Mazewa), die aufgrund von
Grabsteininschriften oder schriftlichen Nachrichten, Uttrichshausen
zugeordnet werden können.
Der älteste Grabstein ist der von Jetle, Frau des Jonas ha-Levi,
Tochter des Rabbi Löb Unna seligen Angedenkens, die am 3. April 1700
verstorben war. Der jüngste Grabstein ist im jüngeren Friedhofsteil (seit
1875) zu finden und betrifft das Grab von Meier Goldmeier, Sohn des Simon
Goldmeier, geboren um 1841, verstorben am 27. Februar 1908.
Es sind natürlich mehr als 59 jüdische Personen von Uttrichshausen auf dem
Friedhof bestattet, auch eingedenk der Anzahl von jüdischen Mitbürgern, wie
beispielsweise in den Jahren 1835, wo bei 853 Einwohnern, 68 jüdischen
Glaubens waren oder 1885, wo das Dorf 811 Bewohner zählte, wovon 47 Juden
(23 männlich, 24 weiblich) waren, die in acht Wohnungen lebten (an Gebäuden
waren zehn jüdisch).
Familienangehörige wurden auch in Familiengräbern beigesetzt, dabei wurde
auf dem Grabstein, der erst nach einem Jahr nach dem Tode aufgestellt wird,
zumeist kein weiterer Hinweis angebracht; Kinder und Rabbiner und andere
geehrte Personen wurden in vielen Fällen an besonderen Plätzen begraben.
Manche Verstorbene begrub man jedoch ohne Grabstein auf einem besonderen
Gräberfeld, so ledige Personen und im Wochenbett verstorbene Frauen.
Besonders auffällig sind fehlende Grabsteine für die hohe Anzahl von
verstorbenen Kindern. Finanzielle Hintergründe dürften wohl auch eine Rolle
gespielt haben. Die Grabstellen dürfen nicht aufgelöst und neu vergeben
werden.
17-mal taucht der Name "Katz" auf, neun mal Goldmeier, vier mal Goldschmidt,
ebenfalls vier mal Goldstein und vier mal Löw.
Zwei jüdische Mitbürger aus Uttrichshausen, bei denen auch der Ort auf den
Grabsteinen genannt wird, sind auf anderen Friedhöfen bestattet worden,
einmal Löb Heß (1880) in Weyhers,
wohnhaft in Schmalnau (Arije, Sohn des
Benjamin Seew aus Uttrichshausen) sowie Jeanette Friedberger, geborene
Kahn (1884) in Hanau, Wohnort Hanau,
geboren in Uttrichshausen (Witwe Frau Scheinele, 74 Jahre, Ehefrau des
ehrbaren Baruch (Bernhard) Friedberger, Schneidermeister; Tochter von Isaac
Kahn und der Clara geb. Abraham).
Angemerkt sei noch, dass ein Moses Katz aus Uttrichshausen, als
Musketier im 2. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 32, 1. Kompagnie, im
deutsch-französischen Krieg 1870/71 am 2. Dezember 1870 schwer verwundet und
am 7. Dezember im Lazarett von Poupry (Département Eure-et-Loir, Frankreich)
verstorben ist.
Auch Grabsteine erzählen Geschichte:
Manchen Grabsteinen kann man auch Informationen über die jüdische Gemeinde
entnehmen:
* Kind Naftali Moses (Mosche), gest. 23. Juni 1738, Sohn des Rabbi
Samuel (Schmuel), Uttrichshausen.
* Moses (Mosche), gest. 9. Dez. 1803 als "Greis". In der Inschrift
heißte es: "er liebte die Gemeinde und beschnitt die "Lieblinge" zu Ehren
des Schöpfers".
* Samuel (Schmuel) Katz, geb. etwa 1765, gest. hochbetagt am 24. Jan.
1851, Sohn des Moses Mosche) Kohen, wird in der Inschrift seines Grabsteines
als "Vorbeter" bezeichnet.
* Meier Goldschmidt (Me´ir ha-Levi), Thoraschreiber, geb. etwa 1778
gest. 26. Jan. 1844, Sohn des Bendit Goldschmit und der Ester geb. Meier aus
Lendsfelt; wird auf seinem Grabstein als Schreiber von Thorabüchern
bezeichnet, auf seinem Grabstein befindet sich die Darstellung einer
Levitenkanne.
* Simon (Schimon) Goldstein, Thoraschreiber, geb. etwa 1781 verst.
27. Mai 1845; wird auf seinem Grabstein als Studierer und Schreiber von
Thorabüchern bezeichnet.
* Moses (Mosche) Goldstein; Vorbeter ("An Neujahr und am
Versöhnungstag betete er am Vorbeterpult"), gest. 24. Jan. 1877, Sohn des
Simon Goldstein und der Beile Goldschmidt.
* Auf dem Grabstein des Säuglings Joseph Katz (1881), Sohn des
Metzgers Isaak (Jizchak) (Katz) ha-Kohen und der Fanni Rothschild geboren in
Groß-Umstadt, wird Uttrichshausen als "heilige Gemeinde" bezeichnet, das
gleiche auch bei ihrem 2 ½ jährigen Sohn Leobold (Löw), gest. 1884.
*Auf einer ganzen Reihe von Grabsteinen finden sich Darstellungen von
"segnenden Händen". Sie sagen dem Betrachter, dass hier ein Angehöriger
des Priesterstammes der Kohen ruht. Die Kohanimfamilie in Uttrichshausen
nahm den Namen Katz an. Der Krug oder das Kännchen oder der Becher
sind das Zeichen für die niedere Priesterkaste der Leviten. Ihr Ahnherr ist
Levi, einer der zwölf Söhne Jakobs. Die levitische Familie in Uttrichshausen
hieß Goldschmidt.
Nachfolgende die Liste von Grabdenkmälern auf denen Darstellungen von
"segnenden" Priesterhänden" zu finden sind (männliche Personen), dabei
sei angemerkt, dass dies nur diejenigen sind, bei denen sich das Oberteil
des Grabsteines erhalten hat. Die Grabnummern beziehen sich auf die Aufnahme
und kartographierte Karte der Grabsteine:
1) Grab Nr. 69 Löw K"tz aus Uttrichshausen, gest. 27.11.1796
2) Grab Nr. 565 Izik, Sohn des J. Katz, aus Uttrichshausen, gest.
4.3.1846 [Isaak Katz, 73 Jahre]
3) Grab Nr. 867 Jizchak, Sohn des Schmuel ha-Kohen, aus
Uttrichshausen, gest. 6.4.1870 [Isaak Katz, Sohn des Samuel Katz und der
Jend geb. Goldstein, Witwer, 75 Jahre]
4) Grab Nr. 974 Löw, Sohn des Isaak ha-Kohen, ein Kind, aus
Uttrichshausen, gest. 23.11.1884 [Leobold Katz, Sohn des Isaak Katz und der
Fanni geb. Rothschild, aus Groß-Umstadt, 2 1/2 Jahre]
5) Grab Nr. 988 Jehuda, Sohn des Me'ir ha-Kohen, aus Uttrichshausen,
gest. 2.11.1890, 7 Jahre [Leobold Katz, Sohn des Maier Katz und der
Karoliena geb. Goldschmidt von Heubach, 8 Jahre]
6) Grab Nr. 638 Mosche, Sohn des Jehuda Katz, aus Uttrichshausen,
gest. 5.8.1844 [Moses Katz, 63 Jahre]
7) Grab Nr. 840 Nathan, Sohn des Schmuel K"tz, aus Uttrichshausen,
gest. 27.1.1868 [Nathan Katz, Mann der Fanni Lefi, 62 Jahre]
8) Grab Nr. 962 Anschel, Sohn des Isaak ha-Kohen, ein Junge, aus
Uttrichshausen, gest. 5.2.1881
9) Grab Nr. 1172 Jechiel, Sohn des Mosche ha-Kohen, aus
Uttrichshausen, gest. 30.1.1895
10) Grab Nr. 992 Scholem, Sohn des Isaak ha-Kohen, ein Kind, aus
Uttrichshausen, gest. 5.3.1891
Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern aus den Sterberegistern
Uttrichshausen.
Im Judentum werden die Toten möglichst schon an ihrem Sterbetag, spätestens
am nächsten Tag, bestattet, denn erst dann kann die Seele den Körper nach
jüdischem Glauben verlassen. Die Juden von Uttrichshausen hatten ihre Toten
über eine Strecke von etwa 25 Kilometern bis zum Friedhof in Altengronau zu
transportieren. Dabei ging es über Berg und Tal; wie mühsam und strapaziös
dies war, kann man heute nur erahnen, dabei durfte noch nicht einmal eine
einzige Ruhepause eingelegt werden, wie dem Berichterstatter von Nachkommen
Uttrichshäuser Juden berichtet wurde. Nach den Einträgen in den
Sterberegistern kam es aber auch vor, dass die Bestattung erst zwei Tage
nach dem Ableben erfolgte. Wegen der Möglichkeit des Scheintods ist seit dem
19. Jahrhundert eine Frist von 48 Stunden bis zur Beisetzung vorgeschrieben,
seitdem gilt "weltliches Gesetz vor der Religion".
Hauptquellen: - Jüdische Grabstätten:
https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/5522
- Familienregister aus Uttrichshausen: siehe die unten angegebenen
Quellen. |
|
 Der
Israelitischen Verbands- oder Sammelfriedhof in Altengronau Gemeinde Sinntal
im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) wurde 1661/1662 eingerichtet. Zu den jüdischen
Gemeinden die hier ihre Toten bestatteten gehörte auch Uttrichshausen. Hier
die Eingangspforte zum Friedhof mit seinen 1.491 erfassten Grabstätten und
das 1856 wiedererrichtete Taharahaus, das einen Stein für die rituelle
Leichenwaschung, sowie einen Raum der Chewra Kadischa
(Beerdigungsbrüderschaft) beherbergt. Der
Israelitischen Verbands- oder Sammelfriedhof in Altengronau Gemeinde Sinntal
im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) wurde 1661/1662 eingerichtet. Zu den jüdischen
Gemeinden die hier ihre Toten bestatteten gehörte auch Uttrichshausen. Hier
die Eingangspforte zum Friedhof mit seinen 1.491 erfassten Grabstätten und
das 1856 wiedererrichtete Taharahaus, das einen Stein für die rituelle
Leichenwaschung, sowie einen Raum der Chewra Kadischa
(Beerdigungsbrüderschaft) beherbergt. |

links Grabstein Grab Nr. 638: Mosche, Sohn des Jehuda Katz, aus
Uttrichshausen, Viehhändler, gest. 5. August 1844 [Moses Katz, 63 Jahre],
bestattet am 7. August (geb. etwa 1781). |
| |
|
|
|
 |
 |
Grabstein Grab Nr.
840: Nathan, Sohn des Schmuel K"tz, aus Uttrichshausen, gest. 27. Januar
1868, 62 Jahre, bestattet 29. Januar (geb. etwa 1806). Nathan Katz
(Schumacher) war verheiratet mit Fanni Lefi (Levy). Katz wird in den
Standesregistern gelegentlich unter Bemerkungen, von fremder Hand
eingetragen, auch als Musikant bezeichnet.
Ungewöhnliche Darstellungen: auf Vorderseite: segnende Priesterhände, Schale
und Levitenkanne, an den Seitenrändern Rundsäulen; auf der Rückseite: oben
drei nicht sicher zu deutende Objekte, in der Mitte möglicherweise eine
Sanduhr (Stundenglas), die beiden äußeren eventuell Zangen.
Inschrift Vorderseite (Übersetzung der hebräischen Inschrift):
Hier ruht
[einer, der] "rechtschaffen wandelte und Recht tat"1,
mit ganzem Herzen diente er seinem Schöpfer
und war friedliebend bis zu seinem Tod.
"Er war reinen Herzens und hatte unschuldige Hände"2
Mit einem reinen Herzen und mit unschuldigen Händen ging er hin-
auf in den Himmel: Nathan, Sohn des Samuel Katz,
Uttrichshausen. Gestorben am Montag, den 3.
Schewat, und begraben am Dienstag [5]628 n.d.k.Z.
Seine Seele sei eingebunden im Bunde des Lebens.
1) Ps. 15, 2 2) Ps. 24, 4. |
|
|
|
 |
 |
Michael Berney aus Kfar
Jedidia/Israel (1908 - 1991), dessen Mutter Frida Katz aus Uttrichshausen
stammte (* 1877, Haus-Nr. 103, später Nr. 92, + 1953/Israel) mit Sohn Giora
Ende August 1982 auf dem jüdischen Friedhof in Altengronau auf der Suche
nach Grabstätten der Familie Katz. Michael Berney wanderte, nach
landwirtschaftlicher Ausbildung auf dem jüdischen Lehrgut Rodges (Kibbuz)
bei Fulda, 1929 nach Israel aus . |
| Aus der Vielzahl
von Informationen können wir uns ein recht gutes Bild über die jüdische
Gemeinde Uttrichshausen machen. Es wird von Gemeindevorstehern, Vorbetern,
Vorsängern und Lehrern berichtet, auch von Thorarollenschreibern, einem "Beschneider",
einem Musikant (Schofarbläser?) erfahren wir, Nachrichten über Betsaal,
Religionsschule und Synagoge, über jüdische Wohnplätze, berufliche
Tätigkeiten und familiäre Ereignisse und weiteres mehr. So kann an erkennen,
dass die jüdische Gemeinde gut aufgestellt war, nicht reich, eben eine
kleine Landgemeinde am Rande der Rhön. |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 364-365 (unter
Heubach) |
 | Kein Artikel in Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |
 | Johanna Rau: Geschichte der jüdischen Gemeinde
Heubach. Online
zugänglich. |
 | 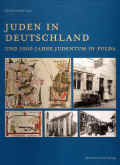 Juden in Deutschland
und 1000 Jahre Judentum in Fulda. Juden in Deutschland
und 1000 Jahre Judentum in Fulda.
hrsg. von Michael Imhof. Zukunft Bildung Region Fulda e. V.
Erschienen im Michael Imhof Verlag
Petersberg 2011.
24 x 30 cm, 440 Seiten, 700 S/W und 200 Farbabbildungen, Hardcover. ISBN 978-3-86568-673-2
(D) 44,00 € CHF 62,90 (A) 45,25 €
Zu Uttrichshausen Beitrag von Michael Imhof S. 374. |
 | Michael Mott: Jüdische Gemeinde Uttrichshausen. In:
"Buchenblätter", Fuldaer Zeitung, 60. Jahrg., Nr. 13 vom 20. Mai 1987, S.
51, 52. |
 | ders.: In Vergessenheit geratene Zeitzeugen – Beispiel:
Synagoge in Uttrichshausen. In: Fuldaer Zeitung, Nr. 37 vom 13. Februar
1992, S. 14. |
 | ders.: "Ehemalige Synagoge wurde abgerissen / Einstiger
jüdischer Kultusbau in Uttrichshausen war schon seit dem Ersten Weltkrieg
kein Gotteshaus mehr", in: Fuldaer Zeitung, Nr. 52 vom 2. März 2000, S. 12.
|
Hinweis auf familiengeschichtliches Werk
Nathan M. Reiss
Some Jewish Families
of Hesse and Galicia
Second edition 2005
http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |
 |
 |
| |
In diesem Werk
eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familien Goldschmidt, Hess
und Levi-Kann in Heubach, Sterbfritz,
Uttrichshausen und Züntersbach ("The
GOLDSCHMIDT, HESS and LEVI-KANN Families of Heubach, Sterbfritz,
Uttrichshausen, and Züntersbach" S. 143-170) (
Nachkommen bis um 2000) mit zahlreichen Abbildungen
u.a.m. |
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|