|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Wittmund mit
Altfunnixsiel und Carolinensiel (Kreisstadt, Ostfriesland/Niedersachsen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Wittmund bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17.
Jahrhunderts zurück Die namentlich ersten Nennungen von Juden in der Stadt
gehen auf 1634 (Jekutiel Blitz in Wittmund geboren; er starb
1689 in Amsterdam) bzw. auf 1639 (Moyses Nathan
aus Wittmund bezahlt seine Schutzgebühren) zurück. 1645 werden genannt:
David Abrahams, Moyses Nathans und Godtschalck Isaacs. 1671 lebten sieben
jüdische Familien in der Stadt (Jacob Calmans, Gößel Sadix, Nathan Levi,
Benedicts Calmans, Levin Wolffs, Philipp Isaacs, Moses Nathan).
Im 18. Jahrhundert gab es 1710 51 jüdische Einwohner in der
Stadt (in elf Haushaltungen), 1744 65 (in 13 Haushaltungen). Die jüdischen
Familienvorsteher waren vor allem als Schlachter und als Pferdehändler tätig
(1744: sechs Schlachter, vier Pferdehändler, drei lebten vom Handel und
Geldverleih; einige lebten vom Geldverleih und Handel. Der wohlhabendste jüdische
Einwohner war Mitte des 18. Jahrhunderts der Kattunhändler und Geldverleiher
Zadeck Cosmar. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert gab es 16 jüdische
Familien in Wittmund.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1804 57 (5 % von insgesamt 1.550 Einwohnern), 1829/33 112 (5,9 % von 1.907), 1848 109
(5,2 % von 2.093), 1861 109 (5,6 % von 1.947), 1871 88 (4,7 % von 1.887), 1885 86
(4,5 % von 1.901), 1895 81 (4,1 % von 1.980), 1905 71 (3,4 % von 2.116), 1913 66
(3,1 % von 2.141).
Zur jüdischen Gemeinde gehörten auch die in Altfunnixsiel
(im 18. Jahrhundert zeitweise die Familie des Cosmes Aarenzs) und Carolinensiel
lebenden jüdischen Personen. An letzterem Ort wurden gezählt: 1736 die Familie
des Michael Jacobs; 1871 27 jüdische Einwohner (1,6 % von insgesamt 1.664
Einwohnern), 1885 21, 1895 20, 1905 9.
Ein Großteil der jüdischen Familien lebte bis zur zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in sehr armseligen Verhältnissen. Erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts verbesserte sich die wirtschaftliche Lage. Inzwischen hatten
mehrere Familien Läden in der Stadt eröffnet (für Kolonialwaren, Obst und
Gemüse, Haushaltsgegenstände, Manufakturwaren, Schuhe). Weiterhin gab es
Schlachtereien sowie Vieh- und Pferdehandlungen im Besitz jüdischer
Familien.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule
(seit 1851 eine jüdische Elementarschule in einem Gebäude in der Buttstraße,
1911 durch ein neues Gebäude mit Lehrerwohnung ersetzt; bis 1924 verwendet),
ein rituelles Bad (seit 1911 im Schulgebäude) und ein Friedhof. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,
der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen unten).
1880 waren in der jüdischen Elementarschule 12 Kinder zu unterrichten. Unter den Lehrern blieb in
besonderer Erinnerung Lehrer Moritz Lachmann, der von 1897 bis zu seinem Wechsel
nach Aurich 1926 in Wittmund wirkte. 1921
unterrichtete Lehrer Lachmann noch fünf Schüler an der jüdischen
Elementarschule sowie drei Religionsschüler.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Isidor Cohen (geb.
30.10.1869 in Wittmund, vor 1914 in Herbern, Westfalen wohnhaft, gef.
24.2.1917). Nach Angaben von D. Fraenkel (s. Lit. S. 1570) war auch
Bernhard Schlösser unter den Gefallenen (geb. 11.9.1888 in Ahaus, gef.
22.7.1915).
Um 1924, als noch 53 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt wurden (von
insgesamt 2435 Einwohnern, dazu vier beziehungsweise fünf in Carolinensiel [von
insgesamt 1.527 Einwohnern]), waren die Gemeindevorsteher Nathan Löwenstein und
Louis Donner (zugleich Schulvorsteher). Als Volkschul- und Religionslehrer,
zugleich Kantor und Schochet war bis zu seinem Weggang nach Aurich 1926 der
bereits genannte Moritz Lachmann tätig; er erteilte an der
öffentlichen jüdische Volksschule drei Kindern den Unterricht, dazu an der
Religionsschule der Gemeinde den Unterricht für zehn Kinder. Der
Religionsunterricht an den öffentlichen nichtjüdischen Volksschule für
zusammen sieben Kinder erteilte Lehrer Lachmann. Die Gemeinde nannte sich
offiziell "Synagogengemeinde Wittmund-Carolinensiel". An jüdischen Vereinen
bestanden der Wohltätigkeitsverein Gemiluth Chassodim (1924 16
Mitglieder unter dem Vorsitz von Lehrer Moritz Lachmann, 1932 unter dem Vorsitz von J.
Morgenroth) und der Israelitische Frauenverein (1924/32 mit 18
Mitgliedern unter dem Vorsitz der Frau von Isaak Hess). 1922 hatte Lehrer
Lachmann auch eine Ortsgruppe des "Centralvereins" gegründet (18
Mitglieder). Die Gemeinde gehörte
zum Landrabbinatsbezirk Emden.
1932 waren die Gemeindevorsteher Nathan Löwenstein (1. Vors.), Jan
Morgenroth (2. Vors.) und Isaak Hess (3. Vors. und Schatzmeister). Als Kantor
war inzwischen Abraham Straßfeld tätig. Er erteilte noch sechs jüdischen
Kindern den Religionsunterricht.
1933 wurden noch 40 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Wittmund war bereits in
den frühen 1920er-Jahren ein Zentrum für die Aktivitäten nationalistisch-völkischer
Bewegungen. Am 5. März 1933 erhielt die NSDAP in der Stadt 57,1 % der Stimmen
(im Kreis sogar 71 %). 1934 waren die Gewerbe der jüdischen
Haushaltsvorsteher: Altwarenhandel (1), Textilhandel (2), Schuhhandel (1),
Schlachter (2), Vieh- und Schafhandel (3), Pferdehandel (1). Die Familien waren:
Lehrer Abraham Straßfeld (Buttstraße), Nathan Löwenstein (Klußforder
Straße), Isaak Heß (Klußforder Straße), Adolf Wolf (Brückstraße), Moritz
Wolf (Brückstraße), Louis Donner (Brückstraße), Hermann Donner
(Brückstraße), Marcus Cohen (Brückstraße) Jan Morgenroth (Norderstraße),
David Wolf (Mühlenstraße), David Wolf (Mühlenstraße), Wolf und Max van
Geldern (Mühlenstraße). Adolf Cohen Mühlenstraße bzw. Buttstraße.
Lehrer und Kantor Abraham Straßfeld emigrierte mit seiner Familie Ende März
1935 in die USA. Beim Novemberpogrom 1938 kam es zu schweren
Ausschreitungen gegen die noch in der Stadt lebenden jüdischen Einwohner. Die
meisten der jüdischen Einwohner wurden in einen Stall eingesperrt; neun Männer
wurden in das KZ Sachsenhausen verbracht, dort wochenlang festgehalten und in
dieser Zeit gefoltert schwer misshandelt.
1940 verließen im Zusammenhang mit dem Evakuierungsbefehl für die
ostfriesischen Juden die letzten zwölf Wittmunder Juden ihre Heimatstadt, drei
von ihnen wanderten noch in die USA aus.
Von den in Wittmund geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Alwine Bucki geb. de Leve
(1888), Abraham Adolf Cohen (1874), Albert Cohen (1883), Clara Cohen geb. Pinto
(1898), Ernst Cohen (1885), Frieda Cohen geb. Pinto (1897), Jacob Cohen (1869),
Max Cohen (1871), Henriette (Henni) Cohn geb. Feilmann (1877), Johanna Donner
(1880), Jettchen Engers geb. Hess (1899), Julia (Julie) Engländer geb. Wolff
(1889), Jeanette Fink geb. Cohen (1889), Agnes Auguste Hess geb. Mendelsohn
(1874), Isaak Josef Hess (1870), Iwan Hess (1893), Josef Hess (1906), Karl
Normann Hess (1900), Karoline Hess (1858), Samuel Simon Hess (1863), Simon de
Jonge (1901), Lehrer Moritz Lachmann (1867, s.u.), Anna Löwenstein (1905), Nathan Löwenstein (1875), Berta Mansfeld
geb. Cohen (1880), Josef Julius Neumark (1858), Moritz Moses Lazarus Neumark
(1866), Henriette (Henny) Ostberg geb. Cohen (1867), Amalie Rosenhain geb. de
Leve (1884), Marianne Scholz geb. Donner (1858), Salomon Heinz Seligmann (1907),
Sophie Slobotzky geb. Neumark (1855), Resi Weinberg geb. Wolff (1902), Levy Luis
Lion Wolf (1871), Lilli (Lilly, Lili) Wolff geb. Donner (1887), Moritz Wolff
(1892),
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Elementarlehrers, Vorbeters
und Schochet 1877 / 1880
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. September 1877: "Die Stelle eines unverheirateten
Elementarlehrers, Vorbeters und Schächters in hiesiger Gemeinde, ist am
1. Mai 1878 neu zu besetzen. Gehalt bei freier Wohnung, Heizung 900 Mark
jährlich. Reflektierende wollen sich gefälligst baldigst an uns
wenden. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. September 1877: "Die Stelle eines unverheirateten
Elementarlehrers, Vorbeters und Schächters in hiesiger Gemeinde, ist am
1. Mai 1878 neu zu besetzen. Gehalt bei freier Wohnung, Heizung 900 Mark
jährlich. Reflektierende wollen sich gefälligst baldigst an uns
wenden.
Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde Wittmund in
Ostfriesland." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Februar 1880: "die Stelle eines unverheirateten Elementarlehrers,
Vorbeters und Schächters der hiesigen Gemeinde wird mit dem 1. Mai dieses
Jahres vakant. Das Gehalt beträgt 1000 Mark nebst freier Wohnung und
Feuerung. Es wird noch bemerkt, dass der betreffende Bewerber nur circa 12
Schüler zu unterrichten hat. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Februar 1880: "die Stelle eines unverheirateten Elementarlehrers,
Vorbeters und Schächters der hiesigen Gemeinde wird mit dem 1. Mai dieses
Jahres vakant. Das Gehalt beträgt 1000 Mark nebst freier Wohnung und
Feuerung. Es wird noch bemerkt, dass der betreffende Bewerber nur circa 12
Schüler zu unterrichten hat.
Wittmund. Der Gemeinde-Vorstand: M. Neumark. H. Donner."
|
Letztes
Lebenszeichen von Lehrer Moritz Lachmann (1942)
Anmerkung: Lehrer Moritz Lachmann (geb. 18. Mai 1874 in Schwersenz/Polen,
gest./umgekommen 12. August 1942 in Lodz), war Lehrer der jüdischen Gemeinde in
Aurich seit Ende 1926 bis 1941. Moritz Lachmann stand auch in
besonderer Weise in Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Wittmund, wo er u.a. 23
Jahre lang Schriftführer des Männer-Gesangvereins war. Im Oktober 1941 wurde
er in das Ghetto Lodz deportiert, wo er im August 1942 umgekommen ist. Bewegend
ist die Todesanzeige, die in der Zeitschrift "Der Aufbau" im Juli 1942
abgedruckt ist.
Roberto Lichtenstein (Buenos Aires), Sohn von Else Inge Lichtenstein geb. Hess
und Enkel von Josef Hess (dessen Schwester Friederike Lachmann geb. Hess mit
Lehrer Moritz Lachmann verheiratet war), teilt hierzu per Mail vom 22.8.2011 mit:
"Die in den USA lebenden Gebrüder Lachmann bekamen (wahrscheinlich über
das Rote Kreuz) eine Postkarte von ihrem Vater, Moritz Lachmann, signiert
'Moritz Lachmann, Witwer'. So erfuhren sie vom Tode der
Mutter".
Vgl. Seite
zu den "Stolpersteinen" in Aurich für Ehepaar Lachmann
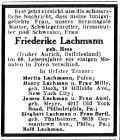 Todesanzeige
in der amerikanisch-jüdischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 31.
Juli 1942 S. 20: Todesanzeige
in der amerikanisch-jüdischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 31.
Juli 1942 S. 20:
"Erst jetzt erreicht uns die schmerzliche Nachricht, dass meine
innigstgeliebte Frau, unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter
und Schwester,
Frau Friederike Lachmann geb. Hess
(früher Aurich, Ostfriesland) im 69. Jahre vor einigen Monaten in Polen
verschied.
In tiefster Trauer: Moritz Lachmann, Polen;
Henry Lachmann und Frau Milly geb. Dach, 10 Hillside Ave., New York
City;
James Lachman und Frau Anni geb. Meyer, 4917 Old York Road, Philadelphia,
Pa.;
Siegbert Lachman und Frau Bertl geb. Thalheimer, 6819 Germantown Ave..
Phila. Pa.;
Rolf Lachman." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und
Privatpersonen
Anzeige des Manufaktur- und Konfektionsgeschäftes J.
Neumark (1875)
Anmerkung: die Familie Neumark gehört zu den bekanntesten jüdischen
Familien Wittmunds. Der Stammbaum lässt sich bis ins 17. Jahrhundert
zurückverfolgen. 1811 hat Abraham Jacobs den Familiennamen "Neumark"
angenommen. Dr. Moritz Neumark (geb. 1866 in Wittmund) war von 1906 bis
zu seiner Pensionierung 1934 Generaldirektor der Lübecker Hochofenwerke. Er ist
nach der Deportation 1943 im Ghetto Theresienstadt umgekommen; seine Frau Ida
konnte durch Vermittlung des Roten Kreuzes noch in die Schweiz ausreisen. Ein
Neffe von Dr. Moritz Neumark war der Ökonom Dr. Fritz Neumark, dessen
Vater Jacob Philipp Neumark 1861 in Wittmund geboren ist. Dr. Fritz Neumark
wurde 1933 als damaliger Hochschullehrer an der Frankfurter Universität
entlassen; nach 1945 kehrte er aus dem Exil nach Frankfurt zurück und war
Rektor der Frankfurter Universität 1954/55 und 1961/62.
Beim unten genannten "J. Neumark" handelte es sich wohl um Jacob
Abraham Neumark, Mitinhaber der Firma A. J. Neumark Söhne in Wittmund
(Manufaktur- und Konfektionsgeschäft in der Brückstraße 161)-
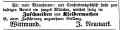 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. September 1875: "Für mein Manufaktur- und
Konfektionsgeschäft suche zum baldigen Antritt ein junges Mädchen,
welches fertig im Zuschneiden und Kleidermachen ist, unter
Zusicherung angenehmer Stellung. Wittmund. J. Neumark."
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. September 1875: "Für mein Manufaktur- und
Konfektionsgeschäft suche zum baldigen Antritt ein junges Mädchen,
welches fertig im Zuschneiden und Kleidermachen ist, unter
Zusicherung angenehmer Stellung. Wittmund. J. Neumark."
|
Zur Geschichte der Synagoge
Bereits im 17. Jahrhundert wurden Gottesdienste der
Wittmunder jüdischen Familien abgehalten, was aus dem Bericht des Pastors
Balthasar Arend von 1684 geschlossen werden kann, wenn er schreibt: "Es
haben auch die Juden durch obrigkeitliches Nachsehen schon über anderthalb
hundert Jahre allhier ihre Schule und Zusammenkunft gehabt...".
Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Gottesdienst bereits über 50 Jahre
lang in einem der jüdischen Wohnhäusern abgehalten. 1815 war das Haus
mit dem Betraum baufällig geworden, worauf die Gemeindevorsteher eine
Hauskollekte für die Errichtung eines Synagogengebäudes in der Kirchstraße
durchführen wollte. Dies wurde von den Ortsbehörden abgelehnt, doch von
Zivilgouverneur von Vincke genehmigt. Darauf konnte eine einfache Synagoge
erbaut und am 9. Februar 1816 eingeweiht werden. Es handelte sich um ein
einstöckiges Klinkergebäude mit 60 bis 80 Sitzplätzen, ein Teil auf einer
Empore für die Frauen. Auch die in Carolinensiel und Altfunnixsiel lebenden
Juden kamen zum Gottesdienst nach Wittmund.
1866 konnte das 50-jährige Bestehen der Synagoge gefeiert werden.
Beim Gottesdienst wirkte auch die Wittmunder Liedertafel mit; Mitglieder der
umliegenden jüdischen Gemeinde waren anwesend.
Die Synagoge wurde bis in die NS-Zeit genutzt. Auf Grund der weiter
zurückgegangenen Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder verkaufte die jüdische
Gemeinde die Synagoge im Juni 1938 an den Kaufmann E. Cornelius. Darauf
wurde sie abgebrochen. Die Torarolle wurde nach einem Bericht auf dem
jüdischen Friedhof vergraben.
Am Grundstück der früheren Synagoge befindet sich seit einigen Jahren eine Gedenkplakette. Die Umrisse der Synagoge sind durch schwarze Basaltsteine
markiert.
Adresse/Standort der Synagoge: Kirchstraße 12
(bzw. Synagogenplatz zwischen den Gebäuden Kirchstraße 10 und
12)
Fotos
(Quelle: Historische Aufnahme oben links aus dem Beitrag von
Eichenbaum/Hinrichs S. 173; historische Aufnahme oben rechts wurde von B.
Garbrecht in Bünde eingestellt auf der Website www.synagogen.info;
Farbfotos: Hahn, Aufnahmen vom August 2015)
Die Kirchstraße mit
der
Synagoge um 1920 |
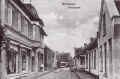 |
 |
| |
Auf der linken Straßenseite
(Mitte) ist
die ehemalige Synagoge erkennbar |
Abbruch der Synagoge
1938 |
| |
|
|
| |
Zeichnung der
Innenansicht der
Synagoge auf einer
Seite des
Heimatvereins Wittmund e.V. |
|
| |
|
|
Gedenkplakette zur
Erinnerung an die
Synagoge in der Kirchstraße 12 |
 |
|
| |
Gedenkplakette in der
Kirchstraße |
|
| |
|
|
Fotos des Synagogenplatzes
im Sommer 2015
(Fotos: Hahn, Aufnahmen vom 13.8.2015) |
|
|
 |
 |
 |
| Informationstafel
"Synagogen-Platz" |
Ansichten
der Gedenkstätte |
| |
|
|
 |
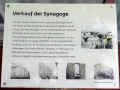 |
 |
| Informationstafel
"Jüdische Gemeinde Wittmund" |
Informationstafel
"Verkauf der Synagoge" |
Informationstafel
"Pogromnacht und 'Entjudung' Wittmunds" |
| |
|
|
| |
|
|
Das frühere jüdische
Schulhaus mit
Lehrerwohnung in der Buttstraße |
 |
  |
| |
Das Gebäude wurde 1911
erstellt; die Jahreszahl ist über dem Eingang erkennbar
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Edzard Eichenbaum / Helmut Hinrichs: Daten
zur Geschichte der Juden in Wittmund und die Wittmunder Judenfamilie
Neumark. In: Herbert Reyer / Martin Tielke (Hrsg.): Frisia
Judaica. Beiträge zur Geschichte der Juden in Ostfriesland. Aurich 1988
(Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands Bd. 67). S.
171-187. |
 | Edzard Eichenbaum: Die Wittmunder Synagoge. Gegen
das Vergessen (Heimatkundliche Blätter 1). 2002. |
 | Daniel Fraenkel: Artikel "Wittmund" in: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in
Niedersachsen und Bremen (Hrsg. von Herbert Obenaus in Zusammenarbeit
mit David Bankier und Daniel Fraenkel). Bd. II Göttingen 2005 S. 1567-1573
(mit weiteren Literaturangaben). |
 |  Reise
ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -
Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.
04941-179957 E-Mail:
kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.
Kostenlos beziehbar. Reise
ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -
Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.
04941-179957 E-Mail:
kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.
Kostenlos beziehbar.
Internet: www.ostfriesischelandschaft.de
"Reise ins jüdische Ostfriesland" ist ein gemeinsames Projekt im Rahmen des dritten kulturtouristischen Themenjahres
"Land der Entdeckungen 2013". Am 9. November 2013 jährte sich zum 75. Mal die Pogromnacht von 1938 in Deutschland. Dies haben 17 Einrichtungen, davon neun Museen und fast alle ehemaligen Synagogengemeinden zum Anlass genommen, sich unter dem Titel
"Reise ins jüdische Ostfriesland" zusammenzuschließen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschwand die jüdische Kultur im Vergleich zum übrigen Deutschland hier bemerkenswert schnell aus dem bis dahin gemeinsamen Alltagsleben von Juden und Nichtjuden.
"Reise ins jüdische Ostfriesland" will an das einst lebendige jüdische Leben in der Region erinnern.
Die Projekte zeigen in beeindruckender Weise, wie ein Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Allen jedoch geht es insbesondere darum, dem vielfältigen jüdischen Leben in Ostfriesland bis zur Shoah und darüber hinaus wieder ein Gesicht zu geben. Denn Erinnerung ist ein Weg zur Heilung und damit zur Versöhnung. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Wittmund,
Hanover. Eight Jewish
families lived here in 1676 and at its peak, in 1878, the community numbered
115. The Jews built a synagogue in 1816 (replaced by a new one in 1910) and
maintained an elementary school between 1846 and 1928. In June 1933, there were
41 Jews registered in Wittmund. Sixteen moved to other German cities and 23
emigrated (19 to the United States). The synagogue had already been disposed of
before Kristallnacht (9-10 November 1938). At least six Jews perished in
the Holocaust.


vorherige Synagoge zur ersten Synagoge
|