|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Sommerhausen am Main (Kreis
Würzburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Sommerhausen bestand eine jüdische Gemeinde seit der
Mitte des
18. Jahrhunderts. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts
zurück: 1532 werden in einer Urkunde die Juden "Samvuel vnd Abraham
zu Sumerhausen" genannt (Urkunde auf der Seite zu Goßmannsdorf).
1813
wurde die Zahl der Matrikelstellen (Zahl der am Ort erlaubten
jüdischen Familien) auf 19 festgesetzt (s.u.). Die Zahl der jüdischen Einwohner im
19. Jahrhundert entwickelte sich wie folgt: 1816 105 jüdische Einwohner
(8,9 % von insgesamt 1.180 Einwohnern), 1867 78 (6,5 % von 1.201), 1888 70, 1890 62 (5,2
% von 1.201), 1893 71 (in 14 Familien), 1900 59(5,1 % von 1.155), 1910 37 (3,2 % von 1.150). Seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Ab- und Auswanderung
somit stark zurück. Die jüdischen Familien lebten insbesondere vom Handel mit
Wein.
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Sommerhausen auf
insgesamt 19 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände
genannt (mit neuem Familiennamen, das Gewerbe wird nur in einem Fall angegeben):
Moses Samuel Adler, Seeligmann Jacob Traub, Schmai Isaac Stopp, Benedikt Moses
Rosenfelder, Abraham Jakob Stern, Elias Beer Stahl, Abraham Salomon Dorn, Nathan
Samuel Grünkorn, David Jonas Franck, Jacob Wolf Strauß (Kleinhändler), Hertz
Benjamin Baum, Nathan Beer Adler, Isaac Wolf Strauß, Aron Seeligmann Traub,
Benjamin Isaac Schloß, Aron Levy Adler, Feifel Jüdlein Palm, Abraham Wolf
Strauß, Joseph Benedikt Rosenfelder. Nicht in die Matrikel wurden aufgenommen,
aber am Ort toleriert: Joseph Aron Barth, Samuel Aron
Barth.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) mit
einer
Religionsschule und der Lehrerwohnung sowie ein rituelles Bad.
Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof Allersheim
beigesetzt. Die jüdischen Kinder besuchten außerhalb des Religionsunterrichtes die
allgemeine Ortsschule; nach einem Bericht des Herrschaftsgerichtes von 1820 gab
es damit keine Probleme. Für den Religionsunterricht und die Besorgung
religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der
zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war (vgl. unten die Anzeigen zur
Ausschreibung der Stelle). Von den Lehrern werden genannt: um 1869/1871
Lehrer Löwenthal, von 1879 bis 1891 Siegmund Pollack (wohnte vermutlich
zeitweise in Goßmannsdorf), bis 1884
Isak Bischkowitz (siehe unten), um 1893/1896 David Sonn
(unterrichtete um 1896 auch die Kinder in
Goßmannsdorf). In besonderer Erinnerung von den Lehrern blieb Philipp
Mandelbaum, der seit 1899 in Sommerhausen angestellt war (vorher in
Ober-Seemen, s.u.). Von
seinem Sohn Hugo Mandelbaum (1901-1997) liegen die Lebenserinnerungen und damit
auch Beschreibungen des jüdischen Lebens in Sommerhausen Anfang des 20.
Jahrhunderts vor (s.Lit. und Text). Die
Religionsschule wurde 1893 von 13 Kindern besucht.
Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat Kitzingen.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1867/1869 Julius Palm; um
1888 M. Palm; um 1892/1900 Julius Sichel.
An jüdischen Vereinen gab es: den Wohltätigkeitsverein Chewra Gemilus
Chasodim (1872 genannt).
Um 1925, als noch
24 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (2 % von ca. 1.200 Einwohnern) waren die
Vorsteher der Gemeinde E. Stahl, R. Landecker und Max Strauss. 1932 ist
Richard
Landecker als einziger Vorsteher vermerkt. Er blieb dies bis zur Auflösung der
Gemeinde (1938, siehe Bericht unten zu seinem 80. Geburtstag 1937).
1933 lebten noch 21 jüdische Personen in Sommerhausen. Am 28. Juli 1938
wurde die Gemeinde offiziell aufgelöst. Damals lebten nur noch sechs jüdische
Personen am Ort. Die anderen waren bis dahin emigriert oder in andere Orte
verzogen. Auswandern konnten u.a. Hannchen Dorn (1936 nach New York) sowie Irma
Lindner geb. Strauss mit den Kindern Erich und Ludwig Lindner (1938 nach
Mexiko). Beim Novemberpogrom 1938 wurden die Wohnungen der letzten jüdischen
Einwohner demoliert. Anfang 1941 wurden noch drei jüdische Einwohner gezählt.
Sie verließen am 6. Februar 1941 den Ort, darunter Mathilde Landecker, die bis
zuletzt in der Lehrerwohnung der Synagoge lebte.
Von den in
Sommerhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Paula Adler geb. Lindo (1882), Sofie Adler geb.
Strauss (1881),
Isidor Buchmann (1875), Max Buchmann (1879), Philipp Buchmann (1882), Martha Heinemann geb.
Klaber (1900), Emma Jüngster geb.
Stahl (1887), Grete Klaber (1907), Martha Klaber geb. Klaber (1900), Pauline
Klaber geb. Strauss (1871), Mathilde Landecker geb. Strauss (1875), Ermestine
Lichtenstein geb. Buchmann (1878), Leopold Löwenthal (1871), Rina (Rica) Lucas
geb. Strauß (1869), Berta Malsch (1876), Elise Mantel geb. Palm (1865), Julius Palm (1869),
Moritz Palm (1889), Lina Rapp geb. Adler (1872), Grete (Gretchen) Rosenzweig geb. Stahl
(1888), Hede Rosenzweig (1924), Karl Stahl (1882), Lazarus Stahl (1881), Paula
Stahl geb. Östreicher (1889), Ernst Strauss (1896), Hedwig Strauss (1897),
Jenny Strauss (1894), Luise Therese Strauss (1911), Mary
Strauss geb. Dessauer (1885), Milton Strauss (1899), Samuel Siegfried Strauss
(1878), Selma Sundheimer geb.
Gallinger (1903), Sigmund Sundheimer (1885), Therese Gertrud Sundheimer (1927), Frieda
Wolff geb. Buchmann (1873), Helene Wolf geb. Buchmann (1872).
Hinweis auf einen "virtuellen Friedhof" der aus Sommerhausen stammenden
jüdischen Personen:
https://www.findagrave.com/virtual-cemetery/1907325. Viele der hier genannten Personen sind auf dem jüdischen Friedhof in
Allersheim
beigesetzt, andere nach der Emigration in den USA usw.
Berichte aus
der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungstexte für die Stelle des Religionslehrers,
Vorsängers und Schächters 1879 / 1891 / 1892 / 1898 / 1900
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1879: "Vakanz.
Durch Berufung unseres Herrn Lehrers nach Frankfurt am Main ist die
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle dahier erledigt.
Dieselbe trägt: Persönlichen festen Gehalt Mk. 470, Beheizung der
Schule Mk 50, Wohnungs-Anschlag im neugebauten Gemeindehause Mk 100,
Erträgnisse der Schächterfunktion ohne Garantie ca. Mk. 400 und noch
besondere Nebenverdienste. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1879: "Vakanz.
Durch Berufung unseres Herrn Lehrers nach Frankfurt am Main ist die
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle dahier erledigt.
Dieselbe trägt: Persönlichen festen Gehalt Mk. 470, Beheizung der
Schule Mk 50, Wohnungs-Anschlag im neugebauten Gemeindehause Mk 100,
Erträgnisse der Schächterfunktion ohne Garantie ca. Mk. 400 und noch
besondere Nebenverdienste.
Gesuche sind franco zu richten an den Vorstand
der israelitischen Kultgemeinde zu Sommerhausen bei
Würzburg." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1891: "Die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist vakant. Der
Gehalt ist 400 Mark freue Wohnung nebst 25 Mark Entschädigung für
Heizung des Schullokales. Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt
mit den sonstigen Nebenverdiensten ca. 4-500 Mark. Bewerber wollen sich
innerhalb 14 Tagen anher melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1891: "Die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist vakant. Der
Gehalt ist 400 Mark freue Wohnung nebst 25 Mark Entschädigung für
Heizung des Schullokales. Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt
mit den sonstigen Nebenverdiensten ca. 4-500 Mark. Bewerber wollen sich
innerhalb 14 Tagen anher melden.
Sommerhausen, 26. August 1891. Der Israelitische Kultus-Vorstand." |
| |
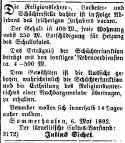 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1892: "Die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist in Folge
Ablebens der seitherigen Inhabers vakant. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1892: "Die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist in Folge
Ablebens der seitherigen Inhabers vakant.
Der Gehalt ist 400 Mark, freie Wohnung nebst 250 Mark Entschädigung für
Heizung des Schullokales.
Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt mit den sonstigen
Nebenverdiensten ca. 4-500 Mark.
Dem Gewählten ist die Aussicht geboten, wahrscheinlich die
Schächterfunktion und die Erteilung des Religionsunterrichtes einer
Nachbargemeinde übertragen, zu erhalten.
Bewerber wollen sich innerhalb 14 Tag anher melden. Sommerhausen, 6. Mai
1892.
Der Israelitische Kultus-Vorstand: Julius Sichel". |
| |
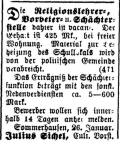 Anzeige
in "Der Israelit" vom 28. Januar 1897: Anzeige
in "Der Israelit" vom 28. Januar 1897:
"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist
vakant. Der Gehalt ist 425 Mk., bei freier Wohnung. Material zur Beheizung
des Schullokals wird von der politischen Gemeinde verabreicht.
Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt mit den sonstigen
Nebenverdiensten circa 5-600 Mark.
Bewerber wollen sich innerhalb 14 Tagen anher melden.
Sommerhausen, 26. Januar. Julius Sichel, Kultus Vorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898:
"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier
ist vakant. Der Gehalt ist Mark 425, bei freier Wohnung. Material zur
Beheizung des Schullokales wird von der politischen Gemeinde verabreicht.
Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt mit den sonstigen
Nebenverdiensten ca. 5 - 600 Mark. Bewerber, wovon verheiratet mit kleiner
Familie den Vorzug erhalten, wollen sich innerhalb 14 Tagen anher
melden.
Sommerhausen, 11. September (1898).
Julius Sichel, Kultusvorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1900:
"Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist
vakant. Das Erträgnis derselben beläuft sich auf ca. 1.200 Mark.
Reflektanten (wovon verheiratete bevorzugt werden), belieben Zeugnisse
einzusenden an
Julius Sichel,
Kultusvorstand, Sommerhausen am Main." |
Spendenaufruf und erste Spenden für
die Witwe des Lehrers Isak Bischkowitz (1884)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 5. Mai 1884: "Edle Glaubensgenossen! Anzeige
in "Der Israelit" vom 5. Mai 1884: "Edle Glaubensgenossen!
In der Gemeinde Sommerhausen, diesseitigen Rabbinates, wirkte seit
mehreren Jahren als Religionslehrer, Vorsänger und Schächter Herr Isaak
Bischkowitz, aus Russland gebürtig. Derselbe wurde leider vor einigen
Wochen im besten Mannesalter von dieser Welt abberufen und hinterließ ohne
irgendwelche Subsistenzmittel eine Witwe mit sieben unversorgten Kindern,
von denen das jüngste erst nach dem Tode des Vaters geboren wurde. Die Lage
dieser unglücklichen Witwe und Waisen ist eine höchst bedauernswerte. Die
Gemeinde Sommerhausen tut ihr Möglichstes, sie ist aber zu klein, um eine
nachhaltige Unterstützung gewähren zu können. Es ergeht daher hiermit die
ergebenste die Bitte an alle edle Glaubensgenossen, sich dieser
unglücklichen Familie erbarmen und reichliche Gaben zu deren nachhaltiger
Unterstützung spenden zu wollen. Er, der (Hebräisch und Deutsch aus Psalm
68,5) 'der Vater der Waisen und der Richter der Witwen', wird sicherlich
seinen himmlischen Lohn den edlen Spendern nicht vorenthalten, und es wird
an ihnen das Wort in Erfüllung gehen: (Hebräisch und Deutsch) 'wer
sich der Menschen erbarmt, dessen erbarmt sich auch der Himmel'.
Die gefälligen Gaben wollen an Herrn Moritz Palm in Sommerhausen am
Main gesandt werden. Auch die verehrliche Expedition dieses Blattes wird
wohl die Güte haben, Gaben in Empfang zu nehmen und weiter zu befördern.
Kitzingen, 25. April 1884.
Hochachtungsvollst Der Distrikts-Rabbiner: Adler.
Wir sind gern bereit, gaben in Empfang zu nehmen und weiterzubefördern. Die
Expedition des 'Israelit'. " |
| |
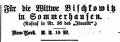 Anzeige
in "Der Israelit" vom 4. August 1884: "Für die Witwe
Bischkowitz in Sommerhausen. Anzeige
in "Der Israelit" vom 4. August 1884: "Für die Witwe
Bischkowitz in Sommerhausen.
(Aufruf in Nummer 36 des 'Israelit'.)
New York. M. B. 10 Mark. "
|
| |
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 18. September 1884: "Für die Witwe
Bischkowitz in Sommerhausen. Anzeige
in "Der Israelit" vom 18. September 1884: "Für die Witwe
Bischkowitz in Sommerhausen.
Abonnent in G. 5 Mark.
Kleinerdlingen. Durch S.
Ettenheimer: Ungenannt in Mühringen
fünf Mark. " |
Ergebnis der Spendensammlung für die Witwe des
Lehrers Isak Bischkowitz (1884)
 |
 |
Links: Aus der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 1. Dezember 1884: Ergebnis der Spendensammlung für
die Lehrerwitwe Bischkowitz - ein Musterbeispiel
hervorragender jüdischer Solidarität und gegenseitiger
Wohltätigkeit. |
Über Lehrer Sigmund (Siegmund) Pollack (Lehrer in
Sommerhausen von 1879 bis 1891)
Anmerkung: Lehrer Sigmund Pollack ist 1854 geboren. Er war von 1879 bis 1891
Lehrer in Sommerhausen, danach als Kultusbeamter, Religionslehrer und
Synagogendiener in Marktbreit (um 1900 für
die Gemeinde Goßmannsdorf tätig, dort
offenbar auch zeitweise wohnhaft). Er war verheiratet mit Therese geb. Bein
(geb. 30.9.1857 in Westheim als Tochter
von Salomon und Marianne Bein), die im hohen Alter aus den Niederlanden
deportiert und im KZ Sobibor im Juli 1943 ermordet wurde. Eine Tochter der
beiden war Clara (geb. 27.9.1888 in Sommerhausen, verheiratet mit Moritz
Weinreb, gest. 11.7.1921; Grab in Bad
Soden (Foto siehe
interner Link) und weitere Informationen siehe
https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/16764), ein Sohn der
beiden war Max Louis Pollack in Würzburg (geb. 1897 in
Marktbreit, gest. 1972 in den USA).
Sigmund Pollack starb im Dezember 1934 in Marktbreit.
Über Lehrer David Sonn (Lehrer
in Sommerhausen von 1891 bis 1896)
Anmerkung: Lehrer David Sonn ist am 19. Mai 1871 in
Mainstockheim geboren als Sohn des
Lehrers Jakob Sonn und seiner Frau Fanny geb. Heinemann. Er wuchs in
Mainstockheim und
Theilheim auf und studierte in der
Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg
bis zu seinem Examen 1891. Anschließend wurde er Lehrer in Sommerhausen,
wo er bis 1896 blieb. In diesem Jahr wechselte er als Religionslehrer, Kantor
und Schächter nach Miltenberg, wo er bis
1898 tätig war. In diesem Jahr bekam er eine Anstellung in Würzburg als Kantor
und Schächter der dortigen Israelitischen Kultusgemeinde. Er heiratete 1901
Hedwig Salomon aus Mandel. Mit ihr hatte er
die Kinder Moses, Berta, Semi und Naftali Hermann. David Sonn war
Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg. In der jüdischen Gemeinde Würzburg war er
für verschiedene Sonderaufgaben tätig. 1932 starb seine Frau Fanny. In diesem
Jahr trat er auch in den Ruhestand. David Sonn starb 1939 in Würzburg. Seine
Kinder konnten in die USA emigrieren.
Über Lehrer Philipp Mandelbaum (Lehrer
in Sommerhausen von 1899 bis 1906)
Der letzte fest angestellte Religionslehrer, Kantor und Schächter der
Kultusgemeinde war Philipp Mandelbaum (geb. 7. November 1870 in
Platz, gest. 10. März 1916 in Sommerhausen). Er
war bis 1899 Lehrer in Ober-Seemen und
wechselte dann nach Sommerhausen. Hier arbeitete er bis 1906 in der jüdischen
Gemeinde und bewohnte mit seiner Familie den ersten Stock des Gemeindehauses.
Sein dürftiges Gehalt zwang ihn dazu, sich um weitere Einkünfte zu bemühen.
Deshalb verlegte er sich auf die Herstellung und den Verkauf von koscherem Wein
und versorgte Gemeindemitglieder mit koscherem Essen.
Philipp Mandelbaum war verheiratet mit Rachel geb. Berlinger aus
Braunsbach (geb. 27. Juni 1867, gest. 12.
Juni 1938).
Zum Sohn Dr. Hugo Chaim Mandelbaum (18. Oktober 1901 Sommerhausen - 25.
September 1997 Jerusalem) siehe u.a.
https://www.geni.com/people/Hugo-Mandelbaum/6000000002706716032 und
https://www.lostlift.dsm.museum/de/detail/person/40f5ea79-845b-4061-ade1-229efe201dbe:
Hugo studierte an der Präparandenschule
Höchberg, danach von 1917-1920 an
der Lehrerbildungsanstalt ILBA in Würzburg.
Danach unterrichtete er an der Israelitischen
Präparandenschule Burgpreppach, ab 1923
an der Talmud Tora Schule in Hamburg mit Studium an der Universität Hamburg,
1934 Promotion ebd. in Geophysik. 1939 Emigration nach Großbritannien, 1940
weiter in die USA. Er wurde Lehrer, dann Direktor an der Yeshiva Beth Yehudah in
Detroit (bis 1948), dann Professor für Geologie der Wayne State University in
Detroit. Er starb mit fast 96 Jahren in seinem Alterswohnsitz Jerusalem.
Zum Tod von Amalie Löwenthal, Witwe des
Lehrers J. Löwenthal (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1928: "Frau
Amalie Löwenthal - sie ruhe in Frieden. Im hohen Alter von
fast 87 Jahren verschied plötzlich am ersten Tag der sieben Wochen des
Trostes (erster Tag ist der 10. Aw = 27. Juli 1928) Frau Amalie
Löwenthal, die Gattin des ihr um etwa zwei Jahrzehnte im Tode
vorausgegangenen, als besonders gottesfürchtiger Mann allbekannten
Lehrers und Schochets J. Löwenthal - seligen Andenkens.
Unermüdlich war sie darauf bedacht, ihr Haus zu einem kleinen Heiligtum
zu gestalten und die von ihr und ihrem Gatten gehegten Ideale zur
Entfaltung zu bringen, was ihr auch gelungen ist. In den Gemeinden Karbach,
Lohr und Sommerhausen in Bayern
hatte sie reichlich Gelegenheit, mustergültig und beispielgebend zu
wirken. Später zog sie mit ihrem Gatten hierher (= Frankfurt). Nach dem
Heimgang ihres Gatten und der Verheiratung ihrer Kinder zog sie sich
zurück, sich an dem Gedeihen ihrer Kinder und Enkel erfreuend. Möge
ihnen allen der Verdienst der frommen Frau beistehen. Ihre Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1928: "Frau
Amalie Löwenthal - sie ruhe in Frieden. Im hohen Alter von
fast 87 Jahren verschied plötzlich am ersten Tag der sieben Wochen des
Trostes (erster Tag ist der 10. Aw = 27. Juli 1928) Frau Amalie
Löwenthal, die Gattin des ihr um etwa zwei Jahrzehnte im Tode
vorausgegangenen, als besonders gottesfürchtiger Mann allbekannten
Lehrers und Schochets J. Löwenthal - seligen Andenkens.
Unermüdlich war sie darauf bedacht, ihr Haus zu einem kleinen Heiligtum
zu gestalten und die von ihr und ihrem Gatten gehegten Ideale zur
Entfaltung zu bringen, was ihr auch gelungen ist. In den Gemeinden Karbach,
Lohr und Sommerhausen in Bayern
hatte sie reichlich Gelegenheit, mustergültig und beispielgebend zu
wirken. Später zog sie mit ihrem Gatten hierher (= Frankfurt). Nach dem
Heimgang ihres Gatten und der Verheiratung ihrer Kinder zog sie sich
zurück, sich an dem Gedeihen ihrer Kinder und Enkel erfreuend. Möge
ihnen allen der Verdienst der frommen Frau beistehen. Ihre Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Mitteilung des Todes von Sigmund
(Siegmund) Pollack (1935)
 Mitteilung
in "Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins in Bayern" vom 15. Januar 1935:
"Vereinsmitteilungen Mitteilung
in "Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins in Bayern" vom 15. Januar 1935:
"Vereinsmitteilungen
1. In den letzten Wochen sind uns die Kollegen Siegmund Pollack und
Salomon (falsch für Samuel) Schwarzenberger in
Bödigheim (Baden), früher in
Kleineibstadt, durch den Tod
entrissen worden. Pollack war Gründungs- und Ehrenmitglied des Vereins (sc.
Jüdischer Lehrerverein in Bayern) und Schwarzenberger zählte seit 1887 zu
unseren Mitgliedern. Wir werden den treuen Freunden und Kollegen ein
ehrendes Andenken bewahren. " |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Herausgabe u.a. des Memorbuches der
jüdischen Gemeinde Sommerhausen (1937)
 Artikel
in der "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" Jahrgang
1937 S. 121 (nur Anfang zitiert): "M. Weinberg: Die Memorbücher
der jüdischen Gemeinden in Bayern. Erste Lieferung. Verlag S. Neumann,
Frankfurt am Main, 1937. 130 Seiten. Artikel
in der "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" Jahrgang
1937 S. 121 (nur Anfang zitiert): "M. Weinberg: Die Memorbücher
der jüdischen Gemeinden in Bayern. Erste Lieferung. Verlag S. Neumann,
Frankfurt am Main, 1937. 130 Seiten.
Durch seine früheren Veröffentlichungen über Memorbücher hat sich Weinberg
als autoritativer Fachmann auf diesem Gebiet erwiesen. Er beabsichtigt
nunmehr, zusammenhängend die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in Bayern
herauszugeben und legt hier das erste Heft vor, das zunächst die Memorbücher
unterfränkischer Gemeinden enthält, und zwar die von
Aub,
Eibelstadt, Goßmannsdorf,
Sommerhausen, Heidingsfeld,
Höchberg,
Bibergau,
Veitshöchheim,
Tauberrettersheim,
Gaukönigshofen,
Giebelstadt,
Rimpar,
Thüngen, Theilheim,
Niederwerrn,
Urspringen,
Kissingen,
Neustadt an der Saale und
Marktbreit. Während die früheren
Arbeiten nur Auszüge enthielten, sind aus diesen 19 Memobüchern sämtliche
Einträge genau wiedergegeben." |
Berichte zu einzelnen Personen der Gemeinde
Zum Tod von Fanni Strauß geb. Flamm (1876)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September 1876:
"Sommerhausen, 4. September (1876). Wohl nur, weil ein solches Wesen
zu gut für diese Welt, hat es der Allgütigen Vorsehung gefallen, Frau
Fanni Strauß, geb. Flamm von Nenzenheim, Gemahlin des Seligmann Strauß
in Sommerhausen abzuberufen, nachdem es ihr kaum vergönnt war, die
Freuden des Lebens kennen zu lernen, sterbend, nachdem sie kaum ihr neugeborenes
Knäblein, die Frucht ihrer bloß 1 1/2jährigen Ehe, an ihr brechendes
Herz drücken konnte, scheidend einen Tag bevor ihr Allerliebstes in den
Abrahamsbund aufgenommen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September 1876:
"Sommerhausen, 4. September (1876). Wohl nur, weil ein solches Wesen
zu gut für diese Welt, hat es der Allgütigen Vorsehung gefallen, Frau
Fanni Strauß, geb. Flamm von Nenzenheim, Gemahlin des Seligmann Strauß
in Sommerhausen abzuberufen, nachdem es ihr kaum vergönnt war, die
Freuden des Lebens kennen zu lernen, sterbend, nachdem sie kaum ihr neugeborenes
Knäblein, die Frucht ihrer bloß 1 1/2jährigen Ehe, an ihr brechendes
Herz drücken konnte, scheidend einen Tag bevor ihr Allerliebstes in den
Abrahamsbund aufgenommen.
Wohl selten wird der Beschneidungsakt in solcher Traurigkeit vollzogen
worden sein, als hier. Dieses Biederweib - eine tüchtige Frau -
lebte als Israelitin fest nach den Satzungen, als Gattin treue Liebe und
Milde spendend, als Frau bescheiden, anspruchslos und überaus mildtätig.
Durch ihr bescheidenes anspruchsloses Wesen sowie durch ihre
Nächstenliebe und Leutseligkeit hatte sie die Herzen aller gewonnen und
wurde ihr die Liebe und Achtung in reichstem Maße erwiesen, sodass ihr
Scheiden allseitig die schmerzlichste Teilnahme von allen Konfessionen
hat. (hebräisch und deutsch:) Hinweg ist der Glanz, geschwunden
die Pracht, dahin ist die Herrlichkeit! Doch ihr besseres Ich lebt in
jenen höheren Sphären als Schutzgeist ihres leider nur allzu früh
verwaisten Söhnchens fort. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens. J.L." |
Zum Tod von Babette Stahl (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Sommerhausen,
12. März (1908). Heute wölbte sich der Grabeshügel über die irdischen
Reste einer Frau, die sich durch ihre Frömmigkeit und Herzensgüte ein
unvergängliches Denkmal im Herzen aller, die sie kannten, gesetzt hat.
Frau Babette Stahl erreichte nur ein Alter von 54 Jahren und erfreute sich
allgemeiner Verehrung und Wertschätzung, was sich bei der überaus
großen Beteiligung an der Beisetzung zeigte. Die Herren
Distriktsrabbiner Adler aus Kitzingen
und Lehrer Goldstein aus Heidingsfeld
gaben der allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Das Andenken der Frommen
wird ein gesegnetes sein! Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Sommerhausen,
12. März (1908). Heute wölbte sich der Grabeshügel über die irdischen
Reste einer Frau, die sich durch ihre Frömmigkeit und Herzensgüte ein
unvergängliches Denkmal im Herzen aller, die sie kannten, gesetzt hat.
Frau Babette Stahl erreichte nur ein Alter von 54 Jahren und erfreute sich
allgemeiner Verehrung und Wertschätzung, was sich bei der überaus
großen Beteiligung an der Beisetzung zeigte. Die Herren
Distriktsrabbiner Adler aus Kitzingen
und Lehrer Goldstein aus Heidingsfeld
gaben der allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Das Andenken der Frommen
wird ein gesegnetes sein! Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Zum Tod von Abraham Rosenfeld aus Sommerhausen (gest.
1909 in London)
Anmerkung: Bei Lazarus & Rosenfeld war eine international bekannte
Porzellanfabrik in London.
 Mitteilung in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 25. Juni 1909: "London.
.… Mitteilung in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 25. Juni 1909: "London.
.…
Im 70. Lebensjahr verschied Abraham Rosenfeld, Seniorchef der
Weltfirma Lazarus and Rosenfeld. Rosenfeld war aus Sommerhausen in
Bayern gebürtig. In verschiedenen jüdischen Organisationen Londons hat er
sich in leitender Stelle betätigt." |
Auszeichnungen an jüdische
Kriegsteilnehmer aus Sommerhausen (1915)
Anmerkung: Karl und Justin Stahl waren Söhne von Elias Stahl und seiner Frau
Babette geb. Kahn (s.u. bei den Anzeigen für seine Eisenhandlung). Karl
(geb. 1882) wurde in der NS-Zeit ermordet, Justin (1890-1964 New York) konnte
1938 in die USA emigrieren. Quelle: Biographische Datenbank Jüdisches
Unterfranken.
 Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Juni 1915: "Auszeichnungen
jüdischer Krieger mit dem Eisernen Kreuze. (Bisher wurden 2899
mitgeteilt, in der vorliegenden Nummer 68, zusammen 2967.) Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Juni 1915: "Auszeichnungen
jüdischer Krieger mit dem Eisernen Kreuze. (Bisher wurden 2899
mitgeteilt, in der vorliegenden Nummer 68, zusammen 2967.)
. . .
Duisburg. Leutnant Karl Stahl, beim Eisenbahnregiment München, zur
Zeit bayerische Eisenbahnbaukompagnie 2, Militärdirektion 2, Sohn des Herren
Elias Stahl in Sommerhausen." |
| |
 Mitteilung in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 24. Dezember
1915: "Sommerhausen. Dem Lazarettinspektor Justin Stahl
wurde das Bayerische Militärverdienstkreuz zweiter Klasse mit Krone und
Schwertern verliehen." Mitteilung in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 24. Dezember
1915: "Sommerhausen. Dem Lazarettinspektor Justin Stahl
wurde das Bayerische Militärverdienstkreuz zweiter Klasse mit Krone und
Schwertern verliehen." |
Zum 80. Geburtstag des Kultusvorstehers Richard Landecker (1937!)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juni 1937: "Sommerhausen,
30. Mai (1937). Am 9. Juni begeht der Kultusvorsteher, Herr Richard
Landecker, seinen 80. Geburtstag. Nach einem arbeitsreichen Leben
übernahm er als Siebzigjähriger die Leitung der alten fränkischen
Kleingemeinde und konnte sie bis heute vor dem Verfall retten. Obwohl seit
einiger Zeit nur noch wenige Familien hier wohnen, hat er es, unterstützt
vom Verband bayerischer israelitischer Gemeinden und der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt Würzburg, fertig gebracht, den Gottesdienst an den
Feiertagen aufrecht zu erhalten und den Religionsunterricht den Kindern zu
sichern. Dass ihm das gelingen konnte, ist ein Erfolg seiner überragenden
Persönlichkeit. Möge seine sichere Hand noch lange die Geschicke der
Gemeinde zum Guten lenken. (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juni 1937: "Sommerhausen,
30. Mai (1937). Am 9. Juni begeht der Kultusvorsteher, Herr Richard
Landecker, seinen 80. Geburtstag. Nach einem arbeitsreichen Leben
übernahm er als Siebzigjähriger die Leitung der alten fränkischen
Kleingemeinde und konnte sie bis heute vor dem Verfall retten. Obwohl seit
einiger Zeit nur noch wenige Familien hier wohnen, hat er es, unterstützt
vom Verband bayerischer israelitischer Gemeinden und der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt Würzburg, fertig gebracht, den Gottesdienst an den
Feiertagen aufrecht zu erhalten und den Religionsunterricht den Kindern zu
sichern. Dass ihm das gelingen konnte, ist ein Erfolg seiner überragenden
Persönlichkeit. Möge seine sichere Hand noch lange die Geschicke der
Gemeinde zum Guten lenken. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |
Über Hugo (Chaim) Mandelbaum (1901-1997)
Aus dem Buch von Hugo Mandelbaum: Jewish Life in the Village Communities of
Southern Germany (Auszug)
Anmerkung zur Person von Hugo Mandelbaum
(nach Strätz: Biographisches Handbuch der Würzburger Juden I,368): geb.
19. Oktober 1901 in Sommerhausen als Sohn des Lehrers Philipp Mandelheim aus
Platz/Ufr. und der Rachel geb. Berlinger aus
Braunsbach; aufgewachsen in
Sommerhausen, wo sein Vater 1916 starb, Lehrerausbildung an der
Israelitischen
Präparandenschule in Höchberg. Unterrichtete dann an der Israelitischen
Präparandenschule Burgpreppach, ab 1923 an der Talmud-Tora-Schule in Hamburg.
In Hamburg nebenher Studium und 1934 Promotion in Geophysik; die
wissenschaftliche Laufbahn wurde durch die NS-Zeit unterbrochen, im März 1939
nach Großbritannien emigriert, 1940 in die USA, 1940-1948 Lehrer und Direktor
der Yeshivah Bet Yehuda in Detroit, 1948-1971 Professor für Geologie der Wayne
State University in Detroit, Spezialist für Ozeanographie; lebte 1981 im
Ruhestand in Jerusalem; starb am 25. Oktober 1997 in den USA).
Memories of Early Childhood. S. 7-8: I was born in Sommerhausen,
a walled townlet on the River Main in the South of Germany. Indeed the majority
of the Jews in that part of the country were concentrated in small communities,
each consisting of a few families living togeter in a close personal
relationship, intensely interested in one another's well-being. All the people I
know cared for each other, and this warm personal concern exerted a strong
influence upon the younger generation.
We lived in the Lehrer's (teacher's) house which belonged to the local
Jewish community. It housed, on the ground floor, a synagogue on the right and a
schoolroom on the left, while we occupied the apartment upstairs. It stood in
the Hetchegass, a narrow side street paved with cobblestones. In front of the
building was a narrow courtyard, surrounded by a wall, thus cutting us off from
our neighbors completely. Broad stone steps led from the yard to the front
entrance.
A few elderly ladies were our next-door neighbors. One of them was hunchbacked.
She would pat me gently whenever she met me in the Hetchegass. I loved this
gesture, as well as the flowers on her windowsill on the first floor. Yet I felt
a strange awe in her presence because of her misshapen body. To me she seemed to
have some type of fairytale air about her. I had the eerie feeling that it would
bode no good to dabble with such forces. Our sukkah was very near her
house, on the inside corner of our yard, and I can still hear her gentle voice
floating down from her window into our sukkah at night, 'Hugo, did you
finish your soup?' This stimulated me more than my mother's urging. I would
finish quickly to be able to reply affirmatively to her next call. She never
needed to verify my reply by looking into my plate. I did not dare contemplate
what consequences could result from such an inspection. Would the gentle
hunchback change into a witch before coming to investigate? Or would her kindly
smile disappear when I would next look at the flowers framing her window? Or
would she stop patting my curly hair when we would meet again in the street?
.....
S. 13-14 My family's living quarters were, as previously mentioned, on the upper
floor of the schoolhouse. In the frontroom, facing the street, stood my father's
writing table and my mother's dresser. Between the dresser and the writing table
was the Fensterbank, on which a chair was set for my mother. Its seat was
level with the window. My mother kept all the things that needed to be repaired
in a drawer of her dresser, and sitting in that chair at the window, she would
do her sewing, mending, knitting, needlework and reading. She had a commanding
view of the Hetchegass and could follow whatever was happening there.
In the corner facing the window stood the black iron stove. It reached from the
floor to the ceiling. The wall between the kitchen and the front room was open
where the stove stood, so that it stood half in one room and half in the other.
The door for the firewood opened into the kitchen, and one of the stove's sides
warmed the bedroom behind the living room. In winter, the food was cooked in
this oven, partly in the kitchen where there was space for two pots and party in
the living room where there was space for another two.
In the middle of the living room, over the table, hung a large kerosene lamp as
well as our beautiful brass Shabbos-lamp. The highly polished, shiny brass of
the Shabbos-lamp reflected the lights of its eight pointed star. Its quiet
dignity and warm holiness permeated the room on Shabbath.
I don't know how and when I learned to read. I do remember when I could not read
but pretended to know how. In the synagogue, which was attached to the
schoolhouse, I would sit on the bench behind the Almemor (bimah).
Holding a small Benshele in my hand, I would pretend to daven. The
synagogue was comparatively small. Yet its high windows reaching to the cealing,
the aron kodesh and the Almemor of finely chiselled stone dreated
a picture of splendor for my childish eyes....
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen der Eisenhandlung E. Stahl (1881 / 1885 / 1899 / 1906)
Anmerkung: Elias (Behr) Stahl ist am 6. März 1847 in Sommerhausen geboren als
Sohn von Lazarus und Mina Stahl. Er war ab etwa 1880 verheiratet mit Babette
geb. Kahn. Die beiden bekamen die Kinder Lazarus, Karl, David und Justin. Elias
Stahl führte als Kaufmann die Eisenhandlung E. Stahl. Er übergab sie 1919 an
seine Söhne Lazarus und Justin. Sein Sohn Karl Stahl war später ein führender
Vertreter der Münchner Kultusgemeinde und des Verbandes Bayerischer
Israelitischer Gemeinden. Elias Stahl starb am 12. September 1925 in
Sommerhausen. Sohn David ist 1918 im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Söhne
Lazarus und Karl wurden nach der Deportation ermordet. Quellen: Biographische
Datenbank Jüdisches Unterfranken.
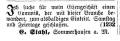 Anzeige
in "Der Israelit" vom 27. April 1881: "Ich suche für mein
Eisengeschäft einen Kommis, der mit dieser Branche bewandert, zum
alsbaldigen Eintritt. Samstag und Feiertage geschlossen Anzeige
in "Der Israelit" vom 27. April 1881: "Ich suche für mein
Eisengeschäft einen Kommis, der mit dieser Branche bewandert, zum
alsbaldigen Eintritt. Samstag und Feiertage geschlossen
E. Stahl, Sommerhausen am Main. " |
| |
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 6. August 1885: "Für mein
Eisengeschäft, Feiertage geschlossen, suche ich einen Kommis mit 1A.
Referenzen, der Branche kundig, welcher möglich schon kleine Reisen besorgt
hat. Anzeige
in "Der Israelit" vom 6. August 1885: "Für mein
Eisengeschäft, Feiertage geschlossen, suche ich einen Kommis mit 1A.
Referenzen, der Branche kundig, welcher möglich schon kleine Reisen besorgt
hat.
E. Stahl, Eisenhandlung
Sommerhausen am Main. " |
| |
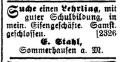 Anzeige
in "Der Israelit" vom 23. März 1899: "Suche einen
Lehrling, mit guter Schulbildung, in meinem Eisengeschäfte. Samstag
geschlossen. Anzeige
in "Der Israelit" vom 23. März 1899: "Suche einen
Lehrling, mit guter Schulbildung, in meinem Eisengeschäfte. Samstag
geschlossen.
E. Stahl, Sommerhausen am Main. " |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juni 1906:
"Für mein Kurz- und Grobeisenwaren-Geschäft (Samstag und
israelitische Feiertage geschlossen) suche ich einen branchekundigen,
jungen Mann als Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juni 1906:
"Für mein Kurz- und Grobeisenwaren-Geschäft (Samstag und
israelitische Feiertage geschlossen) suche ich einen branchekundigen,
jungen Mann als
Kommis, der auch kleinere Touren besorgen kann. Kost und Logis
frei.
Genaue Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen
an
E. Stahl, Eisenhandlung, Sommerhausen am Main bei
Würzburg." |
Anzeige der Weinhandlung von Jacob
Strauss jr. (1884)
Anmerkung: Jakob Strauß ist um 1845 in Sommerhausen geboren. Er war
verheiratet mit Marianne geb. Sondfelder (?). Die Söhne Isidor und Siegfried
(Weinhändler in Sommerhausen und Würzburg) sind in der NS-Zeit umgekommen.
Quelle Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken.
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ein junger angehender
Kommis wird als Weinreisender per 1. April gesucht. Anzeige
in "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ein junger angehender
Kommis wird als Weinreisender per 1. April gesucht.
Samstag und Feiertage streng geschlossen.
Jakob Strauss jr., Sommerhausen am Main." |
J. Blumenfeld auf Stellensuche
(1890)
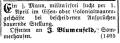 Anzeige
in "Der Israelit" vom 13. März 1890: "Ein junger Mann,
militärfrei sucht per 1. April im Eisen- oder Kolonialwarengeschäfte bei
bescheidenen Ansprüchen dauernde Stellung. Anzeige
in "Der Israelit" vom 13. März 1890: "Ein junger Mann,
militärfrei sucht per 1. April im Eisen- oder Kolonialwarengeschäfte bei
bescheidenen Ansprüchen dauernde Stellung.
Offerten an J. Blumenfeld, Sommerhausen. " |
Anzeige der Weinhandlung /
Weinkelterei David Buchmann (1894)
Anmerkung: David Buchmann war verheiratet mich Maria geb. Lebrecht. Quelle:
Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken.
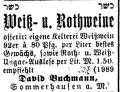 Anzeige
in "Der Israelit" vom 2. April 1894: "Koscher
- Koscher Anzeige
in "Der Israelit" vom 2. April 1894: "Koscher
- Koscher
Weiß- und Rotweine
offeriert eigene Kelterei Weißwein 92er à 80 Pfennig per Liter bestes
Gewächs, sowie Rot- und Weiß-Ungar-Auslese per Liter M. 1.50. Empfiehlt
David Buchmann Sommerhausen am Main " |
Anzeige des Waren- und
Getreidekomissionsgeschäftes Julius Sichel (1896)
Anmerkung: Julius Sichel ist am 22. Juni 1860 in Gemünden geboren als Sohn
von Moses und Esther Sichel. Er heiratete Thekla geb. Palm und lebte mit ihr in
Sommerhausen, wo er ein Kommissionsgeschäft für Getreide und Landesprodukte
führte. Dazu war er als Versicherungsagent und Zigarrenhändler tätig. 1907
verzog er von Sommerhausen und wanderte in die USA aus (New York), wo er 1915
verstarb. Quelle: Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken.
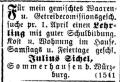 Anzeige
in "Der Israelit" vom 5. März 1896: "Für mein
gemischtes Waren- und Getreidekommissionsgeschäft suche per 1. April einen
Lehrling mit guter Schulbildung. Kost und Wohnung im Hause. Samstags
und Feiertage geschlossen. Anzeige
in "Der Israelit" vom 5. März 1896: "Für mein
gemischtes Waren- und Getreidekommissionsgeschäft suche per 1. April einen
Lehrling mit guter Schulbildung. Kost und Wohnung im Hause. Samstags
und Feiertage geschlossen.
Julius Sichel, Sommerhausen bei Würzburg. " |
E. Stahl sucht zuverlässige Hilfe
für den Haushalt (1920)
Anmerkung: zu Elias Stahl siehe oben.
 Anzeige in "Der Israelit" vom 25. März 1920: "Zur
Führung meines rituellen Haushaltes suche ich eine Anzeige in "Der Israelit" vom 25. März 1920: "Zur
Führung meines rituellen Haushaltes suche ich eine
Zuverlässige Persönlichkeit.
Dienstmädchen vorhanden.
E. Stahl, Sommerhausen bei Würzburg. " |
Kurt Strauß sucht Stelle in einer
Bäckerei (1927)
Anmerkung: Kurt Strauß war ein Sohn des Weinhändlers Max Strauß und seiner
Frau Paula geb. Marx. Er ist am 10. Februar 1910 in Sommerhausen geboren. Ab
1930 arbeitete er wie seine jüngere Schwester Luise im Würzburger Central-Hotel
von Jakob Strauß. Im Juni 1934 ist er nach New York emigriert. 1937 heiratete er
Hetty (Hatty, Henriette) geb. Katz aus Schenklengsfeld. Seine Schwester Luise
wurde nach Auschwitz deportiert und ermordet. Kurt Strauß starb am 20. Februar
1950 in New York. Quelle: Biographische Datenbank Jüdischer Unterfranken.
 Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Februar 1927:
"Israelitischer Bäckergeselle Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Februar 1927:
"Israelitischer Bäckergeselle
18 Jahre, mit gutem Prüfungszeugnis sucht baldigst
Stelle
Kurt Strauß Sommerhausen". |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
zu Personen,
die in Sommerhausen geboren sind |
 |
|
| |
Kennkarte (Dieburg 1939) für Ernestine
Lichtenstein geb. Buchmann (geb. 26. August 1870
in Sommerhausen), wohnhaft in Dieburg
und Frankfurt, am 22. November 1941 deportiert
ab Frankfurt nach Kowno (Kauen), Fort IX, umgekommen. Ernestine war
verheiratet (1893 in Aschaffenburg) mit Baruch Lichtenstein aus
Aschaffenburg. |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Um 1819 wurde
eine Synagoge erbaut; zuvor waren nach Angaben der Gemeindechronik von
Sommerhausen schon zwei frühere Synagogen vorhanden, wovon die ältere 1705
abgebrochen werden musste und erst 1749 durch einen Neubau ersetzt werden
konnte. Im Synagogengebäude befanden sich der Unterrichtsraum für den
Religionsunterricht sowie die Lehrerwohnung (beschrieben bei Mandelbaum, siehe Text).
Durch die zurückgegangene Zahl der jüdischen Einwohner fanden schon seit
1928 keine Gottesdienste mehr in der Synagoge statt. Bereits 1938
wurde das Gebäude als Getreidespeicher verwendet (seit 1941 als Unterkunft für
Arbeiterinnen, später als Möbellager). Die jüdische Gemeinde wurde am 28.
Juli 1938 aufgelöst. Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Synagogengebäude
beschädigt (Fenster eingeschlagen).
Nach 1945 kam das Synagogengebäude in den Besitz der katholischen Kirche
und wurde seit 1953 als Marien-Kirche verwendet. Viele Teile der alten Synagoge sind bis
heute erhalten (Fenster, Eingangstür, Frauenempore, Aaron Hakodesch hinter dem
Altar gut erkennbar). Inzwischen ist das Gebäude profaniert und wurde
2024 von der Katholischen Kirchenstiftung 'St. Nikolaus' Eibelstadt zum
Verkauf angeboten (vgl. Presseartikel unten). Seit 2025 ist das Gebäude in
Privatbesitz und soll auch künftig als Gebetshaus (früherer
Synagogen-/Kirchenbereich) und als Wohnhaus genutzt werden.
Adresse/Standort der Synagoge: Casparigasse 2 (frühere Anschrift
Hetschengasse 100).
Fotos
(Fotos Hans-Werner Büscher, Bad Oeynhausen, Aufnahmedatum 2005)

|

|

|
Die ehemalige Synagoge
von
Sommerhausen |
Seitenansichten |
| |
| |
|
|

|

|

|
| Gedenk- und
Hinweistafel |
|
| |
|
|

|

|

|
Blick zum Bereich
des
früheren Toraschreines
|
Blick in den
ehemaligen
Betsaal
|
Menora
|
| |
|
|
| |
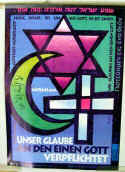
|
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| August 2024:
In der ehemaligen Synagoge findet erstmals seit 90 Jahren wieder ein
jüdisches Gebet statt |
Artikel von Antje Roscoe in der "Main-Post"
vom 22. August 2024: "Sommerhausen. Historischer Moment: Erstes jüdisches
Gebet in Sommerhäuser Synagoge nach über 90 Jahren
Die frühere Synagoge blickt auf eine wechselvolle Geschichte. Derzeit steht
das Gebäude zum Verkauf. Doch es gibt Bestrebungen, das geschichtliche Erbe
zu erhalten.
Jahrzehntelang wurde in der ehemaligen Sommerhäuser Synagoge kein jüdischer
Glaube mehr praktiziert, über 90 Jahre war das letzte Gebet in den
Räumlichkeiten her. Das sollte sich am vergangenen Sonntag ändern. Denn das
jüdische Gemeindezentrum Shalom Europa aus Würzburg nutzte seinen
'Sommerspaziergang' zur Entdeckung der Spuren jüdischen Lebens in
Sommerhausen und kam zum Gebet in der früheren Synagoge zusammen. 'Dass auch
der Rabbiner kommt, um das jüdische Nachmittagsgebet Mincha zu beten',
stufte Claudia Bartel als Organisatorin vor Ort als 'sensationell' ein. Es
gehört zur Krönung ihrer Bemühungen, an die jüdische Kultur und Geschichte
Sommerhausens nicht nur immer wieder zu erinnern, sondern das geschichtliche
Erbe als Bereicherung für das Heute zu verstehen und zu nutzen.
Synagoge soll mehr als nur ein Denkmal sein. Die Synagoge wolle sie
dabei nicht nur als Denkmal verstanden wissen, so Bartel. Dafür stehe sie im
Austausch mit dem jüdischen Gemeindezentrum. Rabbiner Shlomo Zelig Avrasin
dankte 'Claudia Bartel und den Sommerhäusern, die das unterstützten'.
Das Mincha-Gebet nach jüdischem Ritus wurde somit der feierliche,
historische Höhepunkt des Tages. Soweit bekannt, fand in der Synagoge 1928
der letzte jüdische Gottesdienst statt. Die Gemeinde war damals bereits so
klein, dass keine zehn Männer mehr vor Ort waren, welche im Judentum aber
nötig sind, um Gottesdienst feiern zu können. Eine Zahl, die am Sonntag um
ein Vielfaches übertroffen wurde. Bartel hatte auch die Nachbarn aus der
Casparigasse eingeladen. Damit war die Synagoge mit etwa 70 Gästen bis auf
den letzten Platz gefüllt.
Autor Jacobowitz sprach gar von einer Wiedereröffnung. Zu feiern war
Tu B‘Av – im Jüdischen ein sogenannter kleiner Feiertag – der unter anderem
den Beginn der Weinlese markiert und sich im modernen Israel als 'Tag der
Liebe' etabliert, ähnlich dem Valentinstag. Würzburgs Rabbiner, Shlomo Zelig
Avrasin bezog sich aber natürlich auf die den Freudentag begründenden
Überlieferungen aus der jüdischen Geschichte, die die Juden als Volk stärker
geeint hatten. Russisch, Deutsch und Hebräisch – Übersetzer Alexander Schiff
hatte mächtig zu tun. Dies aber wenigstens bei 'sehr guter Akustik'. Die
hatte der Würzburger Konzertsänger Igor Dubovsky der Synagoge bescheinigt,
nachdem er mit seinem seltenen Basso-Profundo spontan drei Lieder
beigetragen hatte. Bei Klez‘ Amore wurden jüdische Lieder wie 'Jerusalem aus
Gold' von Naomi Shemer teils freudig mitgesungen. Autor Alex Jacobowitz, der
für einen Berliner Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte gerade die
Transformation von Synagogen in Deutschland beschreibt, sprach gar von einer
Wiedereröffnung der Synagoge. Zwar sei derzeit nur der Rahmen erhalten, wo
der Thora-Schrein einen festen Platz haben müsste. 'Wisse, vor wem du
stehst' lautet die dort neu angebrachte, hebräische Inschrift aus dem
Talmud. Doch: 'Die Synagoge als ein Ort des Gebets ist mehr an den
Geschehensvorgang und weniger an die Architektur gebunden, wie das bei
christlichen Kirchen der Fall ist', erklärte Jacobowitz. Dennoch: die
bestehende Architektur der Land-Synagoge konnte besichtigt werden – bis hin
zur derzeit aufgeschütteten Mikwe. Die Geschichte dieser ab 1749 bestehenden
Synagoge für die Schutzjuden des Sommerhäuser Grafen erläuterte
Hobby-Historikerin Inge Eilers aus ihren umfangreichen Forschungen der
letzten Jahre. Ihr Fazit: 'Es ist Claudia Bartel zu verdanken, dass wir
unsere Synagoge wieder Synagoge nennen dürfen'.
Gebäude mit einer wechselvollen Geschichte. Das Gebäude blickt dabei
auf eine wechselvolle Geschichte zurück und steht wieder vor einer Wandlung.
Seit 1953 war es die katholische Marien-Kapelle gewesen. Bereits profaniert,
wird sie derzeit von der Katholischen Kirchenstiftung 'St. Nikolaus'
Eibelstadt zum Verkauf angeboten. Wie es dann mit dem Gebäude weitergeht,
liegt unter anderem bei dem neuen Eigentümer. Dass das Haus all die Jahre
unter den mehrheitlich evangelischen Sommerhäusern als 'ehemalige Synagoge'
bekannt geblieben war, sieht Bürgermeister Wilfried Saak als Zeichen für
eine tiefe Verwurzelung der Juden in der Gemeinde. 'Ich habe lange
gebraucht, herauszufinden, wo eigentlich die katholische Kirche ist', so der
einst zugezogene Saak. Geführt von Architekt Friedrich Staib, konnte auch
das sanierungsbedürftige Anwesen der jüdischen Weinhändler-Familie Palm
besichtigt werden, welches eine gemauerte jüdische Laubhütte besitzt.
Außerdem bot das Weingut Wirsching aus Iphofen eine Verkostung von koscherem
Wein an.
Die nächste Gelegenheit zur Besichtigung der Sommerhäuser Synagoge wird es
am Tag des offenen Denkmals, am 8. September, geben".
Link zum Artikel |
| |
| |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern.
Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit A 85. 1988 S. 114. |
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die jüdischen Gemeinden in
Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979 S. 403. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 499-500. |
 | Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen
Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg
1988 S. 53-54. |
 | Hugo Mandelbaum: Jewish Life in the Village
Communities of Southern Germany. Feldheim Publications. Jerusalem 1985.
|
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 236-237. |
 | Flyer: Jüdisches Leben in Sommerhausen - Synagoge
in Sommerhausen. Eingestellt 2025.
Download
möglich (pdf-Datei). |
 | Klaus Wagner: Juden in Winterhausen. Hinweise
auf verschiedene Quellen (hier werden mehrere Juden aus Sommerhausen
genannt): siehe eingestellt
pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Sommerhausen Lower
Franconia. A Jewish community is known from the mid-18th century with a
synagogue and school in the 19th. The Jews numbered 105 in 1816 and 21 in 1933
(total 1,109). Ten emigrated and nine left for other German cities in 1936-41.
Jewish homes were wrecked on Kristallnacht (9-10 November 1938) and the
last two Jews were deported to the Theresienstadt ghetto and Auschwitz,
respectively, in 1942-43.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|