|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Zur Übersicht über die Synagogen
in Unterfranken
Hammelburg (Kreis Bad Kissingen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
 Mittelalter: In Hammelburg
bestand eine der ältesten jüdischen Gemeinden in Unterfranken. Hier lebten Juden
spätestens seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Erster Nachweis für eine jüdische Person aus
Hammelburg ist ein Grabstein aus der Würzburger Pleich. Auf ihm wird der Tod
einer jüdischen Frau aus Hammelburg betrauert, die am 27. Juli 1287 verstorben
war. Die Hammelburger jüdische Gemeinde war von der sog. "Rintfleisch"-Verfolgung 1298
und von weiteren Verfolgungen 1337 sowie bei der Pestzeit-Verfolgung 1349 betroffen. Ein 1347-48 geschriebenes
Gebetbuch aus Hammelburg ("Hammelburger Machsor") befindet sich in der Landesbibliothek in Darmstadt
(Foto links, Quelle
des Fotos). Mittelalter: In Hammelburg
bestand eine der ältesten jüdischen Gemeinden in Unterfranken. Hier lebten Juden
spätestens seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Erster Nachweis für eine jüdische Person aus
Hammelburg ist ein Grabstein aus der Würzburger Pleich. Auf ihm wird der Tod
einer jüdischen Frau aus Hammelburg betrauert, die am 27. Juli 1287 verstorben
war. Die Hammelburger jüdische Gemeinde war von der sog. "Rintfleisch"-Verfolgung 1298
und von weiteren Verfolgungen 1337 sowie bei der Pestzeit-Verfolgung 1349 betroffen. Ein 1347-48 geschriebenes
Gebetbuch aus Hammelburg ("Hammelburger Machsor") befindet sich in der Landesbibliothek in Darmstadt
(Foto links, Quelle
des Fotos).
Nach den Verfolgungen waren seit 1399 wieder Juden in der Stadt. 1451
wurden die Hammelburger Juden gefangen gehalten, bis sie sich für 1.000 Gulden
freigekauft hatten. Die jüdischen Einwohner der Stadt standen (bereits seit
1310) unter dem Schutz des Fürstabt von Fulda. Nach der Ausweisung der Juden
aus dem Bistum Würzburg 1453 konnten sich einige von ihnen in der "fuldischen"
Grenzstadt Hammelburg niederlassen. 1496 werden in der Hammelburger Steuerliste
die Juden Abraham, Isaac, Seligmann, Jakob und Jüdlein genannt. 1570
lebten etwa 100 jüdische Personen in der Stadt. 1576 praktizierte auch ein
jüdischer Arzt ("Jordan Jud") in Hammelburg.
An Einrichtungen
bestanden spätestens seit 1570 eine Synagoge (s.u.), eine Talmudschule
(Leiter u.a. Rabbiner Schlemoh bar Jehuda, der auch in Fürth und Schnaittach
wirkte), beigesetzt 1635 in Pfaffenhausen, spätestens seit 1586 der
jüdische Friedhof in Pfaffenhausen und spätestens seit 1604 eine
Mikwe
(rituelles Bad). 1645 waren 42 jüdische Familien in der Stadt, darunter viele,
die auf Grund der kriegerischen Wirren aus umliegenden Dörfern in die Stadt
geflohen waren. 1671 wurden durch den Fürstabt des Fuldaer Hochstiftes
fast alle Juden ausgewiesen. Ehemalige Hammelburger Juden nahmen in anderen Städten
führende Positionen ein (z.B. Isaak Brilin in Mannheim als Oberrabbiner der
Kurpfalz; andere jüdische Familien zogen u.a. nach Aub).
Neuzeitliche Gemeinde: Seit 1701 konnte wieder eine
Gemeinde in der Stadt entstehen. In diesem Jahr lebten wieder zwei jüdische
Familien in Hammelburg. Im Laufe des 18. Jahrhunderts stieg ihre Zahl langsam
an: 1762 waren es zehn Familien; 1797 wurden 66 jüdische Einwohner gezählt. Um 1800 baute man - vermutlich am
Standort der alten - eine neue Synagoge (s.u.). Unweit der Synagoge lag an der Dalbergstraße die
ehemalige jüdische Schule. Im Anschluss an die Synagoge gab es auch eine Mikwe
(eine frühere Mikwe (um 1604 lag im Bereich des Niedertors).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Hammelburg auf
insgesamt 20 Matrikelstellen (einschließlich Veränderungen bis 1825)
die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und
Erwerbszweig): Mannes Katz (Isaias Samuel Leibnitz (lebt vom Handel und Rest
seines Vermögens), Beretz Feibel Heitzfelder (lebt von seinem Vermögen),
Mannes Nussbaum (Schneidwarenhandel), Hohna David Baumann (Makler), Raphael
David Baumann (Schlachten), Lippmann Jonas Schlesinger (Jahrtuche [=
Garküche?]), Aron Moses Stühler (Schlachten), Hirsch Abraham Hirsch
(Viehhandel), Sußmann Isack Meier (lebt von Interessen [von Zinsen]), Levi
Isack Stiefel (Viehhandel), Abraham Isack Stiefel (Schlachten), Bonum Lippmann
Schlesinger (Kram-, Schneid- und Spezereihandel), Bonum Katz (Kram-, Schneid-
und Spezereihandel), David Meier (Kram-, Schneid- und Spezereihandel), Raphael
Meier (Warenhandel), Jonas Bonum Schlesinger (Warenhandel), Joseph Benjamin
Preiß (Judenvorsinger), Feibel Abraham Hamberger (Schmuser), Israel
Nußbaum (Schneider, seit 1825).
Die Blütezeit der
jüdischen Gemeinde war zwischen etwa 1830 und den 1920er-Jahren. Die Zahl
der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie
folgt: 1837 145 jüdische Einwohner (5,5 % von insgesamt 2.630), 1867 129 (4,7 %
von 2.766), 1880 160 (5,3 % von 3.013, in 36 Familien), 1890 172 (6,0 % von 2.889), 1895 165,
1867 162 (in 36 Familien), 1900 149 (5,2 % von 2.872. in 30 Haushaltungen), 1910 117 (4,0 % von 2.911). Jüdischen
Familien gehörten zahlreiche für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
wichtige Handelsgeschäfte und Gewerbebetriebe.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben in der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der auch als Vorbeter, teilweise auch als Schochet tätig war. Als
Lehrer werden genannt: um 1854 J. Goldschmidt, um 1863/1871 Lehrer Carl Blümlein; 1875 bis 1906 Lehrer Jakob Geßner,
1906-1907 Leopold Freudenberger (zuvor Geroda,
danach in Halle), 1907-1908 Samuel
Gundersheimer (danach in Kleinheubach), um 1924 Lehrer Moses Rosenberger (1932
Ruhestand), ab
1932 Lehrer Karl Adler, ab 1935 Lehrer Hermann Mahlermann. Um 1892/1897
besuchten die Religionsschule der Gemeinde 37 Kinder, um 1903 noch 22 Kinder. Die Gemeinde
gehörte zum Bezirksrabbinat in Bad
Kissingen.
An jüdischen Vereinen gab es: der 1870 gegründete Beerdigungs- und
Wohltätigkeitsverein bzw. Israelitische Bruderschaft Chewra Kadischa (Chevroh
Kadischa; 1928 Vorsitzender: Carl Nußbaum; Zweck und Arbeitsgebiet:
Krankenpflege, Unterstützung Hilfsbedürftiger, Bestattung, 1928 21 Mitglieder),
ein Wohltätigkeitsverein Chewrat gemilus chassodim und ein
Krankenbesuchsverein Bickur Cholim (um 1897 beide unter Leitung von J.
Schuster, 1928 nicht mehr genannt). Zwei Stiftungen - die Bonem Katz'sche
Stiftung und die P. Heizfeld'sche Stiftung - standen 1899 unter Vorsitz von B.
Stühler (1928 nicht mehr genannt, vermutlich der Inflation zum Opfer gefallen).
1928 wird die 1900 gegründete "Armenkasse der Israelitischen Kultusgemeinde"
genannt, die sich der Wanderfürsorge annahm (1928 19 Mitglieder).
Gemeindevorsteher waren unter anderem: um 1890 E. Rosenberger, um 1897 S.
Sichel, um 1899 B. Stühler, B. Hanauer und A. Hamburger, um 1907/08 B. Stühler.
Im Ersten Weltkrieg kämpften 23 Männer aus der jüdischen Gemeinde an
den Fronten. Von ihnen sind gefallen: Heinrich Oppenheimer (gef. 15.7.1890 in
Hammelburg, gef. 5.10.1915), Unteroffizier Berthold Baumann (geb. 20.10.1880 in
Höllrich, gef. 12.4.1916) und
Ludwig Straus (Strauß, geb. 19.4.1894 in Hammelburg, gef. 23.9.1916). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten
Weltkrieges auf der rechten Seite des Rathauses auf dem Marktplatz in ca. 2 m
Höhe (unter einer Skulptur des St. Georg). Weiter ist gefallen: Hugo Ullmann
(geb. 30.1.1894 in Hammelburg, vor 1914 in Fürth wohnhaft, gef. 20.3.1916).
Um 1924, als 112 jüdische Einwohner gezählt wurden (3,73 % von etwa
3.000; 1925 noch 98 jüdische Einwohner), waren die Vorsteher der Gemeinde August Stühler, Nathan Stern,
Siegfried Schuster, Max Hamburger, Adolf Stühler, Martell Nußbaum und Arnold
Stühler. Als Religionslehrer, Kantor und Schochet war Moses Rosenberger
angestellt (auch 1928). Er erteilte damals sieben Kindern den Religionsunterricht. Auch in
umliegenden kleineren Gemeinden hat er den Unterricht erteilt (z.B. in Völkersleier).
Zu
Wohlfahrtszwecken gab es die "Vereinigten Stiftungen für Ortsarme".
1928 war Gemeindevorsteher Carl Nußbaum (Kissinger Str. 231-234). 1932
wird als Lehrer Karl Adler genannt.
1933 lebten noch 79 jüdische
Personen in der Stadt. Auf Grund der zunehmenden Entrechtung, der Repressalien
und den Auswirkungen der wirtschaftlichen Boykotts verließen in den folgenden
Jahren die meisten von ihnen die Stadt oder wanderten aus. Am 9. November 1938
lebten noch 15 jüdische Personen in der Stadt. Beim Novemberpogrom 1938, der in Hammelburg am 10. November 1938 stattfand, wurden die Geschäfte, Häuser und Wohnungen der noch am Ort wohnenden jüdischen Familien Stühler, Baumann/Sichel, Strauß, Stern/Mantel, Frank und Adler sowie die jüdische Religionsschule in der Dalbergstraße 57 von Männern des SA-Sturms, des NSKK Hammelburg und von auswärtigen Schlägern des SA-Sturms Bad Kissingen barbarisch demoliert.
Die gewalttätigen Ausschreitungen begannen am Morgen des 10. November 1938 kurz nach 7.30 Uhr unter Leitung des 26-jährigen Hammelburger SA-Sturmführers Karl Hartmann. Um 9 Uhr versammelten sich die Pogromschläger im Hof der Synagoge, die im Innenraum kontrolliert angezündet, geschwärzt und ausgerußt wurde. Am Morgen des 11. November 1938 zerschlugen Männer des SA-Sturms Hammelburg und der HJ Untererthal die angebrannte Inneneinrichtung der Synagoge mit Äxten und Beilen.
Quellennachweis: Berichte von jüdischen und nichtjüdischen Augen- und Zeitzeugen; Spruchkammer Hammelburg, Akten von Männern der SA und des NSKK Hammelburg, Staatsarchiv Würzburg.
Von den in Hammelburg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bruno
Adler (1906), Pauline Adler (geb. ?), Fanny
Baumann geb. Sichel (1887), Franziska Baumann (1913), Hermann Capell (1923),
Hilde Flörsheim geb. Hamburger (1891), Selma Flörsheim geb. Stiefel (1887), Abraham Frank (1861), Betti Frank
(1896), Fränze
(Franziska) Frank geb. Opoenheimer (1897), Mali Frank geb. Strauss (1871), Siegfried
Frank (1892), Klara Hamburger geb. Katz (1884), Klara
Kallmann geb. Nussbaum (1873), Auguste Katz geb. Bergen (1877), Dora Katz (1902),
Feodora Katz (1902), Manfred Leven (1893), Otto Mayer (1868), Hermann Nussbaum (1891),
Adolf Oppenheimer (1878), Rosa Rosskopf geb. Stiefel (1898), Rosa Rotschild geb.
Nussbaum (1874), Ella Steinkritzer geb. Strauss (1897),
Klaus Steinkritzer (1929), Margot Steinkritzer (1926), Rosa Stern geb. Sichel (1878), Benjamin (Benno) Strauss (1937),
Gustav Strauss (1892), Hanna (Hannchen)
Strauss-Spier geb. Katz (1896), Julius Strauss (1875), Nestor Straus (1880), Dr. Albert Stühler (1884), Moritz Stühler (geb.
?), Minni (Wilhelmine) Süskind geb. Stern (1886), Erna Ullmann (1896).
Anmerkung: der unter den Umgekommenen der NS-Zeit in einigen Listen genannte
Max Hamburger (1881) hat nach Recherchen von Petra Kaup-Clement mit seiner
Familie überlebt und ist nach New York emigriert. Er wohnte bis 1937 in
Hammelburg in der Bahnhofstraße 10 und war als Viehhändler
tätig. Von ihm liegt ein Brief vor, den er 1946 von New York aus "an seine
Freunde und Nachbarn in Hammelburg" geschrieben hat (Quelle: Spruchkammer
Hammelburg, Staatsarchiv Würzburg).
Auch die in einigen Listen genannte Betty Adler (1904) hat die Zeit im KZ überlebt und wohnte 1946 in
Würzburg in der Valentin-Becker-Straße 18 (Hinweis Petra Kaup-Clement, vgl.
Binder/Mence s.Lit. S. 257 und 270 [Brief von Betty Adler vom 5.5.1946]).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen
Gemeinde
Zur jüdischen Geschichte im Saaletal
Beitrag von Lehrer Julius Straus in Westheim:
"Streifzüge durch das fränkische Saaletal" in: Bayerische
Israelitische Gemeindezeitung vom 10. September 1925 und vom 3. Dezember 1925:
 Artikel in
der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 10. September
1925: "Streifzüge durch das fränkische Saaletal. Eine
kulturhistorische Plauderei von Julius Straus, Volksschullehrer in Westheim. Artikel in
der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 10. September
1925: "Streifzüge durch das fränkische Saaletal. Eine
kulturhistorische Plauderei von Julius Straus, Volksschullehrer in Westheim.
Die neue Saaletal-Bahn nach
Bad Kissingen erschließt eine
reizende Gegend dem allgemeinen Verkehr. Man kommt vorüber an
bescheidenen Dörfchen, alten Stadtmauern und Trümmern, durch herrliche Wälder,
üppige Wiesen und gesegnete Ackerfluren. Von den letzten Höhenzügen der
Rhön, die der fränkischen Saale gar oft den Weg streitig machen, grüßen
Schlösser, Burgen und Burgruinen. Da türmt sich hoch auf der Sodenberg,
ehemals ein Vulkan, der aber längst erloschen ist. Dafür duftet in
seinem Walde der Waldmeister. Wie einst im Mai, wo der junge Ritter Götz
von Berlichingen bei seinen Verwandten auf der Sodenburg weilte. Vom
stolzen Schloss Saaleck aus überschauten einst die Fuldaer Fürstäbte
ihr kleines Reich. Mühselig arbeiteten unten die kleinen Bauern,
kletterten die Winzer die sonnenbeschienenen Hänge ihrer Weinberge empor.
Mühselig geduckt schleppte auf der Landstraße der fuldaische Schutzjude
sein Warenbündel ins nächste Dorf. Sein faltenreiches Gesicht zeigt bekümmerte
Gedanken. Warum auch nicht? Hatten doch vor wenigen Wochen erst wieder, im
Januar 1582, die Räte der Städte Hammelburg, Brückenau,
Fulda und
Geisa
den Fürstabt 'um Abschaffung der Juden oft untertänig und
hochflehentlich' gebeten. Hatten die Dränger dieses Mal Erfolg, wo der
Fürst im Roten Schloss zu Hammelburg weilte und sie ihr Gesuch erneut
vorbringen wollten? … Wehmütig tönt in solchen Zeiten der Kümmernis
das Flehen aus der alten dumpfen Synagoge: Schaumer
Jisroel (hebräisch für Hüter Israel)! Hüter Israels, behüte den
Rest von Israel, lass nicht untergehen Israel, das da rufet: Schma
Jisroel!...
Der Traum zerrinnt. Die Fürstäbte von Fulda ruhen in ihrer Gruft. In
manchem Hammelburger Gebäude ist noch ihr Wappen. Wir gehen in die
Judengasse, sie lässt nur noch ahnen, so das Villenviertel der Vorfahren
gestanden. Der Zug führt uns weiter und bald grüßt die Ruine
Trimberg.
Wie ein stummer Beschützer blickt sie hinab auf das kleine Dörfchen
Trimberg, das sich am Hand hinaufzieht. Anspruchslose Häuschen,
eingebettet im sommerlichen Grün der Sträucher und Blumen; ihr Schatten
schwebt im silberglänzenden Wasser der vorüberziehenden Saale. Ein Bild
für Maler. Vor unseren Augen aber träumt langsam ein längst
entschwundenes Bild herauf; aus dem frühen Mittelalter, damals als Walter
von der Vogelweide seine unsterblichen Lieder sang. Ein strahlender
Sommermorgen. Blauer Himmel, Sonnenschein. Der Wiesengrund ein
Blumengarten. Das Dorf wie ausgestorben. Sonntag ist's. Langsam stapft
der Dorfwächter durch die hügelige Gasse und wenn er zuweilen, bedächtig
umherschauend, stehen bleibt, und den wuchtigen Spieß auf den Boden aufstößt,
dann schrecken genäschige Stare von den Johannisbeeren auf, springt ein
Kettenhund mit heiserem Bellen aus seiner Hütte. Auf der Wiese spielen jüdische
Kinder, schwarzlockige und blonde. Die Buben haben ein neues Spiel
gelernt. Sie werfen |
 flache
Steine dicht übers Wasser hin. Wie Schwälbchen tauchen die Steinchen ein
wenig ein, kommen wieder heraus, auf ab, auf ab, so machen sie tänzelnd
immer kleinere Schritte, um endlich leise glucksend zu versinken. Ein schöner
blonder Knabe hat keine Augen für das Spiel. Er hat die Hände unter den
Kopf geschoben, so liegt er im Grase und träumt. Ein leiser Wind trägt
von irgendwo Glockenklang herüber. Ein Kuckuck ruft, Schwarzamseln flöten,
und eine Lerche jubelt hoch über der Trimburg. Dort hinauf fliegen die Träume
des jungen Süßkind. Gestern war er wieder oben gewesen mit dem Vater,
der weit und breit alle heilsamen Kräutlein kannte und aus ihnen oft dem
alten Grafen einen Tee bereiten musste. Und weil davon seit Tagen die quälenden
Schmerzen nachgelassen haben, war der alte Burgherr so gnädiger Laune wie
schon lange nicht. Verschwunden war das scheußliche Reißen in den
Gliedern. Er konnte wieder zu Pferde steigen und ins Jagdrevier. Ein
fahrender Sänger war auch soeben angekommen. Hell auf leuchteten dem
Knaben die Augen, als der Graf ihm auf die Schulter klopfte und meint:
'Süßkind, du darfst hier bleiben und zuhören; ich weiß ja, dass du
dies gerne tust. Und… 'Süßkind
dichtet wieder,' schreien die Kinder. 'Wollt ihr euch heimscheren, ihr
Schreihälse', drohte der Wächter mit dem hochgehaltenen Spieß und wie
der Wind ist die Kinderschar zerstoben… Der kleine Träumer Süßkind
wurde ein Dichter. Hier in seiner Heimat Trimberg war um das Jahr 1200
eine kleine jüdische Gemeinde, von der keinerlei Erinnerung mehr
vorhanden ist. Der Dichter hat ihren Namen unsterblich gemacht. Rühmend
wird er in der Burgchronik genannt, er, der in schönstem Deutsch spricht
zu einer Zeit, wo die Judenschaft abgeschlossen von der Umwelt lebte und
entweder die hebräische Sprache oder ein Gemisch von Jüdisch-Deutsch
redete. Dass der
Nachtrag zur Heidelberger Handschrift (Universität Heidelberg) die Lieder
eines einzigen jüdische Minnesängers aufbewahrt, nämlich Süßkinds, zeigt
immerhin eine Wertschätzung, wie man sie sonst in jener Zeit der Kreuzzüge
für Juden nicht hegte. War es doch in jenen schlimmen Tagen, wo man die
Juden verfolgte, verachtete und ihnen oft nur die Wahl ließ zwischen Abfall
vom Glauben oder Tod. Für den Juden Süßkind war es kein geringes Wagnis, in
der Kleidung des höfischen Sängers von Burg zu Burg zu wandern und seine
neuen Lieder zu singen. Denn wo andere, mochte ihr Sang auch zuweilen seicht
und gedankenlos sein, beim Burgherrn williges Ohr, offene Hand und
gastfreies Hand fanden, da musste der jüdische Minnesänger nicht selten
statt dessen Hohn, Spott und Abweisung erdulden, sodass er tief entmutigt
zuletzt gesungen haben mag: ' flache
Steine dicht übers Wasser hin. Wie Schwälbchen tauchen die Steinchen ein
wenig ein, kommen wieder heraus, auf ab, auf ab, so machen sie tänzelnd
immer kleinere Schritte, um endlich leise glucksend zu versinken. Ein schöner
blonder Knabe hat keine Augen für das Spiel. Er hat die Hände unter den
Kopf geschoben, so liegt er im Grase und träumt. Ein leiser Wind trägt
von irgendwo Glockenklang herüber. Ein Kuckuck ruft, Schwarzamseln flöten,
und eine Lerche jubelt hoch über der Trimburg. Dort hinauf fliegen die Träume
des jungen Süßkind. Gestern war er wieder oben gewesen mit dem Vater,
der weit und breit alle heilsamen Kräutlein kannte und aus ihnen oft dem
alten Grafen einen Tee bereiten musste. Und weil davon seit Tagen die quälenden
Schmerzen nachgelassen haben, war der alte Burgherr so gnädiger Laune wie
schon lange nicht. Verschwunden war das scheußliche Reißen in den
Gliedern. Er konnte wieder zu Pferde steigen und ins Jagdrevier. Ein
fahrender Sänger war auch soeben angekommen. Hell auf leuchteten dem
Knaben die Augen, als der Graf ihm auf die Schulter klopfte und meint:
'Süßkind, du darfst hier bleiben und zuhören; ich weiß ja, dass du
dies gerne tust. Und… 'Süßkind
dichtet wieder,' schreien die Kinder. 'Wollt ihr euch heimscheren, ihr
Schreihälse', drohte der Wächter mit dem hochgehaltenen Spieß und wie
der Wind ist die Kinderschar zerstoben… Der kleine Träumer Süßkind
wurde ein Dichter. Hier in seiner Heimat Trimberg war um das Jahr 1200
eine kleine jüdische Gemeinde, von der keinerlei Erinnerung mehr
vorhanden ist. Der Dichter hat ihren Namen unsterblich gemacht. Rühmend
wird er in der Burgchronik genannt, er, der in schönstem Deutsch spricht
zu einer Zeit, wo die Judenschaft abgeschlossen von der Umwelt lebte und
entweder die hebräische Sprache oder ein Gemisch von Jüdisch-Deutsch
redete. Dass der
Nachtrag zur Heidelberger Handschrift (Universität Heidelberg) die Lieder
eines einzigen jüdische Minnesängers aufbewahrt, nämlich Süßkinds, zeigt
immerhin eine Wertschätzung, wie man sie sonst in jener Zeit der Kreuzzüge
für Juden nicht hegte. War es doch in jenen schlimmen Tagen, wo man die
Juden verfolgte, verachtete und ihnen oft nur die Wahl ließ zwischen Abfall
vom Glauben oder Tod. Für den Juden Süßkind war es kein geringes Wagnis, in
der Kleidung des höfischen Sängers von Burg zu Burg zu wandern und seine
neuen Lieder zu singen. Denn wo andere, mochte ihr Sang auch zuweilen seicht
und gedankenlos sein, beim Burgherrn williges Ohr, offene Hand und
gastfreies Hand fanden, da musste der jüdische Minnesänger nicht selten
statt dessen Hohn, Spott und Abweisung erdulden, sodass er tief entmutigt
zuletzt gesungen haben mag: '
Ich habe zwar mit
meiner Kunst
Geworben um der Herren Gunst
Die Herren doch wollen mir nichts geben.
So will ich ihren Hof denn
fliehn
Von nun an als alter
Jude leben
Und also vorwärts
weiter ziehn.
Mir wachsen
lassen einen Bart
Lang
niederwallend, greisbehaart
Will
einen langen Mantel tragen
Den
hohen Hut tief in den Kragen
Demütig
sei von nun mein Gang
Nur
karg ertöne Hochgesang,
Weil
mich die Herren vom Hofe jagen!
(Anmerkung:
Die Übertragung ins Hochdeutsche ist entnommen aus Müllers 'Jüdische
Geschichte in Charakterbildern).
So sah er denn ein, dass die Anpassung oder Assimilation wie wir es
heute nennen, ihm nicht hilft, dass der Juden nur dann sich behaupten
kann, wenn er sein Judentum aufrecht bewahrt. – Seiner Zeit weit voraus
eilte der Dichter, wenn er in seinem Liede von der Gedankenfreiheit singt:
Gedanken, niemand kann verwehren, nicht Toren und nicht den Weisen,
Drum sind auch Gedanken frei auf allerhand Sachen,
Herz und Sinn, die sind gegeben allen Menschen zum Behagen
Gedanken schlüpfen durch jeden Stein, durch Stahl und durch Eisen.
Kannte Walther von der Vogelweide seinen jüdischen Zeitgenossen?
Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls lebten beide fast zu gleich Zeit, im
gleichen Ort Würzburg, und auch ihr Tod liegt nicht allzu weit
voneinander. Süßkind starb als Arzt in Würzburg. Sein Grab ist
verschollen, genau wie das alte Judenviertel und der alte Judenfriedhof;
an deren Stelle heute Juliusspital und Marienkapelle am Würzburger Grünen
Markt stehen. Nicht erinnert
mehr in Trimberg an des Dichters Geburtshaus und an die jüdische
Gemeinde. Vermutlich ereilte sie im Jahre 1298 das Schicksal. Jenesmal kam
in fränkischen Landen die schauerliche Mär auf, Juden hätten eine
Hostie zerstoßen und Blut sei aus ihr geflossen. Der aufgepeitschte
Religionshass gab dem Ritter Rindfleisch willkommene Gelegenheit, mit
verhetzten Pöbelhaufen über die wehrlosen Juden herzufallen. Die Friedhöfe
füllten sich mit Tausenden von Ermordeten. Die fränkischen Gemeinden
gingen fast alle unter.
Neue Gemeinden bildeten sich im Saaletal. So in Westheim, wo neben dem
heute noch vorhandenen Freihofe der Grafen von Erthal ein Judenhof erstand
mit kleinen armseligen Häuschen, die oft vom Hochwasser bedroht waren.
Dann waren die Juden auch ohne die eiserne Sperrkette am Eingang des
Judenhofes von der Außenwelt abgeschnitten. Eine starke Mauer bildete den
Abschluss gegen den Saalefluss, der unmittelbar daran vorüberfließt.
Durch diese führen ein Durchbruch und einige Steinstufen an das Wasser.
Hier herrschte vor Pessach ein reges Treiben, ein Putzen und Bürsten,
Waschen und Scheuern. Und wie in alter Zeit verrichtete die Gemeinde noch
heute am Rosch-Haschonoh das Taschlichgebet an dieser Treppe.
Im Laufe des 18. Jahrhundert wurde der Judenhof zu eng. Wohlhabende
Familien errichteten sich in der Judengasse behäbige Häuser in fränkischem
Stil. Oft führen hohe Treppen hinauf; ihr festungsartiges Aussehen lässt
fast den Gedanken aufkommen, wie wenn sie als Verteidigungswerke gedacht
waren. Stolz schmückte der eine und andere sein Haus mit hebräischen
Inschriften. So prangt noch jetzt über einem steinernen Hauseingang der
Wunsch: Masel Tov d.h. Viel Glück und Segen! Und an der Hausecke des
gleichen Gebäudes ist die Jahreszahl, die das Baujahr 1760 verrät,
sichtbar. Unverwüstlich. Als dieses Haus vor einigen Jahren in
christliche Hände überging, hatten die Kinder des neuen Besitzers nichts
Eiligeres zu tun, als den Glückwunsch und die hebräische Jahreszahl mit
Mörtel zu überschmieren. Der Mörtel ist längst wieder abgefallen, die
Inschrift wieder zum Vorschrein gekommen. Seitdem der Besitzer darauf
aufmerksam gemacht wurde, dass dieser Glückwunsch, wenn er auch hebräisch
ist, auch für ihn gilt, lässt er ihn – nicht mehr überschmieren.
Unter dem Protektorate der Erthaler Freiherren wurde 1769 in Westheim
eine
neue Synagoge errichtet, deren heilige Lade ein Schmuckkästchen ist. |
 Im
Verlaufe des 30jährigen Krieges verließen die meisten Juden von Westheim,
Untererthal usw. ihre Dörfchen, um sich in die kleinen Städte
zu begeben, wo sie doch etwas mehr Schutz fanden. So vergrößerte sich
die ursprünglich kleine Gemeinde Hammelburg zusehends. Sie bestand jedoch
bereits seit 1400, sodass sie auf ein fünfhundertjähriges Bestehen zurückblicken
kann. Im Juni 1399 gestattet der Fürstabt Johann von Fulda den Familien
Abraham, Kophelin und Vivelmann (Feibelmann), sich je nach Belieben im
Stiftslande oder in den Städten Fulda,
Vacha und Homburg niederzulassen.
Sie durften Geld auf Zinsen verleihen und zwar konnten sie von Fuldaer
Staatsangehörigen für jeden Gulden die Woche 4 Pfennig verlangen (gleich
zwei Groschen), von 'Ausländern' aber mehr. Grundbesitz und Handwerk
war ihnen verboten. Hatte man sie nun so von Staatswegen zu Handel und
Geldgeschäft herangezüchtet und zum Wucher genötigt, so blieb der Hass
der Schuldner nicht aus. Wiederholt (z.B. 1570, 1582 und 1615) und nachdrücklich
forderten die Räte der Städte Hammelburg,
Brückenau und
Geisa die
'Abschaffung der Juden'. Endlich im Jahre 1671 waren die fortdauernden
Wühlereien von Erfolg gekrönt, Fürstabt Bernhard Gustav verordnete die
Ausweisung sämtlicher Juden aus Dorf und Stadt binnen dreier Monate. Ein
Ziegelbrenner in Untererthal, der anscheinend durch die Austreibung seiner
Schulden ledig wurde, fand dieses Ereignis so erfreulich, dass er in eine
Ziegel einbrannte: 'Diese Ziegel ist gemacht in diesem Jahr, da der Juden ihr Auszug war. 1671.' (Anmerkung: Die Angaben über Untererthal entnahm ich dem lesenswerten Buch von Ullrich: Untererthal,
Eine kulturhistorische Studie). Dass
die Judenschaft Westheims auch auswandern musste, erscheint zweifelhaft.
Vielleicht kam ihr der Umstand zustatten, dass mitten durch dieses Dörfchen
die Grenze zog zwischen den beiden 'Großmächten' Fulda und Würzburg.
Die ganze blühende Gemeinde Hammelburg jedoch wurde von der Austreibung
betroffen; ebenso die Untererthaler Judenschaft. Mühselig geduckt
schleppten nun die heimatlos gewordenen fuldaischen Schutzjuden ihre
tragbaren Habseligkeiten fort. Die Glücklicheren unter den Unglücklichen
bargen Hab und Gut in alten gebrechlichen Wagen, die mit einem Zelttuch überspannt
waren und langsam die Straße dahin krochen, weil eben das magere
Pferdchen nicht schneller konnte. Manches Schimpfwort, mancher Steinwurf
aus dem Hinterhalt ließ Kinder und Greise unter dem Zeltbahn erschreckt
aufschreien. Die meisten Christen indes hatten sich den menschlichen Sinn
bewahrt und wollten von Rohheiten nichts wissen. Juden und Christen hatten
im Allgemeinen ganz gut miteinander gelebt, wenn auch manches Missverständnis
auf beiden Seiten noch herrschte. Doch das Volk hatte damals – nichts zu
sagen. Und so zerstreute sich denn die Hammelburger Judengemeinde nach
allen Gegenden. Am Kreuzweg aber, bevor die einen ins Würzburger Land,
die andern ins Mainzer und Pfälzer Land sich wandten, entstieg einem
kleinen Wagen der ehrwürdige Rabbiner Isak Brilin. Viele Jahre hatte er
in Hammelburg segensreich gewirkt und nun war seine Gemeinde vernichtet.
Es galt zu scheiden von den lieb gewonnenen Freunden. Herzzerreißend war
der Abschied vom Rabbi, der allen ein Vater gewesen war… Rabbi Isak, der
ein Sohn des Fuldaer Rabbiners Meschullam Elieser Sußmann Brilin war,
schlug den Weg ins Rheintal ein. Dorf in Worms oder Mannheim, wo er schon
früher gewirkt, wollte er sich eine neue Heimat suchen. Überall erzählte
man ihm, dass der edle Pfälzer Kurfürst Karl Ludwig allen seinen
Untertanen, Christen und Juden, ein gütiger Landesvater war. Das war der
gleiche Fürst, der auch den berühmt gewordenen holländischen
Philosophen, den Juden Baruch Spinoza zu sich berufen wollte. Spinoza aber
lehnte die angebotene Stelle als Professor an der Heidelberger Universität
ab. Der hochgesinnte Kurfürst erkannte bald die Weisheit und Weltklugheit
des Hammelburger Rabbiners, er ließ in darum oft an seinen Hof kommen und
fand solchen Gefallen an ihm, dass Brilin von da ab in höchster Gunst
stand. Die Mannheimer Gemeinde hatte nicht zu bereuen, dass sie ihn zu
ihrem Rabbiner wählte. Doch schon 1678 stirbt er. Einige Wochen vor ihm
war sein Freund, Rabbi Elchanan bar Chaim, dahingeschieden, der ebenfalls
aus Hammelburg vertrieben, im gastlichen Mannheim Unterkommen gefunden
hatte. Das dortige Memorbuch sagt von ihm, dass er die Tora in Israel
vermehrt und viele Schüler aufgestellt habe. Im
Verlaufe des 30jährigen Krieges verließen die meisten Juden von Westheim,
Untererthal usw. ihre Dörfchen, um sich in die kleinen Städte
zu begeben, wo sie doch etwas mehr Schutz fanden. So vergrößerte sich
die ursprünglich kleine Gemeinde Hammelburg zusehends. Sie bestand jedoch
bereits seit 1400, sodass sie auf ein fünfhundertjähriges Bestehen zurückblicken
kann. Im Juni 1399 gestattet der Fürstabt Johann von Fulda den Familien
Abraham, Kophelin und Vivelmann (Feibelmann), sich je nach Belieben im
Stiftslande oder in den Städten Fulda,
Vacha und Homburg niederzulassen.
Sie durften Geld auf Zinsen verleihen und zwar konnten sie von Fuldaer
Staatsangehörigen für jeden Gulden die Woche 4 Pfennig verlangen (gleich
zwei Groschen), von 'Ausländern' aber mehr. Grundbesitz und Handwerk
war ihnen verboten. Hatte man sie nun so von Staatswegen zu Handel und
Geldgeschäft herangezüchtet und zum Wucher genötigt, so blieb der Hass
der Schuldner nicht aus. Wiederholt (z.B. 1570, 1582 und 1615) und nachdrücklich
forderten die Räte der Städte Hammelburg,
Brückenau und
Geisa die
'Abschaffung der Juden'. Endlich im Jahre 1671 waren die fortdauernden
Wühlereien von Erfolg gekrönt, Fürstabt Bernhard Gustav verordnete die
Ausweisung sämtlicher Juden aus Dorf und Stadt binnen dreier Monate. Ein
Ziegelbrenner in Untererthal, der anscheinend durch die Austreibung seiner
Schulden ledig wurde, fand dieses Ereignis so erfreulich, dass er in eine
Ziegel einbrannte: 'Diese Ziegel ist gemacht in diesem Jahr, da der Juden ihr Auszug war. 1671.' (Anmerkung: Die Angaben über Untererthal entnahm ich dem lesenswerten Buch von Ullrich: Untererthal,
Eine kulturhistorische Studie). Dass
die Judenschaft Westheims auch auswandern musste, erscheint zweifelhaft.
Vielleicht kam ihr der Umstand zustatten, dass mitten durch dieses Dörfchen
die Grenze zog zwischen den beiden 'Großmächten' Fulda und Würzburg.
Die ganze blühende Gemeinde Hammelburg jedoch wurde von der Austreibung
betroffen; ebenso die Untererthaler Judenschaft. Mühselig geduckt
schleppten nun die heimatlos gewordenen fuldaischen Schutzjuden ihre
tragbaren Habseligkeiten fort. Die Glücklicheren unter den Unglücklichen
bargen Hab und Gut in alten gebrechlichen Wagen, die mit einem Zelttuch überspannt
waren und langsam die Straße dahin krochen, weil eben das magere
Pferdchen nicht schneller konnte. Manches Schimpfwort, mancher Steinwurf
aus dem Hinterhalt ließ Kinder und Greise unter dem Zeltbahn erschreckt
aufschreien. Die meisten Christen indes hatten sich den menschlichen Sinn
bewahrt und wollten von Rohheiten nichts wissen. Juden und Christen hatten
im Allgemeinen ganz gut miteinander gelebt, wenn auch manches Missverständnis
auf beiden Seiten noch herrschte. Doch das Volk hatte damals – nichts zu
sagen. Und so zerstreute sich denn die Hammelburger Judengemeinde nach
allen Gegenden. Am Kreuzweg aber, bevor die einen ins Würzburger Land,
die andern ins Mainzer und Pfälzer Land sich wandten, entstieg einem
kleinen Wagen der ehrwürdige Rabbiner Isak Brilin. Viele Jahre hatte er
in Hammelburg segensreich gewirkt und nun war seine Gemeinde vernichtet.
Es galt zu scheiden von den lieb gewonnenen Freunden. Herzzerreißend war
der Abschied vom Rabbi, der allen ein Vater gewesen war… Rabbi Isak, der
ein Sohn des Fuldaer Rabbiners Meschullam Elieser Sußmann Brilin war,
schlug den Weg ins Rheintal ein. Dorf in Worms oder Mannheim, wo er schon
früher gewirkt, wollte er sich eine neue Heimat suchen. Überall erzählte
man ihm, dass der edle Pfälzer Kurfürst Karl Ludwig allen seinen
Untertanen, Christen und Juden, ein gütiger Landesvater war. Das war der
gleiche Fürst, der auch den berühmt gewordenen holländischen
Philosophen, den Juden Baruch Spinoza zu sich berufen wollte. Spinoza aber
lehnte die angebotene Stelle als Professor an der Heidelberger Universität
ab. Der hochgesinnte Kurfürst erkannte bald die Weisheit und Weltklugheit
des Hammelburger Rabbiners, er ließ in darum oft an seinen Hof kommen und
fand solchen Gefallen an ihm, dass Brilin von da ab in höchster Gunst
stand. Die Mannheimer Gemeinde hatte nicht zu bereuen, dass sie ihn zu
ihrem Rabbiner wählte. Doch schon 1678 stirbt er. Einige Wochen vor ihm
war sein Freund, Rabbi Elchanan bar Chaim, dahingeschieden, der ebenfalls
aus Hammelburg vertrieben, im gastlichen Mannheim Unterkommen gefunden
hatte. Das dortige Memorbuch sagt von ihm, dass er die Tora in Israel
vermehrt und viele Schüler aufgestellt habe.
Nicht lange konnte man im Fuldaer Land die Steuerquelle der Schutzjuden
entbehren. Auch in der judenreinen Zeit waren die Verhältnisse der Bevölkerung
nicht besser geworden. Schon 1678 ließ man wieder Juden herein.
Paradiesisch ging es ihnen auch jetzt nicht. Das mussten die Untererthaler
Juden erfahren, die sich mit Genehmigung des Freiherrn von Erthal eine ‚Judenschul
aus Holz' gebaut hatten (1737). Der Fürstabt von Fulda war es nicht
ganz zufrieden und es kam zu Unterhandlungen. Bevor diese zu Ende waren,
machte der Oberamtmann von Hammelburg kurzen Prozess. Er schickte seine
Heeresmacht, einen Hauptmann und zwanzig Gemeine der Landpolizei ab, die
in den Burgplatz eingefallen und sotanes Bäulein gewaltsamer Weis auf den
Grund niedergerissen haben.' Die Untererthaler mussten wieder in einer
engen Stube 'Synagoge halten'. Die
Französische Revolution führte die Armee des Generals Jourdan ins
Saaletal. Zahlreiche Quartierzettel und Verzeichnisse geben noch heute
davon Kunde, welche Lasten, Beschwernisse und Lieferungen Christen und
Juden in dem unruhevollen Jahre 1796 zu tragen hatten. Aber auch von den
darauf folgenden Jahren existieren noch zahlreiche Quartierzettel. War die
eine Truppe fordert, so forderte eine frisch eingetroffene Abteilung
wieder neue Leistungen. Noch viele Jahre nach dem Paris Frieden musste der
'Vorgänger' (Vorstand) für die Westheimer Judenschaft prozessieren,
damit diese die vielen hundert Gulden Quartierlasten wieder aus der französischen
Kriegsentschädigung bekam. (Reparationen möchte man es fast nennen.)
Als General Jourdan, bei Würzburg besiegt, sich zurückziehen musste, wälzten
sich die geschlagenen Scharen wiederum durch das Saaletal. Allenthalben
fielen die erbitterten Bauern über kleine französische Scharen her. So
auch die Untererthaler Bauern, die einen französischen Major in der
Thulba ertränkten. Das hatten sie bitter zu bereuen. Kaum erfuhr Jourdan,
der mit dem Hauptheer nahte, von dem Überfall, so befahl der den Angriff.
Zahlreiche Bauern fanden im nutzlosen Kampf den Tod und nun sollte auch
das Dorf noch niedergebrannt werden. Ein Untererthaler Jude ging dem
General Jourdan entgegen und bat um Schonung für den Ort. Umsonst. Bald
prasselten an allen Ecken und Enden die Flammen empor. Auch die Stammburg
der Grafen fiel in Schutt und Asche. Der letzte Erthaler, der kinderlose
Kurmainzer Kammerherr Franz Lothar vermachte den öden Burgplatz
unentgeltlich an die Judengemeinde. Für 450 Gulden wollte er auf dem
Platz eine Synagoge errichten. Das geschah denn auch. Unter einem Torbogen
hindurch gelangt man noch heute in dieses Gebäude.
|
 Aber auch
in der folgenden Zeit waren die Juden nicht auf Rosen gebettet. Das zeigt
eine Eingabe des Westheimer Juden
Jakob Feist, die im Jahre 1813 an das großherzogliche Landgericht Euerdorf
(bei Kissingen) gerichtet ist und worin es wörtlich heißt: 'Mit weinente Augen muss ich mayne Beschwärden
gegen den Landgerichtsdiener unterthänigst anbringen, dass ich viele
Klagtäg bey dem Herrn Landrichter nicht vorkommen kann durch Rumhalt des
Dieners. Wen es Amtsbefehl ist, so bitt ich den Amtsvater es mir zu sagen,
damit ich nicht viele Täg und Stunden vor der Thür zu stehn brauche. Wo
ich die Höflichkeit und Menschheit bey mir selbst habe, dass ich das
Landgericht nicht überlässig habe (belästigt!) wann die Not nit trängt,
wenn ich würklich beim Herrn Aktuar eine Auspfändung auswürke, so hat
selber nit viel Respekt dafür und werde nicht vollzogen…' Hier sieht
man, wie selbst ein Gerichtsdiener förmlich Schindluder treibt mit
rechtsuchenden Juden. Nach endlosem Besitzwechsel wurde 1816 dieses fränkische
Ländchen bayerisch. Damals befragte man auch die Westheimer Judenschaft,
ob sie königlich bayerisch oder kaiserlich (österreichisch) gesonnen sei?
Dieser Volksentscheid fiel zugunsten Bayerns aus. Nur Isak Katz, ein
Metzger, erklärte sich vorsichtig 'neiterall' (d.h. parteilos). Dem
Seligmann Arig war es 'gleichgiltig' – woraus die Hakenkreuzler den
Beweis für die vaterlandslosen Juden ableiten können – und Löb Arje
zeigt sich in dem interessanten Schriftstück als Philosoph, denn er
'will waren wie Er mös', (d.h. er will das werden, was er werden
muss). Um jene Zeit ordnete die Regierung an, dass auch die Juden sich bürgerliche
Namen beilegen und es lohnt sich schon einmal in den Listen
nachzuforschen, wie sich die Juden nun benennen. In der Hauptsache schöpfte
man bei dieser staatlichen Holekrasch aus dem Gebiet der Geographie und so
verwandeln sich die Benfet Aron, Jakob Feist usw. in Hanauer, Berliner,
Oppenheimer, Frankfurter, Regensburger, Holländer, Fulder, Schneeberger
u.a.m. Die Kohanim behielten ihren alten Namen Kohn, Kahn, oder Ka-z bei,
was soviel wie Kohen Zedak = Frommer Priester bedeutet. Weil es aber in
der Gemeinde viele 'Ka Zen' gab, tauschte ein Familienzweig dafür den
Namen Adler ein. Neben den Goldschmidt, Stern, Klingenstein, gab es einen
Manufakturwaren-Händler, der sich – Mussliner benannte! In der weltabgeschiedenen Gemeinde Dittlofsroda und
Völkersleier zog man mehr
die Naturkunde zu Rate und hieß sich: Bergmann, Grünlaub, Nussbaum,
Straus, Hoffmann, Stern, Adler usw.
Alle die entschwundenen Generationen eint heute der uralte Friedhof
zu Pfaffenhausen. Wer von Hammelburg nach Kissingen fährt, sieht ihn drüben
am Bergeshang liegen. Vor vielen Jahrhunderten machten die Freiherren von
Erthal ein gutes Geschäft, als sie den öden Platz an die Judenschaft
verkauften. Zahlreiche Gemeinden bis weit in die Rhön nach Brückenau und
bis ins Maintal nach Gemünden waren gezwungen, ihre Toten hierher zu
bestatten. Aber auch
in der folgenden Zeit waren die Juden nicht auf Rosen gebettet. Das zeigt
eine Eingabe des Westheimer Juden
Jakob Feist, die im Jahre 1813 an das großherzogliche Landgericht Euerdorf
(bei Kissingen) gerichtet ist und worin es wörtlich heißt: 'Mit weinente Augen muss ich mayne Beschwärden
gegen den Landgerichtsdiener unterthänigst anbringen, dass ich viele
Klagtäg bey dem Herrn Landrichter nicht vorkommen kann durch Rumhalt des
Dieners. Wen es Amtsbefehl ist, so bitt ich den Amtsvater es mir zu sagen,
damit ich nicht viele Täg und Stunden vor der Thür zu stehn brauche. Wo
ich die Höflichkeit und Menschheit bey mir selbst habe, dass ich das
Landgericht nicht überlässig habe (belästigt!) wann die Not nit trängt,
wenn ich würklich beim Herrn Aktuar eine Auspfändung auswürke, so hat
selber nit viel Respekt dafür und werde nicht vollzogen…' Hier sieht
man, wie selbst ein Gerichtsdiener förmlich Schindluder treibt mit
rechtsuchenden Juden. Nach endlosem Besitzwechsel wurde 1816 dieses fränkische
Ländchen bayerisch. Damals befragte man auch die Westheimer Judenschaft,
ob sie königlich bayerisch oder kaiserlich (österreichisch) gesonnen sei?
Dieser Volksentscheid fiel zugunsten Bayerns aus. Nur Isak Katz, ein
Metzger, erklärte sich vorsichtig 'neiterall' (d.h. parteilos). Dem
Seligmann Arig war es 'gleichgiltig' – woraus die Hakenkreuzler den
Beweis für die vaterlandslosen Juden ableiten können – und Löb Arje
zeigt sich in dem interessanten Schriftstück als Philosoph, denn er
'will waren wie Er mös', (d.h. er will das werden, was er werden
muss). Um jene Zeit ordnete die Regierung an, dass auch die Juden sich bürgerliche
Namen beilegen und es lohnt sich schon einmal in den Listen
nachzuforschen, wie sich die Juden nun benennen. In der Hauptsache schöpfte
man bei dieser staatlichen Holekrasch aus dem Gebiet der Geographie und so
verwandeln sich die Benfet Aron, Jakob Feist usw. in Hanauer, Berliner,
Oppenheimer, Frankfurter, Regensburger, Holländer, Fulder, Schneeberger
u.a.m. Die Kohanim behielten ihren alten Namen Kohn, Kahn, oder Ka-z bei,
was soviel wie Kohen Zedak = Frommer Priester bedeutet. Weil es aber in
der Gemeinde viele 'Ka Zen' gab, tauschte ein Familienzweig dafür den
Namen Adler ein. Neben den Goldschmidt, Stern, Klingenstein, gab es einen
Manufakturwaren-Händler, der sich – Mussliner benannte! In der weltabgeschiedenen Gemeinde Dittlofsroda und
Völkersleier zog man mehr
die Naturkunde zu Rate und hieß sich: Bergmann, Grünlaub, Nussbaum,
Straus, Hoffmann, Stern, Adler usw.
Alle die entschwundenen Generationen eint heute der uralte Friedhof
zu Pfaffenhausen. Wer von Hammelburg nach Kissingen fährt, sieht ihn drüben
am Bergeshang liegen. Vor vielen Jahrhunderten machten die Freiherren von
Erthal ein gutes Geschäft, als sie den öden Platz an die Judenschaft
verkauften. Zahlreiche Gemeinden bis weit in die Rhön nach Brückenau und
bis ins Maintal nach Gemünden waren gezwungen, ihre Toten hierher zu
bestatten.
An der Friedhofsmauer liegen zwei Gräber, an die sich eine schauerliche,
aber wahre Geschichte knüpft. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte
in Dittlofsroda ein frommer angesehener Jude – er betrieb ein kleines
Ladengeschäft und war öfters nicht zuhause. Ein verschuldeter,
habgieriger Müller machte sich dies zunutze. Er überfiel die noch
ziemlich junge Frau, ermordete sie und raffte zusammen, was er finden
konnte. In diesem Augenblick naht, nichts ahnend, mit einem frischen
Kuchen unter dem Arm, vom Backofen her das jüdische Dienstmädchen.
Voller Grausen erblickt es die tote Herrin und den Müller, der noch im
Gelde wühlt. Entsetzen lähmt das Mädchen und ehe es schreien oder flüchten
konnte, hatte der Mörder auch die unerwartete Zuschauerin zum Schweigen
gebracht. Dann entweicht er. Doch bald erreicht ihn sein Schicksal. Zu
Hammelburg auf dem weiten Marktplatz wurde er an den Pranger gestellt und
dann enthauptet. Seiner Mühle haftete von da der Fluch an, sie zerfiel
und längst ist kein Stein mehr von ihr zu finden (Anmerkung: Nach einer
Mitteilung, die ich Herrn Hauptlehrer Hofmann in Rothenburg
o.d.T.
verdanke, habe der Mörder seine Tat im Zuchthaus Bayreuth abgebüßt, sei
also nicht enthauptet worden.".
Unter den bayerischen Königen wurde die Lage der Juden langsam besser.
Man versuchte auch, sie zu Ackerbau und Handwerk heranzubilden, was aber
nicht so schnell gelingen konnte. Eine Zwangskultur durch viele
Jahrhunderte lässt sich nicht so schnell ungeschehen machen.
Doch nach und nach fanden die Juden des Saaletals auch wieder
Gefallen am Ackerbau und so starb voriges Jahr, 86 Jahre alt, ein Westheimer Jude, der mit Leib und Seele die Ackerscholle geliebt hatte. Er
wusste gar lustige Geschichten zu erzählen aus jenen Zeiten und Versuchen
der Regierung. Da war ein Jude, der sollte vor seiner Verheiratung eine Prüfung
im Ackerbau ablegen. Er sollte ein Feld pflügen. Feist – so wollen wir
ihn nennen – hatte aber noch nie einen Pflug in Händen gehabt. Er
merkte also auch nicht, dass Spottvögel ihm die Pflugschar umgekehrt
angeschraubt hatten. Ahnte auch nicht das verstohlene Lächeln in den
Augen der 'hohen Prüfungskommission'. Mit Hü und Hott begann der
Angriff aufs Feld, das sich indes sehr widerspenstig zeigte. Feist
probierte und mühte sich ab, knallte wütend mit der Peitsche auf seine
unschuldigen Kühe; der Angstschweiß lief ihm herab und er würde sich
noch stundenlang umsonst abgequält haben, wenn nicht die gnädige
Kommission ihn erlöst hätte und bescheinigt -, dass er seine Prüfung
– bestanden! Heute sind
diese Zeiten längst überwunden, zahlreiche Familien leben vom Ackerbau
und haben es nicht zu bereuen, dass sie Bauern geworden sind. Zu Unrecht rümpft
mancher städtische Jude über diese einfachen Landjuden die Nase, weil
sie nicht gleich ihm in sorgfältiger Kleidung durch die Welt gehen oder
sausen. Vorläufig gilt noch das uralte Wort von Rabbi Jose: 'Wie schön
ist doch die Arbeit, sie macht einen warm, wenn man mit ihr geht!'". |
|
|
 Anmerkung:
Der Beitrag von Lehrer Julius Straus erschien vor der "Bayerischen
Israelitischen Gemeindezeitung" bereits in der Zeitschrift "Der
Israelit", der Schlussabschnitt in der Ausgabe vom 2. Juli
1925. Anmerkung:
Der Beitrag von Lehrer Julius Straus erschien vor der "Bayerischen
Israelitischen Gemeindezeitung" bereits in der Zeitschrift "Der
Israelit", der Schlussabschnitt in der Ausgabe vom 2. Juli
1925. |
Erinnerungen in Flurnamen
(aus: Josef Wabra: Geschichten und Sagen des Kissinger Raumes. Reihe:
Landeskundliche Schriftenreihe für Nord-Unterfranken Heft 3. Hrsg. von der
Arbeitsgemeinschaft Rhön/Saale / Sitz Bad Kissingen, Bad Kissingen
1965).

 |

Das Jiddä-Dorf (= Juden-Dorf??) |

Hinweis auf die Flur "Judenpfad" |
Dokument erhalten
von
Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries |
"Die
Leute sagen, hier sei einmal im Mittelalter, als die Jiddä aus den
Dörfern ausgestoßen wurden, ein Jiddä-Dorf gestanden. Auch ein
Jiddä-Friedhof soll hier gewesen sein. Später ging das Dorf zugrunde,
aber die Töpfe, die diese Leute gemacht hatten, kann man heute noch
finden, wenn man tiefer in die Erde hineingräbt". |
An der
Saaletalterrasse, etwa 2 km vor Hammelburg,
50 m vor der derzeitigen Saalebrücke, in der Flur "Judenpfad", wurde 1960 eine
vorgeschichtliche Siedlungsstelle entdeckt...." |
Zur Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer
Zu Lehrer Jakob Geßner
Jüdischer Lehrer von 1875 bis 1906 war Jakob
Geßner, der großes Ansehen in der jüdischen Gemeinde und in der Stadt
genoss. Dass er in Hammelburg Lehrer war, wurde auch lange nach seiner dortigen
Zeit hervorgehoben:
Meldung zum 80. Geburtstag von Jakob Geßner (1928)
 Meldung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
August 1928: "Unser Vereinsmitglied, Kantor Krämer in
Ansbach
feierte vor kurzem den 70., Lehrer a.D. J. Geßner in Rostock, früher
in Hammelburg, den 80. Geburtstag. Den beiden Jubilaren auch an dieser
Stelle die herzlichsten Glückwünsche!" Meldung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
August 1928: "Unser Vereinsmitglied, Kantor Krämer in
Ansbach
feierte vor kurzem den 70., Lehrer a.D. J. Geßner in Rostock, früher
in Hammelburg, den 80. Geburtstag. Den beiden Jubilaren auch an dieser
Stelle die herzlichsten Glückwünsche!" |
Nachruf auf Jakob Geßner anlässlich seines Todes (1937)
 Artikel in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Februar 1937: "Jakob Geßner. Kaum 24
Stunden nach dem Ableben unseres Kollegen Jakob Nussbaum wurde uns ein
weiteres liebes und treues Mitglied, der im 89. Lebensjahre stehende
Lehrer i.R. Jakob Geßner, durch den Tod entrissen. Der Heimgegangene, am
18. Juli 1848 in Steinach a.d. Saale geboren, war Schüler der
Präparandenschule
Höchberg und der Lehrerbildungsanstalt Würzburg, die er 1867
absolvierte. In Würzburg legte er auch die Anstellungsprüfung für den
Volksschuldienst ab. Seine erste Anstellung fand er in Völkersleier, wo
er von 1867-1875 tätig war; er wirkte dann in Hammelburg und trat nach
31jähriger überaus segensreicher Tätigkeit in dieser Gemeinde, geehrt
und geachtet in allen Kreisen der Bevölkerung, in den Ruhestand über,
den er bei seinen ihn liebevoll betreuenden Kindern in
Gustrow und später
in Rostock verbrachte. Der Entschlafene zählte zu den Männern, die im
Herbste 1879 dem Weckruf zur Gründung eines jüdischen Lehrervereins zunächst
für Unterfranken, der sich wenige Jahre später auf ganz Bayern
erstreckt, gefolgt waren und sich in Erkenntnis der Notwendigkeit des
Zusammenschlusses der Lehrerschaft dem Verein als Mitglied anschlossen.
Mit warmfühlendem Herzen und in edler sozialer Gesinnung förderte er die
Ziele des jungen Vereins und in einem der ersten Jahresberichte werden
seine erfolgreichen und anerkennenswerten Bemühungen um die
Vereinseinrichtungen dankend hervorgehoben. Durch das Vertrauen der
Kollegen wurde er 1889 zum ersten Male und dann wiederholt als Ersatzmann
gewählt, um alsdann in die Verwaltung, der er von 1894-96 als Beisitzer
angehörte, einzutreten. Anlässlich des 50jährigen Vereinsjubiläums
wurde er mit acht weiteren Gründungsmitgliedern zum Ehrenmitgliede des
Vereins ernannt. Mit dem Dahingeschiedenen ist ein gütiger Mensch, ein
edler und vornehmer Charakter, ein Mann von vorbildlicher Treue
dahingegangen; ihm wird in unseren Reihen ein stetes und ehrendes Andenken
bewahrt bleiben. Secher zadik livrocho (das Gedenken an den
Gerechten ist zum Segen)." Artikel in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Februar 1937: "Jakob Geßner. Kaum 24
Stunden nach dem Ableben unseres Kollegen Jakob Nussbaum wurde uns ein
weiteres liebes und treues Mitglied, der im 89. Lebensjahre stehende
Lehrer i.R. Jakob Geßner, durch den Tod entrissen. Der Heimgegangene, am
18. Juli 1848 in Steinach a.d. Saale geboren, war Schüler der
Präparandenschule
Höchberg und der Lehrerbildungsanstalt Würzburg, die er 1867
absolvierte. In Würzburg legte er auch die Anstellungsprüfung für den
Volksschuldienst ab. Seine erste Anstellung fand er in Völkersleier, wo
er von 1867-1875 tätig war; er wirkte dann in Hammelburg und trat nach
31jähriger überaus segensreicher Tätigkeit in dieser Gemeinde, geehrt
und geachtet in allen Kreisen der Bevölkerung, in den Ruhestand über,
den er bei seinen ihn liebevoll betreuenden Kindern in
Gustrow und später
in Rostock verbrachte. Der Entschlafene zählte zu den Männern, die im
Herbste 1879 dem Weckruf zur Gründung eines jüdischen Lehrervereins zunächst
für Unterfranken, der sich wenige Jahre später auf ganz Bayern
erstreckt, gefolgt waren und sich in Erkenntnis der Notwendigkeit des
Zusammenschlusses der Lehrerschaft dem Verein als Mitglied anschlossen.
Mit warmfühlendem Herzen und in edler sozialer Gesinnung förderte er die
Ziele des jungen Vereins und in einem der ersten Jahresberichte werden
seine erfolgreichen und anerkennenswerten Bemühungen um die
Vereinseinrichtungen dankend hervorgehoben. Durch das Vertrauen der
Kollegen wurde er 1889 zum ersten Male und dann wiederholt als Ersatzmann
gewählt, um alsdann in die Verwaltung, der er von 1894-96 als Beisitzer
angehörte, einzutreten. Anlässlich des 50jährigen Vereinsjubiläums
wurde er mit acht weiteren Gründungsmitgliedern zum Ehrenmitgliede des
Vereins ernannt. Mit dem Dahingeschiedenen ist ein gütiger Mensch, ein
edler und vornehmer Charakter, ein Mann von vorbildlicher Treue
dahingegangen; ihm wird in unseren Reihen ein stetes und ehrendes Andenken
bewahrt bleiben. Secher zadik livrocho (das Gedenken an den
Gerechten ist zum Segen)." |
Die Suche nach der Nachfolge Geßners gestaltete
sich sehr
schwierig, da die Gemeinde offenbar auf Grund der zurückgegangenen
Gemeindegliederzahlen bei der Gehaltsberechnung der jüdischen Lehrer
Einsparungen vornehmen wollte. Auch andere Gründe mag es gegeben haben, da die
nachfolgenden Lehrer (Freudenberger aus Geroda 1906/07, Gundersheimer aus
Zeitlofs 1907/08) jeweils nur wenige Monate in Hammelburg geblieben
sind.
 Aus
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober
1908: "Sprechsaal. Die Zeiten ändern sich. Aus
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober
1908: "Sprechsaal. Die Zeiten ändern sich.
Aus
Unterfranken. Man wird
sich wohl noch erinnern, dass vor zwei Jahren eine Notiz durch die Blätter
ging, die israelitische Kultusgemeinde Hammelburg habe unter 18
eingelaufenen Bewerbungen um die dortige israelitische
Religionslehrerstelle keinen geeigneten Lehrer finden können, d.h. man
wollte den einen oder anderer Lehrer nicht – oder es waren fast alle
nicht gut genug. Herr Lehrer Geßner dankte damals ab und zog sich ins
Privatleben zurück (Gustrow in Mecklenburg), obwohl er keine Pension
erhielt (auf israelitischen Religionslehrerstellen gibt es nämlich eine
Pensionsberechtigung nicht) und obwohl er erst Ende der Fünfziger war und
bei seiner guten Gesundheit noch lange hätte Dienst tun können. Von
einem Dank der Gemeinde Herrn Geßner gegenüber hat man nichts gehört,
obwohl er sich um die Gemeinde Hammelburg verdient gemacht hatte.
Bei der Wahl des Nachfolgers für Herrn Geßner setzte man sich noch aufs
hohe Ross. Schließlich wurde die Stelle Herrn Freudenberger in Geroda
übertragen. Doch der 'Glückliche' legte sein Amt in Hammelburg schon
nach 11 Monaten nieder. Der schöne Posten war wieder frei. In Hammelburg
tat man's jetzt billiger. Herr Gundersheimer in Zeitlofs erhielt gute
Worte, sodass er die Stelle in Hammelburg nach längerem Zögern annahm.
Aber kaum 7 Monate dort, dankte er auch ab.
Wie geht es nun? Man gibt es noch billiger. Von der Vorstandschaft der
israelitischen Gemeinde in Hammelburg werden Briefe ausgesandt. So wurde
bei einem Lehrer in der Gegend von Würzburg angefragt, ob er seine
Bewerbung von früheren Jahren noch aufrechterhalte. Auch in die
Aschaffenburger Gegend kam ein solcher Werbebrief an einen Lehrer. Dazu
sei noch bemerkt, dass die Hammelburger israelitische Kultusgemeinde sich
das Recht vorbehält, nach drei Jahren zu kündigen, sodass der
betreffende Lehrer, falls er dort 'nicht gefällt', mit Kind und Kegel
abziehen kann. -
Nachschrift der Redaktion. Wir geben vorstehender Zuschrift unverkürzt
Raum, müssen aber die Verantwortung für die Einzelheiten der darin
enthaltenen Angaben dem Einsender überlassen. Mit tiefem Bedauern nehmen
wir Kenntnis davon, dass es gerade bayerische Gemeinden sind, die in den
letzten Jahren in recht unliebsamer Weise von sich reden machen. Es ist
ein Zeichen von bedauerlicher Rückständigkeit, wenn leistungsfähige
Gemeinde, anstatt bei Vakanzen durch angemessene Erhöhung des
Lehrergehalts den veränderten Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen und
sich eine gut qualifizierte Lehrkraft zu sichern, durch eine kärgliche
und knauserige Bemessung desselben alle ernsthaften Bewerber abschrecken
und sich dann durch drakonische Bestimmungen gegen das zu schützen
suchen, was man einen Reinfall nennt. Häufiger Lehrerwechsel wirkt äußerst
nachteilig auf die heranwachsende Jugend und fördert den Verfall der
religiösen Institution; er wird aber hervorgerufen durch schlechte
Bezahlung und unwürdige Behandlung des Lehrers. Der Einwand, der vorige
Lehrer habe unter den gleichen Verhältnissen so und so lange ausgehalten,
ist hinfällig: die Zeiten haben sich eben geändert."
|
|
Folgende
Ausschreibungstexte aus den Jahren 1907/08 liegen noch vor. Auf die
Ausschreibung vom November 1907 hat sich Lehrer Gundersheimer aus Zeitlofs
beworben (siehe unten); die Ausschreibung 1908 war nach dem Ende seiner nur siebenmonatigen
Tätigkeit in Hammelburg notwendig geworden: |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
November 1907: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
November 1907:
"Wegen Berufung unseres Lehrers nach Halle ist die
Stelle
eines Lehrers, Vorbeters und Schochet
mit einem Mindest-Gesamteinkommen
von 1800 Mark
sofort zu besetzen.
Bewerbungen an den Unterzeichneten.
Hammelburg, 24. November 1907.
B. Stühler." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
Oktober 1908: "Die Stelle eines Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
Oktober 1908: "Die Stelle eines
Lehrers, Vorbeters und Schochet ist sofort
zu besetzen.
Mindest Gesamteinkommen 1800-2000 Mark. – Verheiratete
Bewerber bevorzugt.
Hammelburg, den 4. Oktober 1908.
Die Kultus-Verwaltung. B. Stühler." |
Über Lehrer Samuel Gundersheimer
(1907-1908 Lehrer in Hammelburg)
Anmerkung:
Lehrer Samuel Gundersheimer ist am 10. Juli 1883 in
Mittelsinn geboren. Er war von 1903 bis
1907 Lehrer in Zeitlofs, von wo er 1907 nach
Hammelburg wechselte, dort allerdings nur
einige Monate blieb; anschließend (ab 1908) war er bis 1922 in
Kleinheubach; 1922 wurde er Lehrer (Hauptlehrer) in Bad Brückenau.
Genealogische Informationen
https://www.geni.com/people/Samuel-Gundersheimer/6000000004988240003).
Gundersheimer starb am 26. September 1966 in Philadelphia, PA/USA.
Beitrag von Lehrer Hermann Mahlermann in Hammelburg
über den 19. Psalm (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1935: "Der
19. Psalm - als Lehrdarstellung für die Oberstufe methodisch bearbeitet
von Hermann Mahlermann in Hammelburg". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1935: "Der
19. Psalm - als Lehrdarstellung für die Oberstufe methodisch bearbeitet
von Hermann Mahlermann in Hammelburg".
Da der Beitrag keine Bezüge zur jüdischen Geschichte in Hammelburg
enthält, wird er nicht ausgeschrieben - bei Interesse bitte Textabbildung
anklicken. |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Mitteilungen der Ergebnisse von
Kollekten in der jüdischen Gemeinde (1869-192)
Anmerkung: mehrmals jährlich wurde in den jüdischen Gemeinden für Zwecke
unterschiedlichster Art gesammelt. Die Ergebnisse wurde häufig in den jüdischen
Zeitschriften bekanntgegeben. Nachstehend werden beispielhaft die
Ergebnisse von Kollekten in Hammelburg wiedergegeben,
 Mitteilung
in "Der Israelitische Lehrer" vom 16. Juni 1869: "Achawa. Verein zur
Unterstützung hilfsbedürftiger israelitischer Lehrer, Lehrer-Witwen und
-Waisen in Deutschland. Mai-Einnahme. Mitteilung
in "Der Israelitische Lehrer" vom 16. Juni 1869: "Achawa. Verein zur
Unterstützung hilfsbedürftiger israelitischer Lehrer, Lehrer-Witwen und
-Waisen in Deutschland. Mai-Einnahme.
Spenden: gesammelt von Herrn Blümlein in Hammelburg bei den Herren Gebr.
Schlesinger 3 Fl. 30 KR., Leopold Nußbaum 1 Fl., Isaak Nußbaum 1 Fl.,
Hermann Nußbaum 1 Fl., Julius Meyer 1 Fl., H. Katz 1 Fl., Is. Meyer 1 Fl.,
Em. Stern 1 Fl., Katz Junior 30 kr., Samuel Nußbaum 36 kr, M. Stühler 30 kr.,
M. Katz 36 kt., Isaak Strauss 1 Fl., Zusammen 13 Fl. 42 KR.". " |
| |
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 29. Oktober 1879: "Hammelburg, Durch Lehrer
Geßner, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Babette Oppenheimer
4.70, Sophie Sichel 4.10, Pauline Nußbaum 1, Regine Nußbaum 1.25, Jeanette
Hanauer 1.15, Sara Kleemann 0.82, Adelheid Stern 1.20, Serch Stühler 2, Nora
Katz 1, Philippine Hamburger 1, Jette Hanauer 2, Karoline Geßner 1, zusammen
abzüglich Porto 21.02 M. " Mitteilung
in "Der Israelit" vom 29. Oktober 1879: "Hammelburg, Durch Lehrer
Geßner, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Babette Oppenheimer
4.70, Sophie Sichel 4.10, Pauline Nußbaum 1, Regine Nußbaum 1.25, Jeanette
Hanauer 1.15, Sara Kleemann 0.82, Adelheid Stern 1.20, Serch Stühler 2, Nora
Katz 1, Philippine Hamburger 1, Jette Hanauer 2, Karoline Geßner 1, zusammen
abzüglich Porto 21.02 M. " |
| |
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 9. November 1881: "Hammelburg, Durch Lehrer J.
Geßner, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Jette Hanauer 3, Eva
Schuster 2.30, Jeanette Hanauer 1.80, Sara Kleemann Witwe 1.40, Adelheid
Stern 2.30, Clara Nußbaum 1.20, Babette Oppenheimer 8.30, Sophie Siegel
4.50, Auguste Rosenberger 2, Philippine Hamburger 2, Sophie Stiefel 1.50,
Karoline Nußbaum 2.60, Pauline Nußbaum 2, Regine Nußbaum 2, Sara Stühler 2,
Semin Schuster 1.50, Karoline Geßner 1.20, zusammen abzüglich Porto 41.30
M.. Für die R. 1, 2,3 und 8. " Mitteilung
in "Der Israelit" vom 9. November 1881: "Hammelburg, Durch Lehrer J.
Geßner, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Jette Hanauer 3, Eva
Schuster 2.30, Jeanette Hanauer 1.80, Sara Kleemann Witwe 1.40, Adelheid
Stern 2.30, Clara Nußbaum 1.20, Babette Oppenheimer 8.30, Sophie Siegel
4.50, Auguste Rosenberger 2, Philippine Hamburger 2, Sophie Stiefel 1.50,
Karoline Nußbaum 2.60, Pauline Nußbaum 2, Regine Nußbaum 2, Sara Stühler 2,
Semin Schuster 1.50, Karoline Geßner 1.20, zusammen abzüglich Porto 41.30
M.. Für die R. 1, 2,3 und 8. " |
| |
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 16. Dezember 1886: "Spenden für das Heilige Land.
Hammelburg. Durch Lehrer Jakob Geßner, Mitteilung
in "Der Israelit" vom 16. Dezember 1886: "Spenden für das Heilige Land.
Hammelburg. Durch Lehrer Jakob Geßner,
A. Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Adelheid Stern 1.50,
Berta Stühler 1, Clara Nußbaum 1.70, Sophie Sichel 2, Jette Stühle 1,50, B.
Adler 1, Sara Kleemann 1.40, Clara Stern 3 Pauline Nußbaum 1, Babette
Oppenheimer 7, Sara Stühler 1.50, Jeanette Hanauer 2.50, Geschwister Katz
1.50, Eva Schuster 3, Fanni Hamburger 2, Ph. Hamburger 3, Karoline Nußbaum
2.50, Fanni Katz zwei, Rika Schuster 3, Regine Nußbaum 1.60, Jette Hanauer
3, Sophie Stiefel 1, Karoline Geßner 1.60 M.. – B. Spenden: Maier Hamburger,
gelegentlich des Gebetes für seinen kranken Sohn 5, Schönthal aus
Frankfurt am Main beim Aufrufen zur Tora 2 M. Gesamtsumme 58,50 M., Wovon je
10 M. für die B"Ch. und R IV, und 1.50 M. für Feibusch Cohn. "
|
| |
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 5. Mai 1887: "Hammelburg. Durch Lehrer Jakob
Geßner, Mitteilung
in "Der Israelit" vom 5. Mai 1887: "Hammelburg. Durch Lehrer Jakob
Geßner,
A. Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Frau B. Oppenheimer 7.96,
Pauline Nußbaum 1, Clara Nußbaum 2.35, Clara Stern 3, Eva Schuster 3, Sophie
Sichel 3, Adelheid Stern 2, Karoline Nußbaum 2.50, Babetta Adler 2, Regine
Nußbaum 1.30, Jette Hanauer 3.20, Auguste Rosenberger zwei, Sara Stühle
1.50, Jette Stühler 1.50, Jeanette Hanauer 2, Sara Kleemann 1.50, Berta
Stühler 1, Ricke Schuster 2, Sophie Stiefel 1, Philippine Hamburger 3, Fanni
Katz 2, Fannie Hamburger 2, Geschwister Katz 1, Karoline Geßner 1.50,
zusammen 53.31 M.
B. Spenden: S. Sichel, ndr 1. A. Nußbaum, desgl. 0.50, Frl.
Rosenstein aus Westheim 3M.
Gesamtsumme abzüglich Porto 57.151M., Wovon je zehn M. für R4 und die
drei im. Für J. L. G. und 1.51 M. für ..." |
| |
 Mitteilung
in "Das jüdische Echo" vom 16. September 1927: "Hammelburg. Büchsen:
Bettina Stern RM. 3.25, August Stühler 2.30, Adler 1.10 = RM. 6.65. Mitteilung
in "Das jüdische Echo" vom 16. September 1927: "Hammelburg. Büchsen:
Bettina Stern RM. 3.25, August Stühler 2.30, Adler 1.10 = RM. 6.65.
Spenden: S. Schuster RM. 10., Stern 5.-, Karl Nußbaum 3.-, Ferdinand Nußbaum
2.-, Ludwig Schuster 1.-, Rosenberger 5.-, Max Stühler 3.-, Finsterwald 3.-,
Martin Nußbaum 2.-, Kappel 1.-, Hamburger 2.- = RM. 36. Gleich RM. 42.65."
|
Die jüdische Gemeinde
Hammelburg engagiert sich an vorderer Stelle (1874)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
14. Juli 1874: "München, 27. Juni (1874). Die israelitischen
Kultusgemeinden in Hammelburg, Kissingen und
Unsleben, sowie weitere 70
Kultusgemeinden in Unterfranken und Aschaffenburg haben an die Kammer der
Abgeordneten die Bitte gestellt, dieselbe wolle beantragen, dass die Königliche
Staatsregierung die Aufhebung der noch in Bayern bestehenden Abgaben der
Juden an christliche Pfarrer, Lehrer und Messner ausspreche. Diese
'Judengelder' hätten, wie es in der Motivierung der Petition heißt,
nur in sehr seltenen Fällen ein privatrechtliches Verhältnis zu
Grundlage und wurzelten meist in der früheren Stellung der Juden in öffentlich
rechtlicher Beziehung. Es könne deshalb den Juden nicht verargt werden,
wenn sie bestrebt seien, von diesen Abgaben, von denen die Gesetze (§ 104
des Religionsedikts, Art. 5 des Gemeinde-Umlagengesetzes von 1819 und Art.
6 des Ablösungsgesetzes von 1848) sie befreien, auch tatsächlich befreit
zu werden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
14. Juli 1874: "München, 27. Juni (1874). Die israelitischen
Kultusgemeinden in Hammelburg, Kissingen und
Unsleben, sowie weitere 70
Kultusgemeinden in Unterfranken und Aschaffenburg haben an die Kammer der
Abgeordneten die Bitte gestellt, dieselbe wolle beantragen, dass die Königliche
Staatsregierung die Aufhebung der noch in Bayern bestehenden Abgaben der
Juden an christliche Pfarrer, Lehrer und Messner ausspreche. Diese
'Judengelder' hätten, wie es in der Motivierung der Petition heißt,
nur in sehr seltenen Fällen ein privatrechtliches Verhältnis zu
Grundlage und wurzelten meist in der früheren Stellung der Juden in öffentlich
rechtlicher Beziehung. Es könne deshalb den Juden nicht verargt werden,
wenn sie bestrebt seien, von diesen Abgaben, von denen die Gesetze (§ 104
des Religionsedikts, Art. 5 des Gemeinde-Umlagengesetzes von 1819 und Art.
6 des Ablösungsgesetzes von 1848) sie befreien, auch tatsächlich befreit
zu werden." |
Befreiung der jüdischen Reservisten vom Dienst an den
Hohen Feiertagen (1907)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1907: "Bad
Kissingen, 27.
August. Auf das Gesuch des hiesigen Distriktsrabbiners an das
General-Kommando Würzburg um Befreiung der Reservisten an den kommenden
israelitischen Feiertagen erfolgt nachstehende Antwort: 'Im Verfolge
Ihres an das Königliche General-Kommando gerichteten Schreibens vom 1.2
dieses Monats Nr. 276 wurde angeordnet, dass die vom 7. bis 20. September
nach dem Truppen-Übungsplatz Hammelburg einberufenen israelitischen
Mannschaften des Beurlaubtenstandes soweit vom Dienste zu befreien sind,
dass sie am 9., 10. und 18. September in Hammelburg ihren religiösen
Verpflichtungen nachkommen können." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1907: "Bad
Kissingen, 27.
August. Auf das Gesuch des hiesigen Distriktsrabbiners an das
General-Kommando Würzburg um Befreiung der Reservisten an den kommenden
israelitischen Feiertagen erfolgt nachstehende Antwort: 'Im Verfolge
Ihres an das Königliche General-Kommando gerichteten Schreibens vom 1.2
dieses Monats Nr. 276 wurde angeordnet, dass die vom 7. bis 20. September
nach dem Truppen-Übungsplatz Hammelburg einberufenen israelitischen
Mannschaften des Beurlaubtenstandes soweit vom Dienste zu befreien sind,
dass sie am 9., 10. und 18. September in Hammelburg ihren religiösen
Verpflichtungen nachkommen können." |
Blutspenden nichtjüdischer
Offiziere zur Rettung des Lebens der jüdischen Soldaten Frankfurter (1913)
 Artikel
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. Juli 1913: "Die
Opferwilligkeit bayrischer Offiziere. Artikel
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. Juli 1913: "Die
Opferwilligkeit bayrischer Offiziere.
Würzburg. Eine höchst anerkennenswerten Opferwilligkeit haben bayerische
Offiziere bewiesen, um das Leben eines Soldaten zu retten. Aus Würzburg wird
gemeldet: der Soldat Frankfurter des 11. Feldartillerieregiments in Würzburg
erkrankte auf dem Truppenübungsplatz Hammelburg an Blutzersetzung,
sodass eine Bluttransfusion notwendig wurde. Als der Oberst die Anfrage
stellte, wer sich zu der Abzapfung von Blut für den Soldaten hergebe,
meldeten sich 17 Offiziere, darunter ein Major. Leutnant Dittmar von
der 6. Kompanie des 9. Infanterie-Regiments stellte sich als erster zur
Verfügung und ließ sich durch Professor Enderlen das Blut abzapfen, das dem
Soldaten infiziert wurde. Der Soldat befindet sich auf dem Wege der
Besserung. Auf solche Offiziere kann das Offizierkorps stolz sein. Glücklich
das Land, in dessen Offizierskorps ein solcher Geist haltet! "
|
Ein Hammelburger Gastwirt wird
wegen Beihilfe zum Schächten" in der NS-Zeit verhaftet (1934)
 Artikel
in "Die Stimme" vom 29. Januar 1935: "Wegen Beihilfe zum Schächten in
Schutzhaft Artikel
in "Die Stimme" vom 29. Januar 1935: "Wegen Beihilfe zum Schächten in
Schutzhaft
Berlin, 24. Jänner wie der 'Völkische Beobachter' meldet, wurde in
Hammelburg (Bayern) ein Gastwirt wegen Vergehens der Beihilfe zur jüdischen
Schächtung in Schutzhaft genommen." |
Nach
1945: Emigrantentreffen in New York (1949)
 Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:
Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:
"Bad Kissingen - Brückenau
- Hammelburg - Gerolzhofen.
Samstag, den 30. April ab 7.30 Uhr abends. Treffen in
Begelo's Café-Restaurant
3801 Broadway (158 St.), l Treppe. Tel.: WA 8-9654". |
Mitteilungen zu einzelnen Personen
aus der Gemeinde
25jähriges Geschäftsjubiläum der
Firma des aus Hammelburg stammenden Max Baumann in Wittenberg sowie seine
Silberhochzeit (1909)
 Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 25. Juni 1909: "Wittenberg, 18. Juni. In
unserer Stadt haben sich bekanntlich vor etwa 30 Jahren die ersten jüdischen
Familien ansässig gemacht, und wechseln jetzt, wenn auch noch in seltenen
Fällen die Familienfestlichkeiten. So feiert am Donnerstag den 10. Juni
unsere Mitbürger Herr Max Baumann sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum
und auch mit seiner Gattin im Kreise seiner Familie, Verwandten, Freunden
und Bekannten die Silberhochzeit. Die Jubilare wurden nicht nur von Ihnen
Nahestehenden, auch von einem großen Teil der Mitbürger in sehr reichem Maße
geehrt. Baumann, ein Süddeutscher aus dem fränkischen Städtchen
Hammelburg gebürtig, und dessen Gattin, eine geborene Bendheim aus Halle
a. S., erfreuen sich eines guten Rufes. Baumann, der in seiner soliden,
schlichten Lebensweise bemüht ist, das Ansehen seiner Familie hochzuhalten,
auch das geschäftliche Renommee in peinlichster Weise zu wahren wusste,
betätigt sich auch in der uneigennützigsten Weise für die hiesige freie
Religionsgemeinschaft, insofern an der Spitze stehend, dass er seit eine
Reihe von Jahren dahin zu wirken verstand, dass unsere Jugend einen guten
Religionsunterricht genießt, und an den Festtagen die Abhaltung eines
würdigen Gottesdienstes in edelster Weise ins Leben rief. Er selbst aber
steht der Hauptgemeinde Halle so nahe, dass er den geschäftlich
erforderlichen Teil hier auch mit erledigt." Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 25. Juni 1909: "Wittenberg, 18. Juni. In
unserer Stadt haben sich bekanntlich vor etwa 30 Jahren die ersten jüdischen
Familien ansässig gemacht, und wechseln jetzt, wenn auch noch in seltenen
Fällen die Familienfestlichkeiten. So feiert am Donnerstag den 10. Juni
unsere Mitbürger Herr Max Baumann sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum
und auch mit seiner Gattin im Kreise seiner Familie, Verwandten, Freunden
und Bekannten die Silberhochzeit. Die Jubilare wurden nicht nur von Ihnen
Nahestehenden, auch von einem großen Teil der Mitbürger in sehr reichem Maße
geehrt. Baumann, ein Süddeutscher aus dem fränkischen Städtchen
Hammelburg gebürtig, und dessen Gattin, eine geborene Bendheim aus Halle
a. S., erfreuen sich eines guten Rufes. Baumann, der in seiner soliden,
schlichten Lebensweise bemüht ist, das Ansehen seiner Familie hochzuhalten,
auch das geschäftliche Renommee in peinlichster Weise zu wahren wusste,
betätigt sich auch in der uneigennützigsten Weise für die hiesige freie
Religionsgemeinschaft, insofern an der Spitze stehend, dass er seit eine
Reihe von Jahren dahin zu wirken verstand, dass unsere Jugend einen guten
Religionsunterricht genießt, und an den Festtagen die Abhaltung eines
würdigen Gottesdienstes in edelster Weise ins Leben rief. Er selbst aber
steht der Hauptgemeinde Halle so nahe, dass er den geschäftlich
erforderlichen Teil hier auch mit erledigt." |
Manfred Leven wird für seinen
Kriegseinsatz mit dem Eisernen Kreuz II ausgezeichnet (1915)
Anmerkung: Manfred Leven (geb. 1893 in Hammelburg, später wohnhaft in
Steinach a.d.Saale, wurde nach der Deportation ab Würzburg am 25. April 1942
nach Krasnystaw ermordet (für tot erklärt).
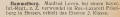 Artikel
in "Das jüdische Echo" vom 10. September 1915: "Hammelburg. Manfred
Leven, bei einem bayerischen Infanterie-Regiment, zur Zeit verwundet im
Reserve-Lazarett Friedberg in Hessen, erhielt das Eiserne zweite Klasse. " Artikel
in "Das jüdische Echo" vom 10. September 1915: "Hammelburg. Manfred
Leven, bei einem bayerischen Infanterie-Regiment, zur Zeit verwundet im
Reserve-Lazarett Friedberg in Hessen, erhielt das Eiserne zweite Klasse. " |
Zum Tod von Philippine Hamburger (1920)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August
1920: "Würzburg, 28. Juli (1920). Am 27. Juli hauchte Frau Philippine,
Gattin der Herrn Abraham Hamburger in Hammelburg, nach kurzem Krankenlager
ihre edle Seele aus. Wer die Verblichene gekannt, der versteht den tiefen
Schmerz, den ihr Hintritt ausgelöst. Sie verkörperte des Dichters Wort:
'Die Sprache der Liebe ruhte auf ihren Lippen'. An den Strahlen ihrer
Herzensgüte wärmten sich so viele ohne Unterschied des Bekenntnisses.
Wer sich in bedrängter Lage je an sie gewendet, der konnte ihrer Hilfe
sicher sein. Ihr Wohl tun war reichlich, war unbegrenzt und wenn die Recht
gab, die Linke durfte es nicht wissen. Und wie wurde in ihrem Hause die
Gastfreundschaft gepflegt. Wer je hungernd ihre Schwelle betrat, der
verließ sie hoch befriedigt. Ihr liebenswürdiges Wesen gewann ihr alle
Herzen; die Trauer um sie berührt daher weite Kreise. Möge sie nun im
Reiche der Liebe, wo sie nun weilt, Fürsprecher für ihre teure Familie
sein. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August
1920: "Würzburg, 28. Juli (1920). Am 27. Juli hauchte Frau Philippine,
Gattin der Herrn Abraham Hamburger in Hammelburg, nach kurzem Krankenlager
ihre edle Seele aus. Wer die Verblichene gekannt, der versteht den tiefen
Schmerz, den ihr Hintritt ausgelöst. Sie verkörperte des Dichters Wort:
'Die Sprache der Liebe ruhte auf ihren Lippen'. An den Strahlen ihrer
Herzensgüte wärmten sich so viele ohne Unterschied des Bekenntnisses.
Wer sich in bedrängter Lage je an sie gewendet, der konnte ihrer Hilfe
sicher sein. Ihr Wohl tun war reichlich, war unbegrenzt und wenn die Recht
gab, die Linke durfte es nicht wissen. Und wie wurde in ihrem Hause die
Gastfreundschaft gepflegt. Wer je hungernd ihre Schwelle betrat, der
verließ sie hoch befriedigt. Ihr liebenswürdiges Wesen gewann ihr alle
Herzen; die Trauer um sie berührt daher weite Kreise. Möge sie nun im
Reiche der Liebe, wo sie nun weilt, Fürsprecher für ihre teure Familie
sein. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." |
Zum Tod
der aus Hammelburg stammenden Betty Sänger geb. Katz, Frau/Witwe des Rabbiners Dr.
Hirsch Sänger (gest. 1922 in Bad Mergentheim)
Anmerkung: die verstorbene Betty (Babette) geb. Katz ist am 17.
Mai 1853 in Hammelburg geboren als Tochter von Maier Katz und der Clara
geb. Cahn. Aus der Ehe mit Rabbiner Dr. Sänger gingen sieben Kinder hervor:
Jacob (1878), Bernhard (Benno) 1879), Jonas und Clara (1880; Jonas ist früh
verstorben), Max und Fanny (1883), Isidor (1886).
Bei dem genannten Sohn - Rabbiner an der Breslauer Synagogengemeinde - handelte
es sich um Dr. Jacob Hirsch Sänger (geb. 24. Juni 1878 in Bingen, gest.
25. Juni 1938 in Breslau): studierte am Rabbinerseminar und an der Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, war ca. 1908 bis 1918 Rabbiner
und Religionslehrer an verschiedenen Stellen in Berlin, von 1915 bis 1918
Feldrabbiner in Rumänien; 1918 bis 1938 Rabbiner in Breslau an der Neuen
Synagoge sowie Dozent und Lehrer in Einrichtungen und Vereinen; war verheiratet
mit Hilda geb. Heimann; der Sohn Dr. Hermann Max Sänger (geb. 1909 in
Berlin, gest. 1980 in Prahran, Melbourne, Australien) wurde gleichfalls
Rabbiner.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
28. Dezember 1922: "Mergentheim, 20. Dezember (1922). Die
hiesige jüdische Gemeinde steht noch ganz unter dem Eindruck des
unerwarteten und furchtbaren Verlustes, den sie durch den Tod der in allen
Bevölkerungskreisen verehrten Gattin ihres früheren Rabbiners, der
Frau Dr. Betty Sänger erlitten hat. Den Sabbatabend verbrachte
sie noch inmitten der Gemeindemitglieder, unter denen sie so gerne
geweilt, anlässlich eines zu Chanukka veranstalteten Vergnügens und alle
freuten sich ob ihres heiteren, fast jugendlichen Wesens. Und selbst den
ganzen Sonntag ging sie noch ihren menschenfreundlichen Werken nach, die
der Zweck ihres Lebens waren, ohne zu ahnen, dass am Abend dieses Tages
der Todesengel in nur wenigen Minuten sie aus dieser Welt in jene andere,
für die sie sich ihr ganzes Leben hindurch vorbereitet hatte, entführen
sollte. Erlitt sie auch so den Tod, für den sie gebetet, so traf ihr
jäher Heimgang Familie und Gemeinde umso niederdrückender. Nicht was
Kinder und Angehörige verloren, soll hier zum Ausdruck kommen, sondern
was dem Judentum genommen und was den Vielen, in deren Mitte sie gelebt,
entrissen, soll ausgesprochen sein. Seit dem vor 13 1/2 Jahren erfolgten
Tode ihres Gatten, dem sie eine wackere Frau im schönsten Sinne
des Wortes gewesen, war ihr ganzes Leben ein einziges großes Liebeswerk.
Sie kannte keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Hoch und
Niedrig, für sie war jeder Mensch das Ebenbild Gottes, mit dem sich zu
freuen in Stunden des Glückes sie beseligte, mit dem jedes irdische Leid
innigst zu teilen, sie befriedigte und ihr Herzensgebot gewesen. Wie ihr
ganzes Leben ein Gottesdienst war, so hatte sie ihr Haus zu einem
Heiligtum gestaltet, darin Israels Gott verehrt und der Tora Wort strengstens
befolgt worden ist. Mit ihr scheidet eine Persönlichkeit aus der
Gemeinde, die jeder gekannt und jeder verehrt, die von jedem geschätzt
und geliebt worden ist. In der Stunde ihrer Beisetzung zeigte sich trotz
des schlechten Wetters, die innige und aufrichtige Teilnahme, die Juden
und Christen ohne Unterschied ihr bezeugten. An ihrer Bahre sprach nach
dem Ortsrabbiner Dr. Kahn, der ihre Verdienste als Rabbinersgattin
und als Vorsitzende des Jüdischen Frauen-Vereins besonders hervorhob, der
älteste Sohn, der Rabbiner an der Breslauer Synagogengemeinde, Dr.
Sänger. Er dankte in seinem und der Geschwister Namen aus
tiefbewegtem Herzen der allverehrten Mutter, die ihnen auf allen ihren
Lebenswegen Vorbild und Leitstern gewesen. Ihre Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
28. Dezember 1922: "Mergentheim, 20. Dezember (1922). Die
hiesige jüdische Gemeinde steht noch ganz unter dem Eindruck des
unerwarteten und furchtbaren Verlustes, den sie durch den Tod der in allen
Bevölkerungskreisen verehrten Gattin ihres früheren Rabbiners, der
Frau Dr. Betty Sänger erlitten hat. Den Sabbatabend verbrachte
sie noch inmitten der Gemeindemitglieder, unter denen sie so gerne
geweilt, anlässlich eines zu Chanukka veranstalteten Vergnügens und alle
freuten sich ob ihres heiteren, fast jugendlichen Wesens. Und selbst den
ganzen Sonntag ging sie noch ihren menschenfreundlichen Werken nach, die
der Zweck ihres Lebens waren, ohne zu ahnen, dass am Abend dieses Tages
der Todesengel in nur wenigen Minuten sie aus dieser Welt in jene andere,
für die sie sich ihr ganzes Leben hindurch vorbereitet hatte, entführen
sollte. Erlitt sie auch so den Tod, für den sie gebetet, so traf ihr
jäher Heimgang Familie und Gemeinde umso niederdrückender. Nicht was
Kinder und Angehörige verloren, soll hier zum Ausdruck kommen, sondern
was dem Judentum genommen und was den Vielen, in deren Mitte sie gelebt,
entrissen, soll ausgesprochen sein. Seit dem vor 13 1/2 Jahren erfolgten
Tode ihres Gatten, dem sie eine wackere Frau im schönsten Sinne
des Wortes gewesen, war ihr ganzes Leben ein einziges großes Liebeswerk.
Sie kannte keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Hoch und
Niedrig, für sie war jeder Mensch das Ebenbild Gottes, mit dem sich zu
freuen in Stunden des Glückes sie beseligte, mit dem jedes irdische Leid
innigst zu teilen, sie befriedigte und ihr Herzensgebot gewesen. Wie ihr
ganzes Leben ein Gottesdienst war, so hatte sie ihr Haus zu einem
Heiligtum gestaltet, darin Israels Gott verehrt und der Tora Wort strengstens
befolgt worden ist. Mit ihr scheidet eine Persönlichkeit aus der
Gemeinde, die jeder gekannt und jeder verehrt, die von jedem geschätzt
und geliebt worden ist. In der Stunde ihrer Beisetzung zeigte sich trotz
des schlechten Wetters, die innige und aufrichtige Teilnahme, die Juden
und Christen ohne Unterschied ihr bezeugten. An ihrer Bahre sprach nach
dem Ortsrabbiner Dr. Kahn, der ihre Verdienste als Rabbinersgattin
und als Vorsitzende des Jüdischen Frauen-Vereins besonders hervorhob, der
älteste Sohn, der Rabbiner an der Breslauer Synagogengemeinde, Dr.
Sänger. Er dankte in seinem und der Geschwister Namen aus
tiefbewegtem Herzen der allverehrten Mutter, die ihnen auf allen ihren
Lebenswegen Vorbild und Leitstern gewesen. Ihre Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens." |
Zum Tod der Witwe Adelheid Stern geb. Gerber
(lange in Hammelburg wohnhaft, gestorben 1924 in Fulda)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28.
August 1924: "Fulda, 25.
Juli (1924). In der Nacht zum Schabbat Behar schloss hier Frau Witwe
Adelheid Stern geb. Gerber im 85. Lebensjahre ihre müden Augen. Von
Jugend an war ihr ganzes Schaffen und Streben in erster Linie der
genauesten Befolgung auch der kleinsten Mizwoh gewidmet und in ihrer
Heimatstadt Gersfeld war sie schon als
junges Mädchen als Trägerin edler jüdischer Tugenden bekannt gewesen.
In ihrer Ehe war sie ihrem Gatten eine wahrhafte wackere Frau, von der man
mit Recht ausrufen durfte und sie stand noch in der Nacht auf. In aller
Sorge um den Alltag aber hat sie in unerschütterlicher Gottesfurcht jedes
Gebot des jüdischen Pflichtenkreises geübt. Und als sie nach dem Tode
ihres Gatten von Hammelburg nach Fulda zu
ihren Kindern übersiedelte, war auch hier der Kreis ihrer Verehrer
und Bewunderer bald ein großer geworden. Und in der Tat war es
staunenswert und rührend zugleich, wie diese Frau als 83-jährige das
Gebot des Krankenbesuches und der wahrhaften Wohltätigkeit übte, wie sie
in den Slichaustagen (Slichot-Tage) allmorgendlich in 'Schul' zu sehen
war. Aber auch zu Hause sah man sie in ihren Greisentagen nicht müßig
sitzen und wenn sie sich nicht im Haushalt noch irgendwo nützlich machen konnte,
so las sie in irgendeinem Buch, sei es Mossad oder Psalmen.
All diese Eigenschaften der heimgegangenen echten und treuen Jüdin
schilderte Herr Provinzialrabbiner Dr. Leo Cahn, Fulda,
in ergreifenden Worten bei der Beisetzung. Ihre Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28.
August 1924: "Fulda, 25.
Juli (1924). In der Nacht zum Schabbat Behar schloss hier Frau Witwe
Adelheid Stern geb. Gerber im 85. Lebensjahre ihre müden Augen. Von
Jugend an war ihr ganzes Schaffen und Streben in erster Linie der
genauesten Befolgung auch der kleinsten Mizwoh gewidmet und in ihrer
Heimatstadt Gersfeld war sie schon als
junges Mädchen als Trägerin edler jüdischer Tugenden bekannt gewesen.
In ihrer Ehe war sie ihrem Gatten eine wahrhafte wackere Frau, von der man
mit Recht ausrufen durfte und sie stand noch in der Nacht auf. In aller
Sorge um den Alltag aber hat sie in unerschütterlicher Gottesfurcht jedes
Gebot des jüdischen Pflichtenkreises geübt. Und als sie nach dem Tode
ihres Gatten von Hammelburg nach Fulda zu
ihren Kindern übersiedelte, war auch hier der Kreis ihrer Verehrer
und Bewunderer bald ein großer geworden. Und in der Tat war es
staunenswert und rührend zugleich, wie diese Frau als 83-jährige das
Gebot des Krankenbesuches und der wahrhaften Wohltätigkeit übte, wie sie
in den Slichaustagen (Slichot-Tage) allmorgendlich in 'Schul' zu sehen
war. Aber auch zu Hause sah man sie in ihren Greisentagen nicht müßig
sitzen und wenn sie sich nicht im Haushalt noch irgendwo nützlich machen konnte,
so las sie in irgendeinem Buch, sei es Mossad oder Psalmen.
All diese Eigenschaften der heimgegangenen echten und treuen Jüdin
schilderte Herr Provinzialrabbiner Dr. Leo Cahn, Fulda,
in ergreifenden Worten bei der Beisetzung. Ihre Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Aus dem "Gedächtnisbuch der Großloge"
zur Erinnerung an den aus Hammelburg stammenden Expräsidenten Oscar Blümleim
(1925)
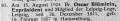 Mitteilung
in "Der Orden Bne Briss - Mitteilungen der Großloge für Deutschland VIII
U.O.B.B." vom Januar 1925: "Am 15. August 1924 Bruder Oskar Blümlein,
Expräsident und Mitglied der Leipzig-Loge, Leipzig, seit 25. Dezember
1911, geb. 19. Februar 1867 in Hammelburg. " Mitteilung
in "Der Orden Bne Briss - Mitteilungen der Großloge für Deutschland VIII
U.O.B.B." vom Januar 1925: "Am 15. August 1924 Bruder Oskar Blümlein,
Expräsident und Mitglied der Leipzig-Loge, Leipzig, seit 25. Dezember
1911, geb. 19. Februar 1867 in Hammelburg. "
Grab von Oskar
Blümlein im jüdischen Friedhof Leipzig. |
Mitteilung des Todes von Nathan
Stern aus Hammelburg, Mitglied in der "Franken-Loge" Würzburg (1928)
 Mitteilung
in "Der Orden Bne Briss - Mitteilungen der Großloge für Deutschland VIII
U.O.B.B." vom Juni 1928: "Franken Loge, Würzburg Mitteilung
in "Der Orden Bne Briss - Mitteilungen der Großloge für Deutschland VIII
U.O.B.B." vom Juni 1928: "Franken Loge, Würzburg
Aufgenommen: Dr. Walter Gerhard Rosenthal Benno
Schwabacher Alfred Seelig
Verstorben: Dr. Cossy Silberschmidt, Bad Kissingen
Nathan Stern, Hammelburg " |
Zum Tod von Josef Berk (1935)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Februar 1935:
"Hammelburg,
5. Februar. Nach vollendetem 82. Lebensjahre starb eines der ältesten
Mitglieder unserer Gemeinde, Herr Josef Berk. Am Grabe würdigte Lehrer
Mahlermann die Persönlichkeit des Heimgegangenen." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Februar 1935:
"Hammelburg,
5. Februar. Nach vollendetem 82. Lebensjahre starb eines der ältesten
Mitglieder unserer Gemeinde, Herr Josef Berk. Am Grabe würdigte Lehrer
Mahlermann die Persönlichkeit des Heimgegangenen." |
In der NS-Zeit - "Schutzhaft" gegen Siegfried
Stern und Metzger Zoll - Anfang 1935
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1935:
"Würzburg. Wie der 'Völkische Beobachter' meldet, wurde in
Hammelburg (Bayern) ein Gastwirt und Metzger in Schutzhaft genommen, der
eines Vergehens der Beihilfe zur jüdischen Schächtung überführt worden
sein soll." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1935:
"Würzburg. Wie der 'Völkische Beobachter' meldet, wurde in
Hammelburg (Bayern) ein Gastwirt und Metzger in Schutzhaft genommen, der
eines Vergehens der Beihilfe zur jüdischen Schächtung überführt worden
sein soll." |
| |
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1935:
"Nürnberg. Das Amtgericht in Hammelburg verurteilte, wie die 'Völkische
Tageszeitung' in Nürnberg meldet, Siegfried Stern und seinen Gehilfen,
den Metzger Zoll von
Westheim, wegen Vergehens gegen das Schächtgesetz zu
je zwei Monaten Gefängnis, Zoll außerdem noch zu 1.000 RM Geldstrafe.
Die beiden Angeklagten waren, wie der 'Völkische Beobachter' am 23.
Januar gemeldet hatte, in Schutzhaft genommen worden." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1935:
"Nürnberg. Das Amtgericht in Hammelburg verurteilte, wie die 'Völkische
Tageszeitung' in Nürnberg meldet, Siegfried Stern und seinen Gehilfen,
den Metzger Zoll von
Westheim, wegen Vergehens gegen das Schächtgesetz zu
je zwei Monaten Gefängnis, Zoll außerdem noch zu 1.000 RM Geldstrafe.
Die beiden Angeklagten waren, wie der 'Völkische Beobachter' am 23.
Januar gemeldet hatte, in Schutzhaft genommen worden." |
Anzeigen jüdischer
Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen des Tuch- und Modewaren-Geschäftes en gros et
en détail Emanuel Stern (1871 / 1889 / 1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli
1871: "Für mein Tuch- und Modewaren-Geschäft en gros et en détail,
das am Samstag und an Feiertagen streng geschlossen ist, suche ich einen
Lehrling aus achtbarer Familie mit guten Schulkenntnissen, mit oder ohne
Lehrgeld. Emanuel Stern in Hammelburg." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli
1871: "Für mein Tuch- und Modewaren-Geschäft en gros et en détail,
das am Samstag und an Feiertagen streng geschlossen ist, suche ich einen
Lehrling aus achtbarer Familie mit guten Schulkenntnissen, mit oder ohne
Lehrgeld. Emanuel Stern in Hammelburg." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Dezember 1889:
"Für mein Tuch- und Manufakturwaren-Geschäft en gros & en
detail suche ich einen Lehrling mit guten Vorkenntnissen. Samstage und
Feiertage geschlossen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Dezember 1889:
"Für mein Tuch- und Manufakturwaren-Geschäft en gros & en
detail suche ich einen Lehrling mit guten Vorkenntnissen. Samstage und
Feiertage geschlossen.
Emmanuel Stern, Hammelburg". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1901:
"In meinem Manufakturwaren-Geschäft, Engros und Detail ist
eine
Lehrlingsstelle
unter günstigen Bedingungen sofort zu besetzen.
Emanuel Stern, Hammelburg, Bayern."
|
Anzeigen des Kurz-, Woll- und Manufakturwarengeschäftes
Bernhard Strauß (1889/90)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1889: Lehrlings-Gesuch. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1889: Lehrlings-Gesuch.
Für mein Kurz-, Woll- und Manufakturwarengeschäft suche per sofort unter
günstigen Bedingungen einen Lehrling mit den nötigen Schulkenntnissen
aus israelitischer Familie.
Bernhard Strauß, Firma B. Strauß & Comp., Hammelburg bei
Gemünden." |
| |
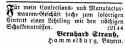 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. April 1890: "Für
mein Konfektions- und Manufakturwaren-Geschäft suche zum sofortigen
Eintritt einen Lehrling mit den nötigen Schulkenntnissen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. April 1890: "Für
mein Konfektions- und Manufakturwaren-Geschäft suche zum sofortigen
Eintritt einen Lehrling mit den nötigen Schulkenntnissen.
Bernhard Strauß, Hammelburg, Bayern."
|
Anzeige der Bäckerei und
Mehlgeschäfts S. Sichel (1891)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 5. Februar 1891: "Suche für meine Bäckerei und
Mehlgeschäft einen Lehrling aus ordentlicher Familie. Anzeige
in "Der Israelit" vom 5. Februar 1891: "Suche für meine Bäckerei und
Mehlgeschäft einen Lehrling aus ordentlicher Familie.
S. Sichel, Hammelburg (Bayern). " |
Anzeige des Tuch-, Manufakturwaren- und
Konfektionsgeschäftes Heinrich Katz (1891)
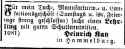 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1891:
"Für mein Tuch-, Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft (Samstags
und isr. Feiertage streng geschlossen) suche einen Lehrling mit
guten Schulkenntnissen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1891:
"Für mein Tuch-, Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft (Samstags
und isr. Feiertage streng geschlossen) suche einen Lehrling mit
guten Schulkenntnissen.
Heinrich Katz in Hammelburg."
|
Anzeige des Manufaktur-, Kurz- und
Spezereiwaren-Geschäftes Simon Schuster (1891)
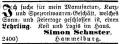 Anzeige
in "Der Israelit" vom 16. April 1891: "Ich suche für mein Manufaktur-, Kurz-
und Spezereiwaren-Geschäft, welches Sonn- und Feiertage geschlossen ist,
einen Lehrling. Kost und Logis im Haus. Anzeige
in "Der Israelit" vom 16. April 1891: "Ich suche für mein Manufaktur-, Kurz-
und Spezereiwaren-Geschäft, welches Sonn- und Feiertage geschlossen ist,
einen Lehrling. Kost und Logis im Haus.
Simon Schuster, Hammelburg " |
Anzeige von Js. Schuster & Cie., Inhaber eine
Manufakturwaren-Geschäftes (1892)
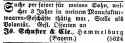 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September 1892: "Suche per
sofort für meinen Sohn, welcher 3 Jahre in meinem Manufakturwaren-Geschäfte
tätig war, Stelle als Volontär. Gefällige Offerten an Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September 1892: "Suche per
sofort für meinen Sohn, welcher 3 Jahre in meinem Manufakturwaren-Geschäfte
tätig war, Stelle als Volontär. Gefällige Offerten an
Js. Schuster
& Cie., Hammelburg (Bayern).." |
Anzeige des Manufakturwaren-, Herren- und
Damen-Konfektionsgeschäftes Samuel Stern (1892)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. November 1892: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. November 1892:
"Lehrlingsgesuch!
Für mein Manufakturwaren-,
Herren- und Damen-Konfektions-Geschäft (Samstag und Feiertage
geschlossen), suche zum sofortigen Eintritt einen Lehrling mit den nötigen
Vorkenntnissen. Kost und Logis im Hause.
Samuel Stern, Hammelburg (Bayern) |
Anzeige - Lehrlingssuche der
Branntweinbrennerei, Liquer-, Essigspritfabrik und Weinhandlung Isidor Schuster
& Cie. (1893)
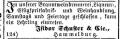 Anzeige
in "Der Israelit" vom 9. Januar 1893: "in unserer Branntweinbrennerei,
Liqueur-, Essigspiritfabrik und Weinhandlung, Samstags und Feiertage
geschlossen, kann ein Lehrling eintreten. Isidor Schuster & Cie.,
Hammelburg. " Anzeige
in "Der Israelit" vom 9. Januar 1893: "in unserer Branntweinbrennerei,
Liqueur-, Essigspiritfabrik und Weinhandlung, Samstags und Feiertage
geschlossen, kann ein Lehrling eintreten. Isidor Schuster & Cie.,
Hammelburg. " |
Anzeigen des gemischten Warengeschäftes und
Holz-/Baumaterialienhandlung Simon Schuster (1893/94)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1893: "Ich
suche für mein an Sabbat und Feiertagen streng geschlossenes, gemischtes
Warengeschäft nebst Holzhandlung einen Lehrling mit guter Schulbildung
bei freier Station. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1893: "Ich
suche für mein an Sabbat und Feiertagen streng geschlossenes, gemischtes
Warengeschäft nebst Holzhandlung einen Lehrling mit guter Schulbildung
bei freier Station.
Simon Schuster, Hammelburg" |
| |
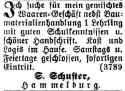 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Juli 1894: "Ich suche für mein gemischtes Waren-Geschäft
nebst Baumaterialienhandlung 1 Lehrling mit guten Schulkenntnissen und
schöner Handschrift. Kost und Logis im Hause. Samstags und Feiertage
geschlossen, sofortigen Eintritt. S. Schuster, Hammelburg.." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Juli 1894: "Ich suche für mein gemischtes Waren-Geschäft
nebst Baumaterialienhandlung 1 Lehrling mit guten Schulkenntnissen und
schöner Handschrift. Kost und Logis im Hause. Samstags und Feiertage
geschlossen, sofortigen Eintritt. S. Schuster, Hammelburg.." |
Anzeigen der Eisenhandlung Adolf Nussbaum (1889 / o.J.)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. Oktober 1889: "Lehrlingsgesuch! Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. Oktober 1889: "Lehrlingsgesuch!
In meinem Eisenwaren- und Maschinen-Geschäft, welches streng an Sabbat und
jüdischen Feiertagen geschlossen bleibt, suche ich unter günstigen
Bedingungen einen mit den nötigen Vorkenntnissen versehenen Lehrjungen.
Adolf Nußbaum, Hammelburg in Bayern " |
| |
 Anzeige
von Adolf Nussbaum: "Nicht zu übersehen! Neu eingetroffen: Anzeige
von Adolf Nussbaum: "Nicht zu übersehen! Neu eingetroffen:
Kinder-Chaisen
in großer Auswahl zu staunenswert billigen Preisen.
Adolf Nussbaum,
Eisenhandlung am Marktplatz"
(Anzeige erhalten von Petra Kaup-Clement) |
| |
Gedenktafel am
Nachfolgegebäude des Hauses
der Eisenhandlung Nussbaum
(Fotos: Elisabeth Böhrer,
Aufnahmedatum: 1.1.2012) |
 |
 |
|
zur
Familiengeschichte siehe
unten bei den Literaturangaben |
Inschrift der
Tafel (links am Gebäude zu erkennen): "Hier befand sich bis 1936 die
jüdische
Eisenwarenhandlung Adolf Nussbaum. Das Anwesen und die Familie
Nussbaum wurden
Opfer des Nationalsozialismus" |
Heiratsanzeige von Adolf Meyer und
Melanie geb. Nussbaum (1903)
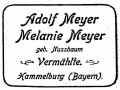 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Juli
1903: Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Juli
1903:
"Adolf Meyer - Melanie Meyer geb. Nussbaum.
Vermählte. Hammelburg (Bayern)." |
Anzeige von Max Schild - auf
Stellensuche (1923)
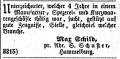 Anzeige
in "Der Israelit" vom 23. Juni 1923: "Unterzeichneter, welcher vier Jahre in
einem Manufaktur-, Spezerei- und Kurzwarengeschäfte tätig war, sucht,
gestützt auf gute Zeugnisse, Stelle, gleichviel welcher Branche. Anzeige
in "Der Israelit" vom 23. Juni 1923: "Unterzeichneter, welcher vier Jahre in
einem Manufaktur-, Spezerei- und Kurzwarengeschäfte tätig war, sucht,
gestützt auf gute Zeugnisse, Stelle, gleichviel welcher Branche.
Max Schild pr. Adresse S. Schuster, Hammelburg. " |
Verlobungsanzeige von Ella geb. Straus und Kurt
Steinkritzer (1924)
Hinweise: Ella Steinkritzer geb. Strauss (geb. 1897 in Hammelburg)
wurde 1942 von Würzburg aus deportiert und ist umgekommen (nähere Umstände unbekannt).
Gleichfalls wurde ihre Tochter Margot (geb. 1926 in Hammelburg) 1942 von
München aus in das Ghetto Piaski deportiert; sie war seit Anfang September 1940
in München, zuletzt als Hilfsarbeiterin im jüdischen Arbeitslager Lohhof. Sie
ist gleichfalls umgekommen (nähere Umstände unbekannt). Margot sowie ihre
Brüder Horst (geb. 1925 in Hammelburg) und Klaus (geb. 1929 in Hammelburg)
waren 1939 einige Zeit untergebracht im Israelitischen Waisenhaus
"Wilhelmspflege" in Esslingen am Neckar, vgl. J. Hahn: Jüdisches
Leben in Esslingen. 1994 S. 505. Nach den Dokumenten von Yad Vashem
(Gedenkblätter) sind auch Horst und Klaus Steinkritzer
umgekommen.
 Anzeige
in der "CV-Zeitung" vom 19. Juni 1924: Anzeige
in der "CV-Zeitung" vom 19. Juni 1924:
"Ella Straus - Kurt Steinkritzer.
Verlobte.
Hammelburg (Bayern) - Parchim (Mecklenburg).
Pfingsten 1924." |
| |
| Ergänzung: die Familie des
Webmasters von "Alemannia Judaica" stammt aus Hammelburg: Seite
zum "Haus Hahn" in Hammelburg. Dem Webmaster liegen die
Tagebücher seiner Großmutter Paula (Pauline) Hahn geb. Schwarz
(1887-1956) vor. Darin ist auch einmal Frau Steinkritzer genannt. Paula
Hahn traf sie am Bahnhof in Hammelburg, wo vermutlich beide Frauen auf die
Rückkehr ihrer Männer von der Arbeit gewartet haben. |
 Tagebucheintrag
von Paula Hahn am 1. November 1927: "Dieser Allerheiligen-Tag hatte
einzig schönes Wetter. Das Kind (gemeint der im 17. Mai 1926 geborene
Joachim Hahn, Vater des Webmasters) hatte recht schlechte Nacht. Vielleicht
30 x Licht gemacht, dann wieder zu mir genommen, trotzdem war es nichts...
In der Frühe lange mit dem Kinde ausgefahren, erst Richtung Fuchsstadt,
wo eine herrliche Morgensonne lag. Dann zur Bahn, um Max abzuholen, er kam
aber nicht. Auf der Post Karte von Engelbert mit der Nachricht des
gebrochenen Armes der Kleinen. Ich ging gleich zu Mary, es berichten, die
andern Tages nach Kleinkahl wollte. Auch am Abend kam Max nicht, ich war
an der Bahn. (Frau Steinkritzer)." Tagebucheintrag
von Paula Hahn am 1. November 1927: "Dieser Allerheiligen-Tag hatte
einzig schönes Wetter. Das Kind (gemeint der im 17. Mai 1926 geborene
Joachim Hahn, Vater des Webmasters) hatte recht schlechte Nacht. Vielleicht
30 x Licht gemacht, dann wieder zu mir genommen, trotzdem war es nichts...
In der Frühe lange mit dem Kinde ausgefahren, erst Richtung Fuchsstadt,
wo eine herrliche Morgensonne lag. Dann zur Bahn, um Max abzuholen, er kam
aber nicht. Auf der Post Karte von Engelbert mit der Nachricht des
gebrochenen Armes der Kleinen. Ich ging gleich zu Mary, es berichten, die
andern Tages nach Kleinkahl wollte. Auch am Abend kam Max nicht, ich war
an der Bahn. (Frau Steinkritzer)." |
Todesanzeige für Bertha David geb. Sondhelm
(1928)
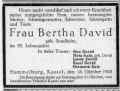 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 19. Oktober 1928: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 19. Oktober 1928:
"Heut Nacht entschlief nach schwerer Krankheit meine innigstgeliebte
Frau, unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin
und Tante
Frau Bertha David geb. Sondhelm im 55. Lebensjahre.
In tiefer Trauer: Max David Meta Katz geb. David Jakob
David Rosel David Hermann Katz
Hammelburg, Kassel, den 18. Oktober 1928.
Die Beerdigung findet am Sonntag, dem 21. Oktober, vom Israelitischen
Friedhof aus statt." |
Verlobungsanzeige von Enny
Hamburger und Benno Hofmann (1935)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. August 1935: "Statt Karten G"tt sei gepriesen! Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. August 1935: "Statt Karten G"tt sei gepriesen!
Enny Hamburger - Benno Hoffmann
Verlobte
Berlin Landgrafenstraße 18a / Hammelburg (Ufr.)
Berlin, Kleiststraße 14 /
Königshofen im Grabfeld." |
Weitere Dokumente jüdischer Gewerbebetriebe
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)
Postkarte von Adolf
Nussbaum
aus Hammelburg (1888) |
 |
 |
| |
Am 31. August 1888
von Adolf Nussbaum aus Hammelburg an die
Eisenhandlung Eisenheimer in
Schweinfurt verschickte Postkarte |
| |
|
|
Postkarte von Simon
Oppenheimer
aus Hammelburg (1887) |
 |
 |
| |
Am 1. April 1887
von Simon Oppenheimer aus Hammelburg an die
Eisenhandlung Eisenheimer in
Schweinfurt verschickte Postkarte |
| |
|
|
Karte von
Bonheim Katz
aus Hammelburg (1889) |
 |
 |
| |
Die Karte wurde
verschickt am 6. März 1889 von Hammelburg an die Eisenhandlung
Eisenheimer in Schweinfurt. Absender war der Weinhändler Bonheim
Katz (1853-1915).
Es geht um eine Verschiebung eines Liefertermins einer bestellten Waage,
da die
Vorarbeiten (Anbringen eines Fundaments) durch witterungsbedingte
Umstände nicht
termingerecht fertiggebrachten werden konnten. Zu Familie Katz siehe
mehr unter
www.hammelburger-album.de/index.php/lebensweise/112.html |
| |
|
|
Postkarte
mit dem Schuhgeschäft
Bernhard Stühler am Marktplatz (1908) |
 |

|
.Die
historische Ansichtskarte von 1908 zeigt rechts das Haus und
Schuhgeschäft von Bernhard Stühler. Das Haus war bis 1893 im Besitz des
jüdischen Goldschmiedes Jean Bergen, danach wurde es von Bernhard Stühler
übernommen. Am 8. Mai 1936 wurde das Schuhgeschäft Bernhard Stühler –
Inhaber inzwischen August Stühler - in Folge der 1936 durchgeführten
sogenannten "Arisierung" verkauft. Quellen:
http://www.victims-of-holocaust-hammelburg.de/arisierung.html
http://www.hammelburger-album.de/index.php/stadtbild/innerhalb-der-alten-stadtmauer/marktplatz/die-haeuser-um-den-marktplatz
Links gegenüber steht das "Haus Hahn" mit dem Geschäft des Seilermeisters
Johann Hahn (Urgroßvater vom Joachim Hahn, des Webmaster von "Alemannia
Judaica"),
http://www.hammelburger-album.de/index.php/lebensweise/juedisches-leben/das-haus-hahn.
|
Weitere
Erinnerungen an jüdische Personen aus Hammelburg
Sonstiges
Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert:
Grabstein in New York für Leon Mayer
aus Hammelburg (1820-1896)
Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn.
 |
Grabstein für "Leon Mayer
Born in Hammelburg
Bavaria
July 20, 1820
Died in New York City
Oct. 7,1896". |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge bestand bereits im Mittelalter, die erste Nennung liegt
jedoch erst aus dem Jahr 1570 vor. Damals berichtete der "Rat der Stadt
Hammelburg" an den Landesherrn, dass 100 Juden in der Stadt leben und diese
auch eine Synagoge besitzen würden, die nach der Judenordnung von 1560
eigentlich gar nicht bestehen dürfte. Einige Zeit nach der Ausweisung der
Hammelburger Juden 1671, die zur Schließung der Synagoge führte, befand
sich auf ihren Grundstück neben dem inzwischen baufälligen Synagogengebäude
ein Schweinestall, worüber sich die nach 1701 wieder zugezogenen Juden 1718
bei der Regierung beschwerten. Damals war geplant, auf dem Grundstück der
früheren Synagoge eine Kapelle zu erstellen. Dazu kam es jedoch nicht: 1768
konnten auf dem Grundstück bzw. über den Grundmauern der alten Synagoge die
inzwischen wieder zehn jüdischen Familien - gegen den Widerstand der
christlichen Bevölkerung - eine neue Synagoge bauen.
Aus der Chronik der Stadt Hammelburg
von Heinrich Ullrich, 1. Auflage 1956 zur Geschichte der Synagoge Hammelburg:
(…) Im Januar 1671 wurde Bernhard Gustav, Markgraf von Baden, zum Fürstabt des Fuldaer Hochstifts erwählt. Dieser Herr war kein Freund der Israeliten. Bereits zwei Monate nach seinem Amtsantritt, unterm 24. März 1671, erließ er ein Mandat, welches die Ausweisung der Juden aus dem Fuldaer Gebiet verfügte (…) Als am 5. Juli 1671 der Fürstabt den Grundstein zur Antoniuskapelle auf Kloster Altstadt legte, dankte ihm Pater Quardian namens der Stadt Hammelburg für die Austreibung der Juden. Der Hammelburger Ziegler Johann Thein fand dies Geschehen wichtig genug, es auf einer Dachziegel zu verewigen mit folgenden Worten:
Diese Ziegel ist gemacht in diesem Jahr, das der Juden ihr Auszug war. 1671.
(…) Mit dem Hinscheiden des Fürstabtes am 24. Dezember 1677 geriet die antijüdische Einstellung der Fuldaer Regierung ins Wanken und langsam begannen sich Juden wieder in das Geschäftsleben des Landes Fulda einzuschalten (…)
Im beginnenden 18. Jahrhundert ließen sich die Juden Manuel und Lömmel in der Stadt Hammelburg nieder.
Unterm 23. März 1718 klagten die neu zugezogenen Israeliten bei der Regierung, dass auf dem Platz der früheren Judenschule ein Schweinestall stehe. Der Hammelburger Amtsverwalter Weishahn klärte die Sache dahin auf, dass nach der Judenaustreibung seinerzeit die frei gewordenen Häuser von den Bürgern gekauft worden seien, also auch die Judenschule. Jetzt befinde sich daselbst
'öd und wüst Mauerwerk im Quadrat 6 Ruten 20 Schuh'. Man habe vor, eine Kapelle dahin zu stellen.
Ein Kirchlein wurde zwar nicht auf dem erwähnten Platz erbaut, aber etwa 50 Jahre später (1768) erhob sich daselbst wieder eine neue Synagoge (…) Die Hammelburger Judenschaft vermehrte sich langsam aber stetig. Im Jahr 1762 wohnten wieder zehn Judenfamilien in der Stadt. Damit war die Grundlage geschaffen, eine Synagoge zu errichten. Sie sollte auf dem Platz der früheren zu stehen kommen. Trotzdem nur noch ruinöses Grundgemäuer vorhanden war, sprachen die Juden mit ihrem Baugesuch nur von der Reparierung des alten zum Einsturz geneigten Bethauses.
Als jedoch das Bauvorhaben bekannt wurde, erhob die Bürgerschaft dagegen scharfen Einspruch. Die Juden seien gesonnen, einen prächtigen Bau zu erstellen, weil sie noch zahlreicher werden wollten und
'dann denen armen Christen die Nahrung nicht nur äußerst schwächen, als vielmehr vor dem Maul hinweg ziehen wollten.' Durch den jüdischen Gottesdienst sodann,
'der mit fast unmenschlichem Geschrei und Getön' verknüpft sei, würden die umwohnenden Bürger namentlich in ihrer Hausandacht sehr gestört' (…).
Diese Darlegung der Hammelburger Bürgerschaft scheint die Regierung zu Fulda lächelnd ad acta gelegt zu haben. Denn tatsächlich ward die Synagoge erbaut und diente ihren Zwecken bis in die Neuzeit. |
Unweit der Synagoge lag an der Dalbergstraße die
ehemalige jüdische Schule. Im Anschluss an die Synagoge gab es auch eine Mikwe
(eine frühere Mikwe (um 1604 lag im Bereich des Niedertors).
 Den
verheerenden Stadtbrand von Hammelburg am 25. April 1854 (siehe Abbildung
links; Quelle: www.hammelburger-album.de),
dem drei Viertel der historischen Gebäude der Stadt zum Opfer fielen,
überstand die Hammelburger Synagoge "wie durch ein Wunder"
unversehrt, obwohl der Brand vom "Viehmarkt" ausging, d.h. ganz in der
Nähe der Synagoge seinen Anfang nahm und sich rasend schnell ausbreitete. Das
Unversehrtbleiben der Synagoge könnte darin begründet liegen, dass jüdische
Familien an diesem Tag nicht bei der Markusprozession außerhalb der Stadt im
Kloster Altstadt waren, sondern anders als die christlichen Einwohner sofort
beginnen konnten, das um sich greifende Feuer zu löschen und sein Vordringen
zur Synagoge zu verhindern (Informationen zu diesem Abschnitt von Petra
Kaup-Clement). Den
verheerenden Stadtbrand von Hammelburg am 25. April 1854 (siehe Abbildung
links; Quelle: www.hammelburger-album.de),
dem drei Viertel der historischen Gebäude der Stadt zum Opfer fielen,
überstand die Hammelburger Synagoge "wie durch ein Wunder"
unversehrt, obwohl der Brand vom "Viehmarkt" ausging, d.h. ganz in der
Nähe der Synagoge seinen Anfang nahm und sich rasend schnell ausbreitete. Das
Unversehrtbleiben der Synagoge könnte darin begründet liegen, dass jüdische
Familien an diesem Tag nicht bei der Markusprozession außerhalb der Stadt im
Kloster Altstadt waren, sondern anders als die christlichen Einwohner sofort
beginnen konnten, das um sich greifende Feuer zu löschen und sein Vordringen
zur Synagoge zu verhindern (Informationen zu diesem Abschnitt von Petra
Kaup-Clement).
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge vollständig zerstört. Am Morgen des 10. November 1938, um ca. 9 Uhr, wurde die Synagoge in der Dalbergstraße 57 durch
"kontrollierte" Feuerlegung im Inneren angezündet, geschwärzt und
"ausgeräuchert". Am darauffolgenden Morgen, am 11. November 1938, wurde die am Vortag angebrannte Inneneinrichtung mit Äxten und Beilen barbarisch zertrümmert und zerschlagen. Bei der Aktion waren SA-Mitglieder aus Hammelburg und ältere Mitglieder der HJ aus Untererthal beteiligt. Das geschändete Synagogenanwesen war bis 7. April 1945 in den Händen der Partei (NSDAP) und der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt). Von diesen wurde in der Synagoge ein Schweinestall betrieben.
Quellennachweis: Spruchkammer Hammelburg, Akten von Männern der SA und des NSKK Hammelburg; Staatsarchiv Würzburg.
Nach dem Einmarsch der Amerikaner (7. April 1945) wurde der Betrieb des
Schweinestalles aufgegeben, die Synagoge stand in der Folgezeit über ein Jahr
leer, verfiel und verwahrloste. In diesem Zustand wurde sie 1946 oder 1947 als
Privathaus übernommen. Die noch vorhandene Inneneinrichtung (Frauenempore u.a.)
blieb zunächst noch bestehen. Erst in den 1960er-Jahren wurde das Innere
der Synagoge vollständig umgebaut.
Über den
Zustand unmittelbar nach dem Krieg gibt ein Dokument aus der Spruchkammer-Akte
Hammelburg Auskunft:
| Dokument von 1946 über
das Synagogengebäude in Hammelburg (erhalten
von Petra Kaup-Clement) |
Staatsarchiv Würzburg -
Spruchkammer-Akte Hammelburg Nr.1011: "Beglaubigte Abschrift - Nr. 402
- Gend.-Station Hammelburg - Lk. Hammelburg, Reg. Bez. Unterfranken.
An das Gendarmerie-Bezirkskommissariat Hammelburg
Betr. Synagoge Hammelburg Hammelburg, 13. März 1946
Die Synagoge in Hammelburg befindet sich in einem trostlosen Zustand. Man kann sie als verwahrlost bezeichnen bzw. als halb verfallen. Während des Krieges wurde sie sogar teilweise als Schweinestall verwendet, es sind heute noch diese Ställe vorhanden. Nutznießer dieser Ställe war der Staat bzw. die Ställe waren von der NSV erstellt.
Die Zerstörung der Synagoge in Hammelburg wurde bei der Judenaktion in Hammelburg vollzogen, wie bis jetzt einwandfrei festgestellt werden konnte. An der Zerstörung sollen sich Mitglieder der SA und
Motor-SA, aber auch Mitglieder der HJ aus Untererthal beteiligt haben. Über die Judenaktion in Westheim und in Untererthal wird nach Erhebungen gesondert berichtet.
gez. Michl Gend.kom." |
Das ehemalige Synagogengebäude ist bis
heute erhalten. Eine Gedenkstätte wurde neben dem Synagogengebäude
eingerichtet.
Lage der ehemaligen Synagoge: Dalbergstraße
57/57A
Fotos
Historisches Foto:
(Quelle: © Museum der Stadt Mörfelden-Walldorf; www.vor-dem-holocaust.de
unter "Mörfelden")

|
|
Heinz Neu aus Mörfelden in den
Ferien in Hammelburg - Gruppenfoto um 1935 vor der Synagoge in Hammelburg.
Heinz Neu verbrachte häufig seine Sommerferien bei seinem Onkel Heinrich
Schott und dessen Familie in Hammelburg. Heinz ist links vorne im Bild und hält seine kleine Cousine
Sonja Schott an der Hand.
In der Bildmitte ist Arnold Samuels (vor Emigration Name: Kurt Samuel,
geb. 1923) zu sehen, links stehend mit Brille sein Bruder Gerhard Samuel(s)
(geb. 1921), rechts außen Alfred Stühler (geb. 1923). Alfred Stühler
und Arnold Samuels waren Ende April 2013 zu Besuch in Hammelburg (siehe
Presseberichte unten). Der von Heinz Neu benannte Onkel Heinrich Schott
wohnte mit seiner Frau Sophie und der noch kleinen Tochter Sonja in
der Kissinger Straße 7 in Hammelburg. Die Mutter von Heinz Neu war
Henriette Neu geb. Schott, Schwester von Heinrich Schott. Die enge
Verbindung zu den Familien Samuel und Stühler kam sicher dadurch
zustande, dass diese Familien auch in der Kissinger Straße (Haus Nr. 8
und 31) in Hammelburg wohnten.
Das Foto ist im ehemaligen Innenhof der Synagoge
aufgenommen, direkt vor dem Eingang für die Männer in den Betsaal (siehe
im Hintergrund links, vgl. Foto von 2013 unten). Die hohen Fenster des
Betsaales sind heute nicht mehr vorhanden (vgl. unten Foto von
2013).
Derzeit noch nicht identifiziert sind auf dem Foto das Mädchen rechts und
der Junge links dahinter.
(die Informationen zu den abgebildeten Personen stammen von Petra
Kaup-Clement) |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 16.8.2003)
 |
 |
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge
von Südosten |
Blick von Osten - der
Toraschrein befand sich
zwischen den Fenstern im Erdgeschoss |
| |
|
 |
 |
| Gedenkstätte |
Inschrift zum Gedenken an die
ehemalige Synagoge |
| |
|
Gedenken an der
Synagoge beim "Ersten Ökumenischen Jugendkreuzweg aller Hammelburger
Schulen" am 11.4.2003
(Quelle: hier
anklicken) |
 |
 |
| Schülerinnen und Schüler des
Frobenius-Gymnasiums mit Texten und Bildern zu den Themen "Rassismus,
Ausgrenzung und Krieg" |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
November
2008: Hirschenbergers Genisa" - Ausstellung vom 1. - 30. November
2008
Sonderausstellung im Stadtmuseum Herrenmühle in
Hammelburg - erarbeitet und zusammengestellt von Cornelia und Michael Mence
(Hammelburg) |
| |
| März
2010: Aufruf des Geschichtskreises
Hammelburg |
Artikel in der
"Main-Post" vom 22. März 2010 (Artikel):
"HAMMELBURG. Wer erinnert sich an Ella Steinkritzer? Geschichtskreis sucht Zeitzeugen.
(si) Zeitzeugen sucht der Geschichtskreis, die über deportierte jüdische Kinder aus Hammelburg berichten können. Ihr Schicksal ist Thema beim nächsten Treffen des Geschichtskreises am Freitag, 26. März, um 19.30 Uhr im Musikerheim.
Nach Recherchen von Petra Kaup-Clement war das jüngste Kind aus Hammelburg fünf Jahre alt, als es 1942 im Kinder-KZ von Majdanek den Tod fand. Es war Benjamin Straus, der 1937 in Hammelburg geboren wurde. Auch dessen Vater, Julius Straus, der von 1930 bis 1938 ein Geschäft in der Kissinger Straße 17 betrieb, sei 1942 deportiert und im KZ Auschwitz ermordet worden.
Bei dem Treffen des Geschichtskreises wird auch das Lebensschicksal der jüdischen alleinerziehenden Mutter Ella Steinkritzer und ihrer drei Kinder, die Opfer des Holocaust wurden, vorgestellt. Die 1897 in Hammelburg geborene Jüdin lebte im Schul- und Armenhaus der jüdischen Gemeinde Hammelburg in der heutigen Dalbergstraße 63. Nach der Reichspogromnacht musste Ella Steinkritzer die Stadt Hammelburg verlassen.
Der Geschichtskreis Hammelburg sucht Zeitzeugen, die sich an die Familie und an das Geschäft Julius Straus in der Kissinger Straße 17 erinnern können, ebenso an Ella Steinkritzer und ihre Kinder.
Diskussion über Stolpersteine. Vor dem Hintergrund dieser Lebensschicksale soll im Hammelburger Geschichtskreis die Verlegung von Stolpersteinen in Hammelburg erneut diskutiert werden. In vielen Städten Deutschlands sind inzwischen solche Erinnerungssteine an die jüdischen Mitbürger verlegt worden. Sie sollen dazu anregen, das Einzelschicksal eines Menschen kennenzulernen und nicht zu vergessen.
Jugendliche können für jeweils einen Stein und für ein Lebensschicksal eine so genannte innere Patenschaft übernehmen und ihren Stolperstein in der Stadt oder im Ortsteil immer wieder neu aufsuchen.
Die Aktion Stolpersteine wurde vom Kölner Künstler Günter Demnig begründet. An 530 Orten in Europa gibt es inzwischen Stolpersteine. In der näheren Region finden sich Stolpersteine in Bad Kissingen, Würzburg und Aschaffenburg. Die Verlegung dieser Erinnerungssteine beruht auf Spendenbasis, sie kostet die Kommune kein Geld. Der Stadtrat muss allerdings seine baurechtliche Zustimmung geben. Ein Stolperstein kostet 95 Euro.
Der Geschichtskreis Hammelburg stellt bei seinem Treffen am Freitag auch eine Namensliste von jüdischen und nichtjüdischen Opfern des Nationalsozialismus aus Hammelburg, Westheim und Untererthal vor, für die Stolpersteine verlegt werden könnten." |
| |
| April
2010: "Stolpersteine" oder
eine Gedenktafel in Hammelburg ? |
Artikel von Katja
Glatzer-Hellmond in der "Main-Post" vom 13. April 2010 (Artikel):
"HAMMELBURG - Jeder Stein ein eigenes Schicksal - Hammelburger Geschichtskreis möchte Stolpersteine für zwei jüdische Familien verlegen lassen.
Zum Gedenken an jüdische Familien und ihre Schicksale im Dritten Reich hat der Hammelburger Geschichtskreis angeregt, Stolpersteine verlegen zu lassen. Stolpersteine sind Pflastersteine aus Messing, die mit dem Namen der Betroffenen vor deren letzten freiwilligen Wohnsitz eingelassen werden.
Die Aktion Stolpersteine wurde von dem Künstler Günter Demnig ins Leben gerufen. In 450 Städten der Bundesrepublik wurden diese Steine schon verlegt. Auch in Hammelburg würde Demnig dies auf Anfrage des Geschichtskreises angehen, berichtete Petra Kaup-Clement beim jüngsten Treffen des Kreises. Als Termin habe man den 22. September im Visier. Eine Anfrage an den Stadtrat, der die Baugenehmigung erteilen müsste, sei bereits gestellt.
Möglich wären drei Stolpersteine für die Familie Julius Strauss in der Kissinger Straße 17 und vier Stolpersteine für die Familie Steinkritzer in der Dalbergstraße 55/57, so
Kaup-Clement. Die Schicksale beider Familien standen im Mittelpunkt des Geschichtskreistreffens.
Geschäfte zwangsliquidiert. Julius Strauss eröffnete am 12. Januar 1930 ein Textilgeschäft in der Kissinger Straße 17, dort, wo vorher der jüdische Kaufmann Ferdinand Nussbaum gewohnt hatte. Er wurde Nachbar der damaligen Gastwirtschaft und Bäckerei Kron (heute Bäckerei Schwab) und des
'Kohle-Schusters', des jüdischen Bauwaren- und Kohlehändlers Siegfried Schuster. Von 1936 an wurden die meisten jüdischen Geschäfte von der NSDAP-Gauleitung zwangsliquidiert, Julius Strauss aber konnte sich bis zur Reichspogromnacht vor Ort halten.
In der Nacht auf den 11. Novembers 1938 wurde die Inneneinrichtung seines Geschäftes völlig zerschlagen. Der kleine Sohn Benno war zum Zeitpunkt der Reichspogromnacht ein Jahr alt.
'Die Judenfrauen flüchteten mit ihren Kindern durch die Straßen der Stadt. Es war ein schauriger
Anblick', erinnert sich eine Zeitzeugin. Strauss kam ins Hammelburger Gefängnis und musste dort die Zwangsenteignung unterschreiben. Nach der Haftentlassung musste er Fenster und Inneneinrichtung der Wohnung und des Geschäfts auf eigene Kosten reparieren und alle Wertgegenstände abliefern. Versicherungsansprüche gingen verloren und an das Finanzamt musste eine hohe Strafsteuer gezahlt werden.
Das Haus in der Kissinger Straße 17 ging 1939 in den Besitz der Stadt über, die es in private Hände weiter veräußerte. Die Familie Strauss verließ Hammelburg vermutlich im Frühjahr 1939 und floh nach Frankfurt am Main. 1942 wurde Benno Strauss im Alter von fünf Jahren zusammen mit seiner Mutter Hanna von dort aus nach Majdanek (Lublin/Ostpolen) deportiert. Julius Strauss kam zur selben Zeit im Alter von 67 Jahren nach Auschwitz und wurde dort ermordet.
Auch das Schicksal einer zweiten jüdischen Familie machte die Zuhörer betroffen. Ella
Steinkritzer, geborene Straus, erblickte am 16. Februar 1897 in Hammelburg das Licht der Welt. Sie war das jüngste Kind von Moshe und Karolina Straus, die seit Ende des 19. Jahrhunderts am Marktplatz 4 (heute Marktplatz 14) ein Haus und Geschäft innehatten. Ein Bruder von Ella Steinkritzer war der angesehene Volksschullehrer und Gemeinderat von Westheim, Julius Straus.
Allein und besitzlos. Ella Straus heiratete 1924 den jüdischen Kaufmann Kurt
Steinkritzer, der aus Parchim (heute Neubrandenburg) stammte. Das Ehepaar übernahm das alteingesessene Geschäft
'Moses Straus' am Marktplatz und bekam die drei Kinder Horst, Margot und Klaus. Das Geschäft lief jedoch schlecht, so dass es 1928 verkauft wurde. Kurt Steinkritzer trennte sich von seiner Frau und ließ die Familie in Hammelburg zurück.
Die besitzlose Mutter war nun ganz auf die Hilfe der jüdischen Gemeinde angewiesen. In der Judengasse 55 (heute Dalbergstraße 55) bekam Steinkritzer zwei Zimmer zugewiesen, erinnern sich Zeitzeugen. Bis 1936 durften ihre Kinder die städtische Volksschule besuchen, danach wurden die beiden Buben ins jüdische Kinderheim Wilhelmspflege in Esslingen eingewiesen. Im September 1938 folgte auch Tochter Margot.
Ella Steinkritzer erlebte die Pogromnacht in Hammelburg. Nachdem der jüdische Religionslehrer Hermann Mahlermann und der Gemeindevorsteher Julius Mantel verhaftet worden waren und Zwangsenteignung der Häuser und Liegenschaften der jüdischen Gemeinde anstand, hatte sie in Hammelburg keine Beschützer mehr. Sie musste nach Würzburg umziehen, wo sie von der dortigen jüdischen Gemeinde betreut wurde. 1939 holte Steinkritzer ihre Kinder dorthin.
Die 17-jährige Margot wurde 1941/42 zur Zwangsarbeit in ein Arbeitslager nach München verpflichtet. Die gesamte Familie Steinkritzer wurde 1942 von verschiedenen Orten aus deportiert (Warburg, München, Fürth). Nur Vater Kurt Steinkritzer überlebte.
Tendenz geht zur Gedenktafel. Da der letzte freiwillige Wohnsitz von Ella Steinkritzer die heutige Dalbergstraße 55 war, könnten hier vier Stolpersteine entstehen, so die Idee des Geschichtskreises. Es habe bereits eine interne Diskussion im Stadtrat zu dem Thema gegeben, sagte Bürgermeister Ernst Stross auf Anfrage der Main-Post. Die Tendenz gehe aber eher hin zu einer Gedenktafel, auf der alle jüdischen Mitbürger benannt werden könnten. Auch Zentralrats-Präsidentin Charlotte Knobloch, so
Stross, habe sich gegen Stolpersteine ausgesprochen." |
| |
| Mai 2010:
Die Formen des Gedenkens sind in Hammelburg noch
offen und werden weiter diskutiert |
Artikel (auszugsweise zitiert)
in der "Main-Post" vom 11. Mai 2010 (Artikel):
"HAMMELBURG - Stadtrat will das Gedenken breiter aufstellen - Kein Votum für Stolpersteine.
Stolpersteine zur Erinnerung an jüdische Mitbürger, die der Nazi-Herrschaft zum Opfer fielen, wird es in Hammelburg zunächst nicht geben. Der Stadtrat sprach sich gegen eine Initiative des Arbeitskreises Hammelburger Geschichte aus, vor den einstigen Häusern der Holocaust-Opfer Steine mit Namensgravur einzulassen.
Bürgermeister Ernst Stross und verschiedene Stadträte sprachen sich dafür aus, mit dem Arbeitskreis und anderen Geschichtsexperten noch einmal gemeinsam nach Formen des Gedenkens zu suchen. Ziel soll sein, das Erinnern breiter aufzustellen und damit auch den Widerstand und die Zivilcourage politisch Verfolgter in der Region zu würdigen.
Von Arbeitskreis-Sprecher Hermann Bock und Petra Kaupp-Clement nahm Stross ein Gedenkbuch entgegen, das 95 Namen von Opfern des Nationalsozialismus aus Hammelburg, Untererthal und Westheim enthält. Sie stammen aus den Online-Archiven der Gedenkstätte Yad Vashem und dem Bundesarchiv in Koblenz und sollen nach dem Wunsch des Arbeitskreises für jeden einsehbar in der Touristinformation ausliegen.
'Der Arbeitskreis Hammelburger Geschichte leistet bemerkenswertes', sagte
Stross. Er verwies aber auch auf weitere Initiativen, die das Vermächtnis jüdischer Mitbürger angemessen in Erinnerung bringen. Sie reichten von der Taufe des Samuel-Sichel-Platzes und der Einladung von Emigranten bis zur Herausgabe von Büchern. Über weitere Ansätze sollten sich alle Beteiligten verständigen.
... Nachdem manche jüdischen Kultusgemeinden Stolpersteine nicht für die richtige Gedenkform hielten, prüfe man andere Möglichkeiten. Darunter eine Aktualisierung der Gedenktafel im Rathaus.
Stolpersteine könnten heute den Eindruck erwecken, als ob Hausbewohner zu unrecht in den gekennzeichneten Häusern leben. Den Betrachtern fehle häufig der Transfer zum künftigen Umgang mit Minderheiten. Juden, die kein eigenes Haus hatten, würde das Gedenken mit den Stolpersteinen gar nicht zuteil.
'Der Arbeitskreis Hammelburger Geschichte leistet bemerkenswertes'. Für Stolpersteine plädierte dagegen Hermann Bock vom Arbeitskreis Hammelburger Geschichte. Sieben Paten für Steine habe man schon und einen Termin für die Verlegung vor der Dalbergstraße 55 und der Kissinger Straße 17 durch Künstler Günter Demnig (Köln) im September auch schon. Anders als eine Gedenktafel könnte die Stolperstein- Aktion immer weiter fortgeschrieben und dabei von privaten Unterstützern getragen werden. Jugendliche und Schulklassen könnten Paten werden und darüber hinaus eine Online-Präsenz Erklärungen liefern.
'Die Stadt hat keinen Zeitdruck', sprach sich Bürgermeister Stross für einen ausführlichen Dialog zum Thema Gedenken aus. Sie müsse sich nicht von vorneherein nach dem Terminkalender eines Künstlers richten.
Die anwesenden Mitglieder des Arbeitskreises Geschichte bekundeten Interesse an Gesprächen.
'Ja, geht klar', stimmte Hermann Bock zu." |
| |
| Hinweis: Die
Arbeitsgruppe mit der Zielsetzung "Letzte Spuren bewahren" hat
sich auf Grund der Anregung des Stadtrates gebildet. Die Arbeit dieses
Kreises umfasst nicht nur das Gedenken an die Holocaust-Opfer und ist
langfristig angelegt. Auch die Stadtteile von Hammelburg - Westheim und
Untererthal - werden im Rahmen der Arbeit des Arbeitskreises mit
einbezogen. Teil der Arbeit ist die Diskussion über die Formen des
Gedenkens der Holocaustopfer. Dabei werden alle verschiedenen Vorschläge
berücksichtigt, auch die "Stolpersteine". |
| |
Dezember
2010:
Eine Gedenkstätte am
Seelhaus-Platz ist im Gespräch -
"Stolpersteine" in Hammelburg finden in einem Arbeitskreis nur
wenige Befürworter |
Artikel in der "Saale-Zeitung" vom 3. Dezember 2010 (Artikel
aus infranken.de): "An verfolgte jüdische Mitbürger erinnern.
Heimatgeschichte "Letzte Spuren bewahren" heißt der Arbeitskreis, der dem Stadtrat Empfehlungen zum Gedenken an die Judenverfolgung durch die Nazis geben möchte. Unter den verschiedenen Vorschlägen wird zurzeit eine Gedenkstätte am Seelhaus-Platz
favorisiert.
Am Mittwoch traf sich ein knappes Dutzend Interessierter und Engagierter, die zusammen mit Bürgermeister Ernst
Stross, Michael Mence und dessen Ehefrau Cornelia, Kreisheimatpflegerin, mögliche Maßnahmen diskutierten.
Eine für alle Hammelburger Ortsteile akzeptable Lösung wurde speziell für die Ortsteile Untererthal und Westheim gesucht. Der Stadtrat entscheide letztlich, was zu tun sei, betonte
Stross. In jedem Fall sei die Tatsache zu würdigen, dass die verfolgten jüdischen Mitbürger ein wichtiger Teil der Bevölkerung gewesen seien.
Stolpersteine: Wenig Befürworter. Außer dem Platz am Seelhaus, wo früher eine Synagoge stand, waren zuvor noch weitere Plätze in der Diskussion. So zum Beispiel am Haus der Familie Sichel, am Hammelburger Rathaus, am Roten Schloss und am so genannten Schabbes-Gärtchen nahe dem Kreisverkehr am evangelischen Pfarrhaus. Verworfen wurde eine Gedenkstätte am jüdischen Friedhof in Pfaffenhausen.
Auch die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig - im Gehweg eingelassene Pflastersteine mit Namen und Daten der Verfolgten - fanden wenig Befürworter. Schließlich sollten diese nicht mit Füßen getreten werden, war sich der Arbeitskreis einig.
Auf Zustimmung stieß auch der Gedanke, die Gedenktafeln ausschließlich den verfolgten toten und den noch lebenden Juden zu widmen, nicht aber anderen Verfolgten wie Regimegegnern, Homosexuellen oder Sinti und Roma. "Und wir sollten die Namen der Verfolgten nennen", regte Pfarrer Christian Müssig an. Jeder einzelne Mensch sollte in den Erinnerungsprozess genommen werden.
"Man sollte lieber an einem zentralen Ort in Hammelburg statt in verschiedenen Ortsteilen gedenken", meinte auch Altbürgermeister Arnold Zeller, auch wenn die heutigen Stadtteile früher selbstständige Dörfer gewesen seien. "Die Ortsbeauftragten sollten sich jetzt mit den älteren Anwohnern in Verbindung setzen und deren Meinungen darüber einholen", schlug Helmut Scholl vor.
An das jährliche Gedenken zur Reichspogromnacht auf dem Seelhaus-Platz am 9. November erinnerte Arnold Zeller. Vor 15 Jahren habe man klein angefangen und anfangs noch teilweise Widerstand in der Bevölkerung gespürt.
Heutzutage genieße dieser Platz Sensibilität in der Öffentlichkeit, war sich Pfarrer Christian Müssig sicher. Auch dass dort in der Nachbarschaft die Lebenshilfe ein Bauprojekt plane, passe gut zusammen, so Bürgermeister
Stross.
Treffen am 12. Januar. Ein weiteres Thema für die nächste Zusammenkunft des Arbeitskreises "Letzte Spuren bewahren" ist für 12. Januar geplant. Dann wird auch der Frage nachgegangen, wie ein Stadtrundgang zum Thema "Jüdische Geschichte in Hammelburg" gestaltet werden kann." |
| Korrektur-Hinweis zu obigem
Artikel: die Synagoge stand nicht am Seelhaus-Platz; das Gebäude der
ehemaligen Synagoge steht vielmehr bis heute auf dem Grundstück
Dalbergstraße 57/57A. |
| |
| Juli 2011:
Der Arbeitskreis "Letzte Spuren
bewahren" stellt die Pläne für eine Gedenkstätte vor
|
Artikel in der "Saalezeitung" vom 28. Juli 2011 (online auf infranken.de
Artikel):
"An jüdische Opfer der NS-Zeit erinnern
Hammelburg. Geschichte Es war kein leichter Weg. Acht Monate lang wurde diskutiert, gerungen und am Ende doch ein Konsens erzielt. Denn das gemeinsame Ziel, in einer würdigen Form der jüdischen Opfer der NS-Zeit zu gedenken, wog schwerer als unterschiedliche Ansichten in Einzelfragen.
Michael Mence, Leiter des Arbeitskreises "Letzte Spuren bewahren", stellte im Stadtrat jetzt die Pläne für eine Gedenkstätte vor. Er betonte, dass es auch darum gehe, das Engagement des früheren Bürgermeisters Arnold Zeller fortzusetzen.
Findling mit Tafel. Ein Findling soll aufgestellt werden inmitten des Seelhausplatzes. Auf dem großen Stein ist eine Metalltafel vorgesehen mit folgenden Worten: In Erinnerung an die vertriebenen, verschleppten und ermordeten jüdischen BürgerInnen und all die namenlos gebliebenen.
Ferner ist eine Auflistung von 33 Namen geplant mit dem jeweiligen Geburtsjahr und dem Ort, wo die Menschen ums Leben gekommen sind, zum Beispiel Dachau, Auschwitz oder Theresienstadt.
Darüber hinaus wird ein Zitat des französischen Regisseurs Claude Lanzmann über "die Vernichtung" zu lesen sein. Lanzmann hat den neunstündigen Dokumentarfilm
"Shoah" über die Erinnerung an den Holocaust gedreht. Neben den Plänen für die Gedenkstätte hat der Arbeitskreis auch eine Dokumentation erstellt mit den wichtigsten Daten der Biographien der 33 genannten jüdischen Mitbürger.
Bei der Standortsuche sei auch über Samuel-Sichel-Platz, jüdischen Friedhof in Pfaffenhausen, Rathaus, Kellereischloss, Schabbesgärtchen und Hammelburger Friedhof geredet worden, so
Mence. Über "Stolpersteine" mit den Namen der Betroffenen, die ins Pflaster eingelassen werden, als eine andere Form des Gedenkens habe der Arbeitskreis ebenfalls diskutiert.
Wichtigste Kriterien für die Wahl des Standorts seien die Nähe zu einer ehemaligen jüdischen Einrichtung gewesen und eine öffentliche Zugänglichkeit rund um die Uhr.
Diese Bedingungen erfülle der Seelhausplatz, auch sei es dort "ruhig und etwas verträumt". Ein gewichtiges Argument sei natürlich ebenso gewesen, dass dort, wo früher die Synagoge stand, seit vielen Jahren die jährlichen Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht stattfinden.
Was die Form des Gedenkens angeht, "wollten wir etwas finden, was zu uns und Hammelburg passt, zu der Altstadt mit ihren Höfen und Gärten und zu den Weinbergen. Etwas, das die Nähe zu Natur und Scholle ausdrückt", umschrieb
Mence. Ein Findling mit einer Metalltafel erfülle diese Voraussetzungen, er sei "unprätentiös und zurückhaltend, und fest verankert im Boden". Aufgestellt werden solle er mitten auf dem Platz, damit er eine Alleinstellung erhalte und "in den Fokus von Besuchern und Passanten rückt."
Zudem empfiehlt der Arbeitskreis, eine Broschüre in Deutsch und Englisch zu erstellen, die nicht nur die Zeit des Holocausts beschreibt, sondern die gesamte Spanne des Zusammenlebens von Christen und Juden seit dem 13. Jahrhundert.
"Die Broschüren könnten in einem Metallbehälter vor Ort ausgelegt werden und Interessierten zusätzliche Informationen bieten", regte Michael Mence an. Doch das sei noch "Zukunftsmusik". Zunächst sollten die Gedenkstätten errichtet werden, außer in Hammelburg noch in Untererthal und Westheim, die eigene jüdische Gemeinden hatten.
"Nicht überfrachten". Stadträtin Annemarie Fell (BfU/Grüne) schlug vor, auf der Tafel den Ort des Todes mit einem Hinweis wie KZ zu ergänzen, für den Fall, dass in nachfolgenden Generationen das Wissen um Auschwitz oder Dachau schwinde. SPD-Fraktionssprecher Reinhard Schaupp entgegnete, Gedenktafeln sollten mit Informationen nicht überfrachtet werden. "So sind sie eher ein Anstoß zum Nachdenken. Wer sich wirklich interessiert, kann den Namen auch
googeln", meinte Schaupp.
Bürgermeister Ernst Stross (SPD) begrüßte das Projekt und sagte die Unterstützung der Stadt zu. Der Bauhof könne sicher bei der Umsetzung helfen.
Bereits am Dienstag, 2. August, wird sich der Arbeitskreis das nächste Mal treffen, und zwar um 18 Uhr im Westheimer GeFiGa-Heim im Raum des Filmclubs. "Alle Ortsbürger und andere Interessierte sind hierzu willkommen und können sich bei der Gestaltung der Westheimer Gedenkstätte einbringen", unterstrich
Mence." |
| |
April/Mai
2013: Besuch ehemaliger jüdischer
Hammelburger
(Artikel erhalten von Petra Kaup-Clement) |
 Artikel
von Arkadius Guzy in der "Saale-Zeitung" vom 29. April 2013:
"Zeitzeugen besuchen die Stadt. Artikel
von Arkadius Guzy in der "Saale-Zeitung" vom 29. April 2013:
"Zeitzeugen besuchen die Stadt.
Geschichte. Sie wurden in Hammelburg geboren, mussten dann aber
fliehen: Alfred Stühler und Arnold Samuels gehören zu den letzten jüdischen
Überlebenden der NS-Zeit...."
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |
| |
 Artikel
von Gerd Schaar in der "Saale-Zeitung" vom 30. April 2013:
"Zeitzeugen erzählen ihr Schicksal. Artikel
von Gerd Schaar in der "Saale-Zeitung" vom 30. April 2013:
"Zeitzeugen erzählen ihr Schicksal.
Holocaust. Geschichte zum Anfassen gab es in der Aula des Hammelburger
Frobenius-Gymnasiums. Die 89- und 90-jährigen Arnold Samuels und Alfred
Stühler berichteten von ihrer Vertreibung aus Hammelburg in ihrer Jugend
und beantworteten Fragen der Schüler..."
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |
| |
Dazu auch der Artikel in der
"Main-Post" (Lokal-Ausgabe Rhön-Grabfeld) vom 9. Mai 2013:
"Bad Königshofen. die Erinnerung wachhalten.
Arnold Samuels war auf dem jüdischen Friedhof (sc. in Bad Königshofen)
am Grab seiner Großeltern..."
Link
zum Artikel - auch eingestellt
als pdf-Datei . |
| |
| Juni
2013: Über die Genisa-Funde in der
ehemaligen Synagoge |
Artikel von Wolfgang Dünnebier
in der "Main-Post" vom 12. Juni 2013: "Im Versteck sicher vor den Nazis.
Fund in der ehemaligen Synagoge: Das älteste erhaltene Blatt ist von 1715 zurück
Jahrzehnte schlummerten das angegraute Stoffbanner mit eingestickten hebräischen Zeichen und Schriften unter dem Dach der ehemaligen Hammelburger Synagoge. Selbst die Verwüstung des Gebäudes durch die Nazis haben die Gegenstände in dem Versteck überstanden.
Bis im Herbst 2012 Gebäudeeigentümer Achim Blum bei Dacharbeiten auf den zunächst geheimnisvoll anmutenden Fund stieß. Ihm war gleich bewusst, dass es sich dabei um etwas Heiliges handeln würde.
Sorgsam verpackte er das Banner und die Papiere in eine Plastikkiste. 'Richtig
gemacht', freut sich Martina Edelmann über den respektvollen Umgang mit den Dokumenten.
Gespannte Erwartung herrschte jetzt in der Blum'schen Wohnküche, als Achim Blum und seine Frau die im Laufe der Zeit teils sehr zerfledderten Stücke präsentierten. Martina Edelmann ist Leiterin des Veitshöchheimer
Genisa-Projektes. Es kümmert sich bundesweit um solche Funde. An ihrer Seite Volkskundlerin Elisabeth Singer.
'Die Genisa-Expertin für den deutschen Raum', sagt Edelmann. Sorgsam breiten die beiden das Stoffbanner aus.
'Ein wunderschönes Exemplar', sagt die Projektleiterin. Durch die Entzifferung bereits weniger der eingestickten
Buchstaben erkennt Volkskundlerin Elisabeth Singer die Bedeutung des Stoffstreifens. Es ist ein Beschneidungswimpel.
Ihn bekamen Jungen mit den besten Segenswünschen zu dem herausragenden Ritual in ihrem Glaubensleben. Beim Buchstabieren erkennen die Forscherinnen sofort, wem die Segenswünsche galten: Abraham Ben Isaak wurde 1844 der rituellen Beschneidung unterzogen. Über seinen bürgerlichen Namen wird das Standesamt Auskunft geben.
Den Atem hält das Forscherinnen-Duo an, als sie ein fast zerfallenes Buch und bedruckte Blätter trennen. Staub liegt in der Luft. Bei dem, was noch heil ist, handelt sich um einen Briefumschlag von Simon Schuster und einen Zeitungsausschnitt von 1889. Bemerkenswert findet Martina Edelmann das Deckblatt zu Fragmenten eines Buch Esther.
'Solche Deckblätter sind selten'. Friedhofsgedichte bis zurück ins Jahr 1715 runden den Fund ab.
'Überschaubar' bewerten die beiden Gutachterinnen die Ausbeute. Den Restaurationsaufwand werde man nach Rücksprache mit der Stadt und dem Denkmalamt in Grenzen halten. Sie bieten an, die Stücke mitzunehmen. Binnen eines Tages würden in Veitshöchheim dafür etwa zehn Inventarnummern erstellt.
Wo die Stücke einen Platz bekommen, ist offen. Martina Edelmann empfiehlt Blums, sie als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Denkbar wäre eine Vitrine zur jüdischen Heimatgeschichte im Stadtmuseum. Oder eine befristete Sonderausstellung, erweitert um Stücke aus der Veitshöchheimer Sammlung.
Rund zehn Genisa-Funde hat man in Veitshöchheim schon komplett ausgewertet. Weitere 60 harren der Untersuchung. Manches ist dort in der Ausstellung zu sehen. Andere mit Papieren unterschiedlichen Zustands lagern auf dem Dachboden in Veitshöchheim.
Es sei wichtig, die Dinge würdevoll zu behandeln, betont Martina Edelmann. Nach jüdischer Tradition dürften Texte, die sich auf Gott beziehen, nicht
weggeworfen werden. Deshalb gab es auch in der Hammelburger Synagoge aus dem Jahr 1768 ein Lager mit solchen Texten.
Wie viele die Zerstörung der Inneneinrichtung mit Äxten und Beilen durch die Nazis 1938 überstanden, ist offen. Als 1952 das Tonnendach beseitigt wurde, blieben die aktuell entdeckten Stücke wohl verborgen. 1990 begann Blum mit der Gestaltung seiner Wohnung. Jetzt widmete er sich Dach und Außenanlage. Hellhörig wurden die Frauen, als Blum berichtete, die zweite Dachhälfte sei noch nicht ausgeforscht.
Weil sie aber leichter zugänglich ist, seien kaum Funde zu warten. Ein Wunsch der
Genisa-Forscherinnen: Ähnliche Funde genauso vorbildlich melden. Falls möglich, zur Bergung auf die Expertinnen warten. Aus der Lage können bisweilen weitere Rückschlüsse gezogen werden."
Link
zum Artikel |
| |
| September
2013: Urenkelin des Viehhändlers Max
Hamburger zu Besuch in Hammelburg |
| Artikel von Arkadius Guzy in der
"Saale-Zeitung"
vom 19. September 2013: "Jüdische
Nachfahrin zu Besuch..." |
| Weiterer Artikel von Roland
Pleier in der "Main-Post" vom 18. September 2013: "Urenkelin
des jüdischen Viehhändlers Max Hamburger auf Spurensuche" |
| |
| November
2014: Gedenktafel am Seelbergplatz |
Artikel von Gerd Schaar in
infranken.de vom 10. November 2014: "Gedenktafel für Hammelburger Juden
Am Seelhausplatz erinnert die Stadt nun namentlich an die jüdischen Bürger, die im Nationalsozialismus vertrieben, verschleppt und ermordet wurden.
Am neu gestalteten Seelhausplatz haben Hammelburger der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 gedacht. Die entsetzlichen Ereignisse hätten auch vor Hammelburg nicht halt gemacht, sagte Bürgermeister Armin
Warmuth. Er sprach vom
'immer währenden Wundmal deutscher Geschichte'. 'Die Vernichtung, das ist nicht so einfach. Es gab einen kleinen Schritt, und einen weiteren Schritt, und noch einen Schritt, Schritt, Schritt. Das ist
Vernichtung.' Dieses Zitat von Claude Lanzmann steht auf der anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht enthüllten Gedenkstele.
Mit ihr erinnern Stadt und Bürgerschaft an die 'vertriebenen, verschleppten und ermordeten jüdischen Bürgerinnen und Bürger und all die namenlos Gebliebenen". Die 33 Namen auf der Tafel bezeugen ergreifende Schicksale: All diese Menschen starben in den Konzentrationslagern von Dachau, Theresienstadt, Auschwitz, Sobibor, Buchenwald und weiteren Orten.
Jüdisches Lied. Bei der Verlesung der Namen wurden Lichter, die zu einem großen Davidstern angeordnet wurden, angezündet. Etwa 100 Leute sangen ein jüdisches Lied mit. Eva-Maria Conrad, Harald Drescher und Andreas
Strehler, allesamt Lehrer des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg, begleiteten die Gedenkstunde musikalisch.
Pastoralreferent Markus Waite sagte: 'Die christlichen Kirchen haben damals oft
geschwiegen.' Der evangelische Pfarrer Robert Augustin zitierte das Alte Testament, in dem die babylonische Gefangenschaft der Israeliten und deren Liebe zu Jerusalem auftaucht.
'Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, kann uns Israel nicht gleichgültig
sein', sagte er.
'Es ist eine Nacht, die in entsetzlicher Weise dokumentiert, wie sich Deutschland endgültig von allen moralischen und ethischen Grundsätzen abgewandt hat", erinnerte Warmuth an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Diese Nacht sei das Signal zum schlimmsten Völkermord gewesen.
'Die Menschlichkeit, die Achtung von Würde und Leben, der Respekt vor dem anderen Glauben und der anderen Kultur - all das galt ab dieser Nacht nicht
mehr', so Warmuth.
Verwüstung der Synagoge. In Hammelburg seien noch am Morgen des 10. November 1938 die Türen jüdischer Bewohner eingetreten worden, berichtete
Warmuth. Das Mobiliar sei umgeworfen, Kleidung und Bettzeug aufgeschlitzt und aus den Fenstern geworfen worden.
'In der ehemaligen Synagoge von Westheim wurde der Toraschrein aufgebrochen. Die Torarollen wurden herausgerissen und zusammen mit anderen jüdischen Kultgegenständen ins Feuer
geworfen', sagte Warmuth.
Auch Untererthal blieb nicht verschont. 'Es waren nicht nur ein paar Glasscheiben in der Reichskristallnacht, die durch ideologisch Verblendete zu Bruch
gingen', meinte Warmuth.
Der Seelhausplatz sei als würdige Erinnerungsstätte der Stadt Hammelburg neu gestaltet. Der Bürgermeister dankte dem Arbeitskreis "Letzte Spuren
bewahren' für die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Stadtgeschichte.
Erste Belege für jüdische Hammelburger konnte Cornelia Mence aus dem Jahr 1287 ausfindig machen. Sie berichtete von Judenverfolgungen im 14. Jahrhundert und dem anschließenden Judenschutz unter dem Kloster Fulda, der bis 1671 andauerte. Dann habe der damalige Fürstabt Joachim Graf von Gravenegg alle Juden aus dem Hochstift vertrieben.
Die ehemalige Synagoge am Seelhausplatz sei schon für das Jahr 1570 nachweisbar. Als normale Staatsbürger seien die Juden nach der Säkularisation (1806) in ganz Bayern integriert worden. Diese Integration habe bis 1871 gedauert. 23 jüdische Männer seien Soldaten im ersten Weltkrieg gewesen, wovon drei auf dem Schlachtfeld starben.
'Die Dalbergstraße hieß bis in die 1930er Jahre noch Judengasse', erinnerte
Mence."
Link
zum Artikel (mit Fotos) |
| |
|
November 2017:
Gedenkfeier zur Erinnerung an den
Novemberpogrom 1938 |
Artikel von Sigismund von
Dobschütz in der "Main-Post" vom 12. November 2017: "Hammelburg. 33
Lebenslichter zum Gedenken
Zur Erinnerung an die Pogromnacht im November 1938 trafen sich zahlreiche
Hammelburger zu einer Gedenkveranstaltung an der ehemaligen Synagoge.
Fast hundert Einwohner Hammelburgs gedachten am Freitag der Pogromnacht von
1938 und der späteren Deportation und Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger.
Die Stadt Hammelburg sowie die beiden christlichen Kirchengemeinden hatten
wie jedes Jahr zur offiziellen Gedenkstunde auf dem Seelhausplatz nahe der
früheren Synagoge eingeladen. Gemeinsam gesungene Lieder wurden von den
Musikerinnen Klara Schlereth (Flöte), Johanna Kamm und Susanne Hähnlein
(beide Akkordeon) instrumental begleitet. Bürgermeister Armin Warmuth (CSU)
erinnerte an die in ganz Deutschland vom Nazi-Regime organisierten Pogrome
gegen Juden in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938, in der SA-Horden und
etliche Mitläufer jüdische Geschäfte und Wohnhäuser zerstörten und Synagogen
schändeten. Die zynische Bezeichnung der Nazis für diese Geschehnisse als
'Reichskristallnacht' wegen der unzähligen zerbrochenen Fensterscheiben habe
sich bis in unsere Zeit gehalten und sei erst vor wenigen Jahren durch
'Pogromnacht' ersetzt worden.
Synagogen brannten. In Hammelburg begann es erst am 10. November
gegen 10 Uhr, berichtete der Bürgermeister: 'Türen zu jüdischen Wohnungen
wurden eingetreten und das Mobiliar umgeworfen. Kleidungsstücke und Bettzeug
wurden aufgeschlitzt und teilweise aus dem Fenster geworfen.' Schon zuvor
war die Synagoge (Dalbergstraße 57) in Brand gesteckt worden. Am Morgen des
11. November wurde deren verkohlte Inneneinrichtung von SA-Mitgliedern
zertrümmert. In der Westheimer
Synagoge wurden die Thorarollen aus dem Thoraschrein gerissen und mit
anderen Kultgegenständen ins Feuer geworfen. 'Auch in
Untererthal verwüstete man Wohnungen
jüdischer Mitbürger und die Inneneinrichtung der Synagoge', zählte Warmuth
weiter auf.
Viele sahen einfach weg. 'Auch wenn es Menschen gab, die mit Abscheu
und Entsetzen reagierten oder manchmal sogar den Opfern beistanden',
ergänzte der Bürgermeister, 'so gab es doch viele, allzu viele, die einfach
wegsahen.' Gerade in Erinnerung dieser Verbrechen dürfe man heute nicht
dulden, 'dass Flüchtlingsunterkünfte in Brand gesteckt, wieder
Fensterscheiben eingeworfen und Asylsuchende, Politiker oder Journalisten
bedroht oder verfolgt werden. Wir dürfen nicht wegschauen, wir müssen uns zu
Wort melden, wenn humanitäre und demokratische Werte mit Füßen getreten
werden.' Die heutige Generation sei nicht verantwortlich für die Taten der
Vergangenheit, schloss Bürgermeister Warmuth seine Gedenkansprache. 'Aber
wir müssen uns dieser Vergangenheit immer wieder stellen und Verantwortung
dafür übernehmen, dass wir und uns Nachfolgende daraus Lehren ziehen.'
Zur Erinnerung an die 1942 deportierten 33 jüdischen Mitbürger wurden von
Teilnehmern der Gedenkfeier deren Namen mit stichwortartigen Angaben zur
Person vorgelesen, während auf dem Platz 33 Lebenslichter auf einem
hölzernen Davidstern entzündet wurden. 'Für unsere beiden christlichen
Kirche ist es selbstverständlich, an dieser Gedenkfeier teilzunehmen',
schloss sich der evangelische Stadtpfarrer Robert Augustin mit mahnenden
Worten an. 'Jesus war Jude. Und es waren Christen, die sich damals schuldig
gemacht haben.' Augustin erzählte die Geschichte von Kain und Abel und
setzte diesen biblischen Brudermord als Gleichnis für die organisierte und
systematische Ermordung der Juden während der Nazi-Herrschaft. Sein
katholischer Amtsbruder, Pastoralreferent Markus Waite, der die Organisation
der Gedenkfeier übernommen hatte, sagte abschließend, der sechs
millionenfache Brudermord 'ist eine Schuld, die wir nicht tragen können,
aber die wir bereuen können.'"
Link zum Artikel |
| |
|
Februar 2019:
Beteiligung am DenkOrt Aumühle
https://denkort-deportationen.de/
|
Artikel von Isolde Krapf in der
"Main-Post" von 8. Februar 2019: "Bad Kissingen. Warum die Erinnerung
wichtiger denn je ist.
Die Würzburger Initiative zum Gedenken an die 2069 deportierten Juden aus
Unterfranken hat in den vergangenen Jahren Kreise gezogen. Es fanden vor Ort
etliche Gedenkveranstaltungen statt. So machten sich zum Beispiel im Mai
2011 mehr als 3000 Menschen, darunter auch etliche aus dem Landkreis Bad
Kissingen, auf den 'Weg der Erinnerung': Die Juden mussten nämlich damals,
streng bewacht von der Gestapo, von den Sammelplätzen aus- das war meist der Platz'sche Garten am heutigen Friedrich-Ebert-Ring– zum Bahnhof Aumühle
laufen. Auch in den Ratsgremien der Kommunen im Landkreis Bad Kissingen
stößt der geplante DenkOrt Aumühle inzwischen auf allgemeines Interesse...
wendig sei, sagt Karle. Doch dann sei allen relativ schnell klar geworden,
dass dieses Thema gerade jetzt, wo der Antisemitismus gelegentlich wieder um
sich greife, 'besondere Tragweite' habe.
Drei Gepäckstücke aus Hammelburg. Der Hammelburger Stadtrat beschloss
in diesen Tagen, drei unterschiedliche Gepäckstücke, jeweils eines in
Hammelburg, Westheim und Untererthal, aufzustellen. 'Es ist wichtig, dass
man die Geschichte vor Ort kennt und die Erfahrung daraus zieht, dass sich
so etwas nicht wiederholen darf', sagt Bürgermeister ArminWarmuth zu dieser
Entscheidung. Im Stadtrat sei man sich schnell einig gewesen, das Gedenken
an diese Zeit gemeinsam nach außen zu tragen. Denn es sei wichtig, diese
Zeit nicht zu verschweigen. 'Wir sind nicht verantwortlich für diese Taten,
aber wir müssen Lehren daraus ziehen.'..."
Link zum Artikel
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 335-336, III,1 S.510-511. |
 | Heinrich Ullrich: Chronik der Stadt Hammelburg.
1956. |
 | Michael Trüger: Artikel zum jüdischen Friedhof Pfaffenhausen, in:
Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. 13 Nr. 78
Dezember 1998 S. 18. |
 | Israel Schwierz: Steinere Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern.
1988. S. 63. |
 | Roland Flade: 50 Jahre danach. Die Stadt Hammelburg erinnert sich.
Eine Dokumentation, hrsg. von der Stadt Hammelburg, 1995. |
 | Volker Rieß: Sie gehören dazu...
Erinnerungen an die jüdischen Schüler der Lateinschule und des
Progymnasiums – verbunden mit einigen Aspekten zur Geschichte der Juden in
der Stadt Hammelburg und ihren Stadtteilen (Frobenius-Gymnasium Hammelburg.
Festschrift zum Schuljubiläum 1994), Hammelburg 1994, S. 83-102. |
 | Ders.: Jüdisches Leben in und um Hammelburg.
Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Herrenmühle 12. Oktober – 10.
Dezember 2000, Hammelburg 2001.
|
 | Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /
Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.
Schweinfurt 1992. |
 | dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von
Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt
1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period
1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den
Autoren/obtainable from: E-Mail.
Info-Blatt
zu dieser Publikation (pdf-Datei). |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 140-141. |
Hinweis auf eine Familienbiographie:
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
Charlotte Isler: Times Past, Times Present. A Brief History of
The Nussbaum, Schweizer, Friedmann, and Isler Families. Erschien
2005.
Der Vater der 1924 in Stuttgart geborenen Verfasserin des Buches war Manfred
Nussbaum (siehe Foto oben; geb. 1883 in Hammelburg, verzog 1924
nach Stuttgart, war verheiratet mit Klara geb. Friedmann, geb. 1900
in Stuttgart; die Familie emigrierte im April 1939 über Le Havre nach
New York). Aus diesem Buch rechts zwei Seiten über die Geschichte der
Stadt Hammelburg, der dortigen jüdischen Gemeinde und der Familie
Nussbaum.
Die Eltern von Manfred Nussbaum - Adolf und Klara Nussbaum - hatten
in Hammelburg in der Bahnhofstraße 3 (Karte rechts) eine Eisenwarenhandlung.
Charlotte Isler schreibt: "My father grew up in a large
house near the Marktplatz (market square). His parents, Adolf and
Klaire, owned a large hardware business (Eisenwarenhandlung) whose
inventory includes appliances and equipment such as railroad tracks.
My uncle Martell took over the business with his wife Lina after his
parents´death. Manfred chose a different career. Interested in music
from an early age on, he went to university and studied to become
conductor of opera and orchestral music. He coached with various
famous conductors. Once he completed his studies, he received
contracts at symphony and opera houses in cities that includes
Strassburg, Nürnberg, Essen and Zürich". |
| Link: Artikel
zur Buchvorstellung durch Petra Kaup-Clement am 26. Februar 2010 in
Hammelburg. |
| |
|
|
|
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Hammelburg Lower
Franconia. The
community was one of the oldest in Bavaria, with Jews continously present from
at least the late 13th century. During disturbances in 1298, 1336 and 1349 they
suffered from persecutions and in 1560 from the institution of residence and
trade restrictions. A synagogue and cemetery
were consecrated during this period. Further persecution was endured during the
Thirty Years War (1618-48) and in 1671 the community was expelled for a few
years, but it maintained its wealth and importance throughout. A new synagogue
was built in 1770. The Jewish population reached a peak of 172 in 1890 (total
2,889). In 1933, 79 remained, engaged mainly in the cattle and cloth trade.
Under Nazi rule, Jewish livelihoods were undermined by the economic boycott and
in 1938 all Jews were forced to sell off their property at a fraction of its
value while public prayer and the use of the Jewish cemetery were banned. On Kristallnacht
(9-10 November 1938) the synagogue and Jewish homes were vandalized. All the
Jews but two in mixed marriages left Hammelburg in 1933-39; 31 of them
emigrating (including 17 to the United States).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|