|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"
Gleicherwiesen mit
Simmershausen (Gemeinde
Gleichamberg, Kreis Hildburghausen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Gleicherwiesen bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts
zurück. 1680 nahmen die reichsritterschaftlichen Dorfherren von Bibra vier
"Schutzjuden" in Gleicherwiesen auf. Es waren Familien aus der
Gemeinde Bibra oder auch einige der 1671 aus dem Hochstift Fulda
vertriebene
jüdische Familien. Durch die Anwesenheit der jüdischen Familien verbesserte
sich die wirtschaftliche Lage des Ortes: 1743 wurde Gleicherwiesen in den Rang
eines Marktfleckens erhoben und durfte vier Jahr- und Viehmärkte
abhalten.
Ende des 18. Jahrhunderts schlossen sich die Juden des benachbarten
Simmershausen der israelitischen Kultusgemeinde Gleicherwiesen an (1786). Im
folgenden Jahr konnten neue Einrichtungen der jüdischen Gemeinde geschaffen
werden, u.a. durch die Einweihung einer Synagoge im Jahr 1787.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie
folgt: in Gleicherwiesen 1833 189 jüdische Einwohner (neben
256 christlichen), 1841 185, 1888 214; in Simmershausen 1841, 51, 1853 60 jüdische Einwohner,
1897 an beiden Orten zusammen 216 (davon 183 fest ansässig; in 41 Familien),
1895 230 (in 44 Familien), 1899 175 (in 38 Familien), 1901 151 (in 42
Haushaltungen).
In den Listen Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts wird häufig die Gemeinde als jüdische Gemeinde
Gleicherwiesen-Simmershausen bezeichnet.
Die jüdischen Familien lebten bis weit ins 19. Jahrhundert
hinein vom Handel mit Vieh sowie Häuten und Kleinwaren (Kramwaren). Um 1850 war
der bedeutendste Viehhändler am Ort Nathan Seligmann. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts öffneten mehrere von Ihnen Läden und Handlungen am Ort. Das
ehemalige Schloss an der Lindener Straße wurde von der Firma Bachmann übernommen
und umgebaut.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), ein jüdische Schule
(Elementarschule / Öffentliche Volksschule),
ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der
Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet
tätig war. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert hatten Gleicherwiesen und Simmershausen zeitweise
eigene Lehrer: so wird 1843 Joseph Merzenbacher als provisorischer
Schullehrer in Simmershausen genannt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
sind als Lehrer
für beide Orte zu nennen: Mayer Bär (1843/1844 erwähnt), Marcus Cramer, der seit 1853 am Ort war, 1878 sein 25-jähriges
Dienstjubiläum feiern konnte und 1885 in den Ruhestand trat (siehe Berichte
unten, gest. 1887). Sein Nachfolger war Jacob Mühlfelder, der sich u.a. dadurch
verdient machte, dass er 1889 ein Register des jüdischen Friedhofes mit
Situationsplan und Nummerierung anlegte. 1897 unterrichtete Mühlfelder 26 Kinder
an der Volksschule. Mühlfelder war nur als Lehrer und Kantor tätig; als
Schochetim (Schächter) werden 1897 M. Kahn und D. Hofmann genannt. Spätestens
seit 1899 war Leo Kahn Lehrer am Ort; sein Vorgänger Jacob Mühlfelder
lebte wohl auch noch in Gleicherwiesen. Er erteilte von hier aus damals den
Unterricht in Hildburghausen. 1901
unterrichtete Leo Kahn 25 Kinder
Die Gemeinde wurde durch den Landesrabbiner aus
Meiningen betreut.
An jüdischen Vereinen werden genannt: ein Israelitischer
Wohltätigkeits-Verein (genannt 1888), ein Israelitischer Armen-Verein
(genannt 1905), ein Frauen-Verein (1888 unter Leitung der Frau von C.
Cramer, der Frau von A. Seligmann und der Frau von B. Rosenthal; 1897 an Stelle
der Frau von A. Seligmann nun die Frau von H. Bachmann; 1905 unter
Leitung von Frau D. Rosenthal). Seit 1900/1905 gab es 10 Stiftungen in der Gemeinde (1888
werden genannt: das Löw Salomon Rosenthal'sche Vermächtnis, das Aron
Ehrlich'sche Vermächtnis, das Josef Sander'sche Legat, das Kusel Ehrlich'sche
Vermächtnis, das Samuel Schloss'sche Vermächtnis, das Magnus Freund'sche Legat;
1897 zusätzlich das Marianne Meyer'sche Vermächtnis, das Clara Bär'sche Legat
und das Israel Cramer'sche Legat, 1899 zusätzlich die Markus und Charlotte
Cramer'sche Stiftung).
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1869 Herr Seligmann; um
1879/1887 Daniel Rosenthal, M. Lindenstein, D. Sachs, J. Kramer und A.
Rosenbaum; um 1897 M. Lindenstein, A. Rosenbaum, M. Bachmann, J. Cramer und A.
Katz, um 1899 M. Lindenstein, L. Kahn, G. Mühlfelder, N. Seligmann und J.
Cramer, um 1901 J. Ehrlich, D. Hofmann, G. Kahn, G. Mühlfelder, N. Seligmann und
L. Kahn. Synagogendiener war um 1888 E. Hofmann, um 1897/1899 G.
Güttermann.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde (alle genannten
Personen lebten vor 1914 an anderen Orten): Dedo Cramer (geb. 23.6.1882 in
Gleicherwiesen, vor 1914 in Coburg wohnhaft, gef. 14.7.1915), Vizefeldwebel
Alfred Schloß (geb. 12.3.1893 in Gleicherwiesen, vor 1914 in
Coburg wohnhaft, gef. 13.1.1917), Ludwig Seligmann (geb. 16.7.1892 in Gleicherwiesen, gef.
30.5.1915), Martin Laub (geb. 5.9.1892 in Gleicherwiesen, vor 1914 in
Niederstetten wohnhaft, gef. 14.11.1914), Leopold Bachmann (geb. 26.4.1884 in
Gleicherwiesen, vor 1914 in Nordhausen wohnhaft, gef. 14.5.1916).
Um 1920 wurden noch 86 jüdische Einwohner gezählt. Es gab in jüdischem
Besitz die folgenden Gewerbebetriebe: Viehhandlung Moses Rosenberger,
Immobilienmakler Joseph Kahn, Landmaschinenhandel Isaak Kahn, Textil- und
Kleiderwaren Aron Heinemann, Metzgerei Albert Levy, Lohmühle Herz Bachmann,
Gerberei Karl Bachmann, Viehhandlung Löser Katz, Kolonialwarenhandlung Jakob
Gärtner.
Um 1924, als zur Gemeinde noch 42 Personen gehörten (8,4 % von etwa 500
Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Isak Kahn, Selig Rosenthal, Löser
Katz, Moritz Schloss und Sigmund Kahn. Den Religionsunterricht erteilte
weiterhin Oberlehrer Leo Kahn an der Volksschule (noch für zwei Kinder der Gemeinde); er war
gleichzeitig als Vorbeter in der Gemeinde tätig (Lehrer Kahn starb 1926). Zur Gemeinde gehörten
neben den in Simmershausen (1924 5) lebenden
auch die in Römhild
(1924 2) ansässigen jüdischen Personen.
1932 waren die Gemeindevorsteher Löser Katz (1. Vors., Streudorf Nr. 7), Albert Lewy (2. Vors.) und Carl Bachmann (3. Vors.). Die Gemeinde wurde betreut durch
den Landrabbiner Dr. Leo Fränkel aus
Meiningen.
1933 lebten noch 26 jüdische Personen am Ort. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938
wurde die Synagoge geschändet und demoliert (s.u.). Im Mai und im September 1942
wurden die letzten jüdischen Einwohner aus Gleicherwiesen in Vernichtungslager
deportiert.
Von den in Gleicherwiesen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Dina Bachmann geb. Linz
(1880), Max Bachmann (1876), Sigmund Bachmann (1882), Regina Blumenthal geb.
Kahn (1872), Moritz Cramer (1877), Liselotte (Liesel) Elsoffer geb. Kahn
(1907), Therese Frühauf geb. Guttmann (1861), Bianka Fultheim geb. Mühlfelde
(1880), Rosalie Hamburger geb. Cramer (1861), Rika (Rickchen) Heymann geb.
Rosenthal (1873), Frieda Hofmann geb. Ludwig (1879), Clara Kahn geb. Seligmann
(1873), Flora Kahn (1900), Jette (Jettchen) Kahn geb. Freudenberger (1872),
Nanny Kahn geb. Seligmann (1867), Sigmund Kahn (1906), Treina Kuttner geb. Kahn
(1860), Deborah Levi geb. Ehrlich (1863), Rosa Bella Levy geb. Kahn (1902),
Marta Mayer geb. Gärtner (1893), Bertha Peß Mendelsohn geb. Bachmann (1870),
Jenny Metzger geb. Ehrlich (1895), Berta Meyerstein geb. Gutmann (1867), Emanuel
Mühlfelder (1875), Max Mühlfelder (1888), Sophie Neumann geb. Schloss (1875),
Sabine Rosenbaum geb. Seligmann (1855), Selig Daniel Rosenthal (1868), Nanni
Salomon geb. Schloss (1880), Arthur Schloss (1882), Hermann Hirsch Schloss
(1872), Jette Schloss geb. Bachmann (1861), Selma Schloss (1898), Betty
Schottenfels geb. Katz (1901), Rosa Stiefel geb. Mühlfelder (1884), Käthe
Wachenheimer geb. Ehrlich (1900), Bella Wahler geb. Adler (1878), Marta
Weißmann geb. Laub (1888), Irma Zaduk geb. Katz (1900), Rosa Rita Zaduk
(1934).
Aus Simmershausen sind umgekommen: Gustav Kahn (1884), Max Kahn (1882),
Bella Ludwig geb. Kahn (1888), Flora Mayer geb. Kahn (1886), Martha Wetzler geb.
Kahn (1892).
Gedenktafel. In der Dorfkirche von Gleicherwiesen wurde rechts neben dem Altar
1998 - 60 Jahre nach der Pogromnacht 1938 - ein Holzbild angebracht: 'Im
Gedenken an die jüdischen Frauen, Männer und Kinder, die hier lebten 1848–1943'.
Über dem Schriftzug sind die Umrisse von Menschen zu sehen, die das Dorf
verlassen. Ein einzelner Mann blickt fassungslos ins Leere.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Berichte
Zahl der jüdischen Einwohner im Herzogtum Meiningen (1841)
 Mitteilung in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1841: "Die
Zahl der jüdischen Einwohner des Herzogtums Meiningen beläuft sich dermalen
auf 1494, und es wohnen hiervon 19 in der Stadt
Meiningen, 548 in
Walldorf, 63 in
Dreißigacker, 121 in
Bauerbach, 114 in
Bibra, 100 in der Stadt
Hildburghausen, 51 in
Simmershausen, 153 in Berkach, 185 in
Gleicherwiesen, 131 in Marisfeld,
9 in Liebenstein, 17 verstreut
in verschiedenen Ortschaften, 23 haben bereits das Staatsbürgerrecht, und
zwar nur im Hildburghausischen, 105 haben sich bürgerlichen Gewerben
zugewendet."
Mitteilung in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1841: "Die
Zahl der jüdischen Einwohner des Herzogtums Meiningen beläuft sich dermalen
auf 1494, und es wohnen hiervon 19 in der Stadt
Meiningen, 548 in
Walldorf, 63 in
Dreißigacker, 121 in
Bauerbach, 114 in
Bibra, 100 in der Stadt
Hildburghausen, 51 in
Simmershausen, 153 in Berkach, 185 in
Gleicherwiesen, 131 in Marisfeld,
9 in Liebenstein, 17 verstreut
in verschiedenen Ortschaften, 23 haben bereits das Staatsbürgerrecht, und
zwar nur im Hildburghausischen, 105 haben sich bürgerlichen Gewerben
zugewendet." |
Zwei jüdische Familien flohen vor
Nazi-Pogromen aus Autenhausen nach Gleicherwiesen (1923)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 15. November 1923: "Gleicherwiesen,
5. November 1923. Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 15. November 1923: "Gleicherwiesen,
5. November 1923.
Hier geht es auch schrecklich zu. Heute Nacht wurden wir geweckt, und kamen
zwei Familien aus Autenhausen
zu uns, die nachts um 12 Uhr von Hakenkreuzlern überfallen und mit
Schlagringen und anderen Waffen halbtot geschlagen waren. Ihr könnt
es euch gar nicht vorstellen, wie schrecklich es ist. Nun sind sie von Haus
und Hof gejagt und sitzen hier. Von der bayerischen Polizei wird nichts zu
erhoffen sein, denn die haben ja nur Hakenkreuzler. Hier kann ja so etwas
nicht passieren. Man ist doch ängstlich, weil es so an der Grenze ist.
Lieber M....!
Käthes Schreiben liegt schon einige Tage, ich konnte vor Aufregung nicht
eher schreiben. Du kannst dir nicht vorstellen wie A. und E. G. mit ihren
Frauen ankamen. Die Herren blutüberströmt, die Frauen mit offenen Haaren,
ich werde den Augenblick nicht vergessen… Heute sind die Frauen nach
Autenhausen, um sich Kleider und
Wäsche zu holen, da sie morgen nach Coburg
abgeholt werden. Die jüdischen Familien von hier zeigen sich großartig, alle
sind aufmerksam zu den Leuten, schicken, was man nur braucht und haben wir
jeden Abend Besuch. Heute Nacht haben wir, nach der Aufregung, zum ersten
Mal ein bisschen geschlafen. Heute Früh kam nun aus Frankfurt ein Brief an
J. K. Es wurde dorthin gemeldet, dass bei einer Hakenkreuzlerversammlung in
Heldburg beschlossen wurde, in nächster Zeit gegen die Gleicherwieser Juden
vorzurücken, uns also ebenso auszuplündern, zu rauben und zu morden. Du
kannst Dir ja nun vorstellen, wie ratlos wir sind. J. ist ja gleich nach
Hildburghausen, um beim
Kreisdirektor und Kreiskommissar Schutz zu erflehen. Nun wollen wir
abwarten, was er für Nachrichten mitbringt.
Diese Briefe sind laut telefonischer authentischer Mitteilung dahin zu
ergänzen.
Die beiden Herren G.... aus Autenhausen
wurden von den Hakenkreuzlern derartig misshandelt, dass sie erstere selbst
für
tot hielten
und aufs Feld schleppten, um sie zu verscharren. Die Übeltäter gingen zum
Ort zurück, um Spaten zu holen. Die Misshandelten benutzten die Gelegenheit,
um zu entfliehen und kamen auch nach einem benachbarten Städtchen (Ummerstadt),
von wo sie ein ihnen wohlgesinnter Bauer nach Gleicherwiesen fuhr, wo sie
morgens um 6 Uhr ankamen. Meine Schwester riskierte nicht, den
Gleicherwiesener Arzt kommen zu lassen, ließ vielmehr einen als liberal
bekannten Hildburghausener Arzt, Dr. Straatmann kommen, der die Leute
dann behandelt und verbunden hat. Die Wunden waren derartig schwer, dass sie
genäht werden mussten." |
Aus der Geschichte der jüdischen
Lehrer
Feier der 25jährigen Dienstzeit des Lehrers Marcus Cramer
(1878)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17.
Juli
1878: "Mellrichstadt, 7.Juli (1878). Am 11. Mai (1878) feierte
die israelitische Kultusgemeinde Gleicherwiesen, Herzogtum
Sachsen-Meiningen, in solenner Weise das Jubiläum der 25-jährigen
Dienstzeit ihres Lehrers, Herrn M. Cramer. Hierzu berief man Herrn
Rabbiner Dr. Kroner aus Eisenach, welcher unter ungeteiltem Beifalle die
Festrede hielt. Aus dem Festprogramme, welches sehr reichhaltig war, ist
zu erkennen. dass dieser Tag für erwähnte Kultusgemeinde ein wahrer,
herzlich gemeinter Festtag war, wozu alle auswärtigen Verwandte und
Bekannte, wie beim Begehen eines Familienfestes eingeladen und auch
erschienen waren. Die Festgeschenke von Jung und Alt, von Einzelnen, wie
von der Gemeinde, bestehend in Banknoten, Gold- und Silbergeräten sollen
einen Wert von über Mark 5.000 übersteigen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17.
Juli
1878: "Mellrichstadt, 7.Juli (1878). Am 11. Mai (1878) feierte
die israelitische Kultusgemeinde Gleicherwiesen, Herzogtum
Sachsen-Meiningen, in solenner Weise das Jubiläum der 25-jährigen
Dienstzeit ihres Lehrers, Herrn M. Cramer. Hierzu berief man Herrn
Rabbiner Dr. Kroner aus Eisenach, welcher unter ungeteiltem Beifalle die
Festrede hielt. Aus dem Festprogramme, welches sehr reichhaltig war, ist
zu erkennen. dass dieser Tag für erwähnte Kultusgemeinde ein wahrer,
herzlich gemeinter Festtag war, wozu alle auswärtigen Verwandte und
Bekannte, wie beim Begehen eines Familienfestes eingeladen und auch
erschienen waren. Die Festgeschenke von Jung und Alt, von Einzelnen, wie
von der Gemeinde, bestehend in Banknoten, Gold- und Silbergeräten sollen
einen Wert von über Mark 5.000 übersteigen.
Der Jubilar war stets und ist noch ein ganzer Mann für Schule und
Gemeinde, und was die Hauptsache ist, er hatte das Glück, hier einen für
das Wahre und Gute stets empfänglichen Boden zu finden, worauf er den
Samen des Wahren, Schönen ausstreute, welcher diese guten Früchte trug.
Ottensoser, Direktor." |
Zum Tod des Lehrers Marcus Cramer (Lehrer in
Gleicherwiesen von 1837-1885; gest. 1887)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
7. Juli 1887: "Gleicherwiesen, im Juni (1887). Am 25. vorigen
Monats hat die hiesige israelitische Gemeinde ihren hochverehrten Lehrer
und Führer, die Meininger Lehrerschaft ihren treuesten Kollegen zur
letzten Ruhe gebettet. Einen solch feierlich, imposanten Leichenzug hat
unser Ort wohl noch nie gesehen. Nur wer den unvergleichlichen Marcus
Cramer gekannt, wird die innige Teilnahme an dem Verlust, der die
Familie des Heimgegangenen und die hiesige Gemeinde, ja das ganze
orthodoxe Judentum betroffen, verstehen. Ohne Unterschied der Konfession
beteiligten sich nicht nur die Ortseinwohner an dem Leichenbegängnis, es
waren auch viele Kollegen und Schüler von nah und fern erschienen, um dem
allverehrten Freunde und Lehrer die letzte Ehre zu erweisen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
7. Juli 1887: "Gleicherwiesen, im Juni (1887). Am 25. vorigen
Monats hat die hiesige israelitische Gemeinde ihren hochverehrten Lehrer
und Führer, die Meininger Lehrerschaft ihren treuesten Kollegen zur
letzten Ruhe gebettet. Einen solch feierlich, imposanten Leichenzug hat
unser Ort wohl noch nie gesehen. Nur wer den unvergleichlichen Marcus
Cramer gekannt, wird die innige Teilnahme an dem Verlust, der die
Familie des Heimgegangenen und die hiesige Gemeinde, ja das ganze
orthodoxe Judentum betroffen, verstehen. Ohne Unterschied der Konfession
beteiligten sich nicht nur die Ortseinwohner an dem Leichenbegängnis, es
waren auch viele Kollegen und Schüler von nah und fern erschienen, um dem
allverehrten Freunde und Lehrer die letzte Ehre zu erweisen.
Am Grabe sprachen der Herzogliche Landrabbiner von Meiningen, der
Amtsnachfolger des Entschlafenen und der 1. Vorstand der hiesigen
Gemeinde, während die erschienenen christlichen Kollegen erhebende
Trauergesänge vortrugen. Der Herr Landrabbiner kondolierte auch im
Auftrage der hohen Oberschulbehörde in Meiningen, die das verdienstvolle
Wirken Cramers stets anerkannte.
Cramer amtierte als Elementar- und Religionslehrer, sowie als Kantor von
1837 bis Ostern 1885, um welche Zeit er wegen schwerer, körperlicher
Leiden von der Oberschulbehörde in den verdienten Ruhestand versetzt
wurde." |
Der frühere Lehrer Jacob Mühlfelder
wird ausgezeichnet (1909)
 Artikel in "Der Gemeindebote" vom 7. Mai 1909: "Anlässlich
der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt Herr J. Mühlfelder,
früher in Walldorf und
Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der
Hildburghäuser israelitischen
Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dort selbst, die dem
Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in
Gold." Artikel in "Der Gemeindebote" vom 7. Mai 1909: "Anlässlich
der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt Herr J. Mühlfelder,
früher in Walldorf und
Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der
Hildburghäuser israelitischen
Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dort selbst, die dem
Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in
Gold."
|
| |
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. April 1909: "Hildburghausen.
Anlässlich der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt auch Herr
J. Mühlfelder, früher in Walldorf
und Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der
Hildburghäuser israelitischen
Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dortselbst, die dem
Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in
Gold." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. April 1909: "Hildburghausen.
Anlässlich der 83. Geburtstagsfeier des Herzogs Georg II. erhielt auch Herr
J. Mühlfelder, früher in Walldorf
und Gleicherwiesen und seit zwölf Jahren Lehrer der
Hildburghäuser israelitischen
Gemeinde und an der Herzoglichen Taubstummenschule dortselbst, die dem
Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden angereihte Verdienstmedaille in
Gold."
|
40-jähriges Dienstjubiläum von
Lehrer Jacob Mühlfelder (1913 in Hildburghausen)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1913: "Am
1. März werden es 40 Jahre, dass Herr Lehrer Mühlfelder -
Hildburghausen, Vorstandsmitglied
des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands, ins Amt getreten ist.
Mühlfelder ist am 27. Oktober 1853 geboren, besuchte das meiningische
Landesseminar in Hildburghausen,
amtierte bis 1885 in Walldorf an der
Werra, bis 1897 in Gleicherwiesen und seitdem in
Hildburghausen. Der Jubilar, der
neben seinem Amt als Lehrer und Vorbeter der jüdischen Gemeinde auch Lehrer
an der Taubstummenanstalt ist, steht noch in der Vollkraft seines Schaffens;
wir wünschen ihm noch viele Jahre Amtstätigkeit in Rüstigkeit und
Berufsfreudigkeit. " Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1913: "Am
1. März werden es 40 Jahre, dass Herr Lehrer Mühlfelder -
Hildburghausen, Vorstandsmitglied
des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands, ins Amt getreten ist.
Mühlfelder ist am 27. Oktober 1853 geboren, besuchte das meiningische
Landesseminar in Hildburghausen,
amtierte bis 1885 in Walldorf an der
Werra, bis 1897 in Gleicherwiesen und seitdem in
Hildburghausen. Der Jubilar, der
neben seinem Amt als Lehrer und Vorbeter der jüdischen Gemeinde auch Lehrer
an der Taubstummenanstalt ist, steht noch in der Vollkraft seines Schaffens;
wir wünschen ihm noch viele Jahre Amtstätigkeit in Rüstigkeit und
Berufsfreudigkeit. " |
Ausschreibungen der Stelle eines
Hilfsvorbeters (1913 / 1917)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 10. Juli 1913: "Für
die hohen Herbstfeiertage suchen wir einen
Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 10. Juli 1913: "Für
die hohen Herbstfeiertage suchen wir einen
Hilfsvorbeter,
der auch Schofar bläst. Offerten mit Gehaltsansprüchen an
Vorstand M. Rosenberger. Gleicherwiesen (S.-M.). " |
| |
 Anzeige
in "Neue jüdische Presse" vom 17. August 1917: "Wir suchen
für Jom Kippur einen Anzeige
in "Neue jüdische Presse" vom 17. August 1917: "Wir suchen
für Jom Kippur einen
Hilfsvorbeter.
Angebote mit Gehaltsansprüchen an
Loeser Katz, Gemeindevorstand, Gleicherwiesen (S. M.)"
|
25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer
Jacob Mühlfelder in Hildburghausen (1922)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 11. Mai 1922: "Am
15. Mai begeht Lehrer Mühlfelder in
Hildburghausen die Feier
seines 20-jährigen Ortsjubiläum. Mühlfelder blickt auf ein arbeitsreiches,
gesegnetes Wirken und Schaffen zurück. Er ist am 27. Oktober 1853 in
Bauerbach geboren, besuchte das
Seminar in Hildburghausen,
amtierte in Walldorf bis 1885, in
Gleicherwiesen bis 1897 und seitdem in
Hildburghausen. Dort war er
nebenamtlich auch viele Jahre an der Taubstummenanstalt tätig und erhielt
die goldene Verdienstmedaille. Dem Verein israelitischer Lehrer
Mitteldeutschland gehört er seit seinem Bestehen an und war stets eines
seiner eifrigsten und getreuesten Mitglieder. Wir wünschen dem wackeren
Kollegen noch ein recht langes, erfolgreiches Wirken im Dienst seiner
Gemeinde und des gesamten Judentums." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 11. Mai 1922: "Am
15. Mai begeht Lehrer Mühlfelder in
Hildburghausen die Feier
seines 20-jährigen Ortsjubiläum. Mühlfelder blickt auf ein arbeitsreiches,
gesegnetes Wirken und Schaffen zurück. Er ist am 27. Oktober 1853 in
Bauerbach geboren, besuchte das
Seminar in Hildburghausen,
amtierte in Walldorf bis 1885, in
Gleicherwiesen bis 1897 und seitdem in
Hildburghausen. Dort war er
nebenamtlich auch viele Jahre an der Taubstummenanstalt tätig und erhielt
die goldene Verdienstmedaille. Dem Verein israelitischer Lehrer
Mitteldeutschland gehört er seit seinem Bestehen an und war stets eines
seiner eifrigsten und getreuesten Mitglieder. Wir wünschen dem wackeren
Kollegen noch ein recht langes, erfolgreiches Wirken im Dienst seiner
Gemeinde und des gesamten Judentums." |
25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer
Leo Kahn (1922)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Oktober 1922: "Gleicherwiesen.
Das 25-jährige Ortsjubiläum unseres Herrn Lehrers Kahn zeigte,
welcher Wertschätzung er sich bei der gesamten hiesigen Bevölkerung erfreut.
Vormittags überbrachten der Kultusvorstand und der Gemeinderat von
Gleicherwiesen ihre Glückwünsche nebst kostbaren Geschenken. Der
Vorsitzende der israelitischen Gemeinde und der Bürgermeister des Ortes
hielten an den Lehrer ehrende Ansprachen. Hierauf folgten die Vorstände des
israelitischen und vaterländischen Frauenvereins, die ganze Schuljugend des
Dorfes mit Blumen und wertvollen Liebeszeichen. Auch frühere auswärtige
Schüler und Schülerinnen bewiesen ihre Dankbarkeit und Verehrung durch die
Tat. Es war jedenfalls ein herrlicher Tag für Herrn Kahn, musste er doch aus
den zahlreichen Aufmerksamkeiten die Überzeugung gewinnen, dass man dessen
Leistungen in seinem schweren Berufe hier zu würdigen weiß." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Oktober 1922: "Gleicherwiesen.
Das 25-jährige Ortsjubiläum unseres Herrn Lehrers Kahn zeigte,
welcher Wertschätzung er sich bei der gesamten hiesigen Bevölkerung erfreut.
Vormittags überbrachten der Kultusvorstand und der Gemeinderat von
Gleicherwiesen ihre Glückwünsche nebst kostbaren Geschenken. Der
Vorsitzende der israelitischen Gemeinde und der Bürgermeister des Ortes
hielten an den Lehrer ehrende Ansprachen. Hierauf folgten die Vorstände des
israelitischen und vaterländischen Frauenvereins, die ganze Schuljugend des
Dorfes mit Blumen und wertvollen Liebeszeichen. Auch frühere auswärtige
Schüler und Schülerinnen bewiesen ihre Dankbarkeit und Verehrung durch die
Tat. Es war jedenfalls ein herrlicher Tag für Herrn Kahn, musste er doch aus
den zahlreichen Aufmerksamkeiten die Überzeugung gewinnen, dass man dessen
Leistungen in seinem schweren Berufe hier zu würdigen weiß." |
70. Geburtstag von Kultusdiener
Veist Birkenstein (1924)
 Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. März 1924: "Bevorstehende
60-, 70-, 80- und 90-jährige Geburtstage: Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. März 1924: "Bevorstehende
60-, 70-, 80- und 90-jährige Geburtstage:
…
Gleicherwiesen: 5. März 1924: Kultusdiener Feist Birkenstein 70
Jahren." |
Tod und Beisetzung von Oberlehrer
Leo Kahn (1926)
 Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Juni 1926: "Gleicherwiesen:
Oberlehrer Leo Kahn, 61 Jahre." Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Juni 1926: "Gleicherwiesen:
Oberlehrer Leo Kahn, 61 Jahre." |
| |
 Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 24. Juni 1926: "Gleicherwiesen.
Die Beerdigung unseres langjährigen Lehrers Leo Kahn gestaltete sich
zu einer großen Trauerkundgebung, an der nicht nur die Gemeinde vollzählig,
seine ehemaligen Schüler in großer Zahl, sondern an der sich auch weite
Kreise der nichtjüdischen Bevölkerung beteiligten. Am Grabe sprachen
Landrabbiner Fränkel - Meiningen,
Kreisschulrat Bittorf als persönlicher Freund und zugleich im Namen
der ehemaligen Klassenkameraden, Lehrer Levinstein -
Themar namens der jüdischen
Vereinskollegen und Schuldirektor Schön -
Hildburghausen im Namen des
Thüringer Lehrervereins. Das Andenken des wackeren Mannes sei gesegnet!" Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 24. Juni 1926: "Gleicherwiesen.
Die Beerdigung unseres langjährigen Lehrers Leo Kahn gestaltete sich
zu einer großen Trauerkundgebung, an der nicht nur die Gemeinde vollzählig,
seine ehemaligen Schüler in großer Zahl, sondern an der sich auch weite
Kreise der nichtjüdischen Bevölkerung beteiligten. Am Grabe sprachen
Landrabbiner Fränkel - Meiningen,
Kreisschulrat Bittorf als persönlicher Freund und zugleich im Namen
der ehemaligen Klassenkameraden, Lehrer Levinstein -
Themar namens der jüdischen
Vereinskollegen und Schuldirektor Schön -
Hildburghausen im Namen des
Thüringer Lehrervereins. Das Andenken des wackeren Mannes sei gesegnet!"
|
| |
 Artikel
in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 9. Juli 1926: "Meiningen.
(Lehrer Kahn gestorben). Der im 61. Lebensjahr verstorbene Lehrer und
Kantor Leo Kahn im benachbarten Gleicherwiesen wurde unter starker
Beteiligung der Ortsbewohner und auch auswärtiger Freunde zu Grabe getragen.
In zahlreichen Ansprachen klang die allgemeine Trauer wieder, die das
frühzeitige Ableben des geachteten und bewährten Beamten bei seinen
Berufsgenossen und der gesamten Gemeinde geweckt hatte. Landrabbiner Fränkel
aus Meiningen hielt die Trauerrede und
hob die vornehmen Charaktereigenschaften des Verklärten hervor. Als
persönlicher Freund widmete Kreisschulrat Bittorf, auch im Namen der
ehemaligen Klassenkameraden, dem Verstorbenen herzliche Worte der Würdigung
seines Wirkens als Jugenderzieher. Für die jüdischen Vereinskollegen rief
Lehrer Levinstein, Themar, dem treuen und
bewährten Mitgliede des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschland
innige Abschiedsworte nach, und aus dem ehrenden Nachruf des Schuldirektors
Schön aus Hildburghausen, der im
Namen des Thüringer Lehrervereins sprach, wurde das kollegiale Verhältnis
erkennbar, dass zwischen dem Heimgegangenen und den Lehrern des Bezirks
bestanden hatte. Die würdig verlaufene Trauerfeier hinterließ bei allen
Teilnehmern einen ergreifenden Eindruck von dem schweren Verlust, den die
Gemeinde Gleicherwiesen durch das Ableben ihres Lehrers erlitten hat." Artikel
in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 9. Juli 1926: "Meiningen.
(Lehrer Kahn gestorben). Der im 61. Lebensjahr verstorbene Lehrer und
Kantor Leo Kahn im benachbarten Gleicherwiesen wurde unter starker
Beteiligung der Ortsbewohner und auch auswärtiger Freunde zu Grabe getragen.
In zahlreichen Ansprachen klang die allgemeine Trauer wieder, die das
frühzeitige Ableben des geachteten und bewährten Beamten bei seinen
Berufsgenossen und der gesamten Gemeinde geweckt hatte. Landrabbiner Fränkel
aus Meiningen hielt die Trauerrede und
hob die vornehmen Charaktereigenschaften des Verklärten hervor. Als
persönlicher Freund widmete Kreisschulrat Bittorf, auch im Namen der
ehemaligen Klassenkameraden, dem Verstorbenen herzliche Worte der Würdigung
seines Wirkens als Jugenderzieher. Für die jüdischen Vereinskollegen rief
Lehrer Levinstein, Themar, dem treuen und
bewährten Mitgliede des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschland
innige Abschiedsworte nach, und aus dem ehrenden Nachruf des Schuldirektors
Schön aus Hildburghausen, der im
Namen des Thüringer Lehrervereins sprach, wurde das kollegiale Verhältnis
erkennbar, dass zwischen dem Heimgegangenen und den Lehrern des Bezirks
bestanden hatte. Die würdig verlaufene Trauerfeier hinterließ bei allen
Teilnehmern einen ergreifenden Eindruck von dem schweren Verlust, den die
Gemeinde Gleicherwiesen durch das Ableben ihres Lehrers erlitten hat." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod von Kaufmann Israel Cramer, Bruder des 1887
verstorbenen Lehrers Marcus Cramer (1892)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
22. August 1892: "Gleicherwiesen, im August (1892). Unsere
Gemeinde ist von einem schweren Verlust betroffen worden. Nachdem vor kaum
5 Jahren unser verdienstvoller, hochgeehrter Lehrer Cramer von uns
genommen worden ist, hat nun auch dessen ebenbürtiger Bruder, der Kaufmann Herr Israel Cramer
am 18. Ab im Alter von 73 Jahren für immer
das Auge geschlossen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
22. August 1892: "Gleicherwiesen, im August (1892). Unsere
Gemeinde ist von einem schweren Verlust betroffen worden. Nachdem vor kaum
5 Jahren unser verdienstvoller, hochgeehrter Lehrer Cramer von uns
genommen worden ist, hat nun auch dessen ebenbürtiger Bruder, der Kaufmann Herr Israel Cramer
am 18. Ab im Alter von 73 Jahren für immer
das Auge geschlossen.
Hat jener von Amtswegen jahrelang hier höchst segensreich gewirkt, so
fällt diesem das Verdienst zu, als Privatmann in der uneigennützigsten
Weise für das Wohl der Gemeinde und der jüdischen Gesamtheit überhaupt
tätig gewesen zu sein.
Der Vollendete zählte zu den leider immer seltener werdenden Männern,
die vermöge ihrer Festigkeit und Unwandelbarkeit im Glauben, ihrer
Anhänglichkeit an der Gotteslehre und am väterlichen Glauben, sowie
überhaupt durch die Schwere ihres edlen, die Pietät herausfordernden
Charakters ein wirksames Gegengewicht gegen die destruktiven Bewegungen
unserer Zeit bilden.
Während der ältere Bruder dem Lehrerberufe sich widmete, hob Israel
Cramer in seinem Gewerbe durch eisernen Fleiß und eisernen Willen die
Familie aus der Dürftigkeit zum Wohlstand. Dabei verstand er es, wie
selten einer, Talmud Tora im Derech Erez (das meint:), Studium
des Gotteswortes mit weltlichen Geschäften und weltlicher Bildung in
schönen Einklang zu bringen. Von Natur aus mit reichen Gaben des Geistes
und des Herzens ausgerüstet, wurde er im Lernen durch die Anregung, die
von seinem gelehrten Bruder ausging, noch in seinem Mannesalter wesentlich
gefördert. |
 Dass
ihm aber nicht das Lernen, sondern besonders die Tat Hauptsache gewesen,
dafür wissen ihm die hiesige Gemeinde und die weitesten Kreise Dank über
sein Grab hinaus. Dass
ihm aber nicht das Lernen, sondern besonders die Tat Hauptsache gewesen,
dafür wissen ihm die hiesige Gemeinde und die weitesten Kreise Dank über
sein Grab hinaus.
Die Gebote unserer heiligen Religion hat er aufs Pünktlichste ausgeübt.
Arme und Dürftige, Witwen und Waisen, Verwalter der Lehrhäuser und
Leiter sonstiger gemeinnütziger Anstalten können bezeugen, dass er ein
wahrhaft wohltätiger Mann und unermüdet im Wohltun gewesen. Warme
Fürsprache und Förderung fand durch ihn auch alle zum Wohl Jerusalems
und des heiligen Landes bestehenden Lehr- und Wohltätigkeitsanstalten;
mit verschiedenen Leitern derselben stand er in direktem
Verkehr.
Er hatte stets den Mut, seine gewonnene Überzeugung zu bekennen und
suchte laue und schwankende Gemüter zu begeistern.
In der Synagogen- und Ortsgemeinde bekleidete er die verschiedensten
Ehrenämter; in früheren Jahren hatte er in Gewissenhaftigkeit und
Gewandtheit die religiöse Funktion eines Schochet ausgeübt.
Was ihn uns unvergessen machen wird und ihm ein treues Gedenken sichert,
das sind seine freiwilligen, uneigennützigen Leistungen als Chasan
(Kantor). Begabt mit seiner sicheren, wohlklingenden Stimme und durch mehr
als gewöhnliche Kenntnisse der heiligen Sprache befähigt die Gebete nach
ihrem Inhalte genau zu erfassen, hat er von frühester Jugend an, länger
als ein halbes Jahrhundert vor der Lade Gottes stehend, durch seinen
Vortrag die Herzen der frommen Beter auf den Schwingen der Andacht,
besonders an den hehren Tagen des Jahres (sc. hohe Feiertage zwischen
Neujahr und Jom Kippur), zu Gott emporgehoben.
Welche Verehrung Herr Cramer in unserer Gemeinde und darüber hinaus
genoss, zeigte sich bei seinem Leichenbegängnis, das am Freitag
stattfand. Die Doppelgemeinde Gleicherwiesen-Simmershausen war vollzählig
erschienen, auch eine Anzahl Nichtisraeliten, darunter der evangelische
Pfarrer und Lehrer unseres Nachbarortes Streufdorf, woselbst das
Hauptgeschäft des Verstorbenen sich befindet, waren herbeigeeilt, um dem
Manne, der auch bei Andersgläubigen wegen seiner strengen Rechtlichkeit
beliebt war, die letzte Ehre zu erweisen.
Im Trauerhause widmete Herr Daniel Rosenthal, der gewesene
langjährige Vorsteher unserer Gemeinde seinem treuen Mitarbeiter am
Gemeindewohl und dem größten Wohltäter des hiesigen Wortes einen
ehrenden Nachruf, während am Grabe der Lehrer unserer Gemeinde die
Verdienste des Heimgegangenen gebührend hervorhob und den Trauernden Trost
spendete.
Gleich nach dem Leichenbegängnisse wurde dem Kultusvorstande eine von dem
Verstorbenen verfasste und auf seinen Namen lautende Stiftungsurkunde
überreicht, in der derselbe seine Erben anweist, ein Kapital an die
Gemeinde auszuhändigen, dessen Zinsen religiösen und wohltätigen
Zwecken dienen soll. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
| |
|
|
|
Ergänzendes
Dokument zu Israel Cramer:
Postkarte von Israel Cramer, verschickt am 28. November 1886
an die Fa. Eisenheimer in Schweinfurt
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |
 |
 |
| Anmerkung (von
Peter Karl Müller): Israel Cramer und seine Frau Karoline geb. Beck
hatten eine Tochter Nanny. Diese heiratete etwa 1880 Meier Herz Laub in
Gleicherwiesen (nach dem Begleittext zu ihrem Grabstein). Sie liegt begraben in
Oettingen, vgl. die Gräberliste www.alemannia-judaica.de/images/Images%2076/CEM-OET-GRAVELIST.pdf
(interner Link; Seite 21 - Grabnummer 184). |
Zum Tod des aus Gleicherwiesen stammenden Seminar- und
Gemeindelehrer Julius Rosenthal in Hildburghausen (1896)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:
"Hildburghausen, 10.
Mai (1896). Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte
Lehrerschaft des Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten;
am 2. Mai dieses Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des
verdienstvollen Seminar- und Gemeindelehrers Julius Rosenthal hier. Über
dessen goldenes Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen
Ehrungen des Jubilars aus dieser Veranlassung hatten Sie vor vier Jahren
berichtet. Das Leichenbegängnis, das am 5. dieses Monats stattfand,
bewies aufs Neue, in welch hohem Ansehen der entschlafene Schulmann
gestanden. Denn nicht nur die ganze Gemeinde und die sämtlichen
israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen sich der trauernden Familie
des Verewigten an, sondern auch das gesamte Seminarkollegium und die
meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle christlichen Kollegen
der an vierzig Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und viele
christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug auf
einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit
der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen
der herzogliche Landrabbiner von Meiningen und Lehrer Holländer aus Berkach.
Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,
erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der
Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.
1846 folgte Rosenthal einem Ruf seiner Schulbehörde und verwaltete von da
ab in der engeren Heimat die Schulstellen in Bibra
und Walldorf, bis er endlich im
Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand und
seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine bedeutende
wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein
Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und
äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die
neidlos anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des
Vorstandes vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige
Hauptversammlungen desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als
auch durch seinen reinen tadellosen Charakter hat der Verblichene Kiddusch
haschem (Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten Einer, wie er
überhaupt in fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum
wird gewiss sein Andenken zum Segen
bleiben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:
"Hildburghausen, 10.
Mai (1896). Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte
Lehrerschaft des Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten;
am 2. Mai dieses Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des
verdienstvollen Seminar- und Gemeindelehrers Julius Rosenthal hier. Über
dessen goldenes Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen
Ehrungen des Jubilars aus dieser Veranlassung hatten Sie vor vier Jahren
berichtet. Das Leichenbegängnis, das am 5. dieses Monats stattfand,
bewies aufs Neue, in welch hohem Ansehen der entschlafene Schulmann
gestanden. Denn nicht nur die ganze Gemeinde und die sämtlichen
israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen sich der trauernden Familie
des Verewigten an, sondern auch das gesamte Seminarkollegium und die
meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle christlichen Kollegen
der an vierzig Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und viele
christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug auf
einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit
der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen
der herzogliche Landrabbiner von Meiningen und Lehrer Holländer aus Berkach.
Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,
erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der
Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.
1846 folgte Rosenthal einem Ruf seiner Schulbehörde und verwaltete von da
ab in der engeren Heimat die Schulstellen in Bibra
und Walldorf, bis er endlich im
Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand und
seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine bedeutende
wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein
Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und
äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die
neidlos anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des
Vorstandes vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige
Hauptversammlungen desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als
auch durch seinen reinen tadellosen Charakter hat der Verblichene Kiddusch
haschem (Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten Einer, wie er
überhaupt in fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum
wird gewiss sein Andenken zum Segen
bleiben." |
| Weitere Berichte zum Tod von Julius
Rosenthal siehe Seite zu
Hildburghausen. |
Zum Tod von Seminar- und
Gemeindelehrer Julius Rosenthal in Hildburghausen (geb. 1823 in Gleicherwiesen,
gest. 1896)
 Artikel in "Der Gemeindebote" vom 15. Mai 1896: "Hildburghausen,
10. Mai. Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte Lehrerschaft des
Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten; am 2. Mai dieses
Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des verdienstvollen Seminar- und
Gemeinde Lehrers Julius Rosenthal hier. Über dessen goldenes
Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen Ehrungen des Jubilars aus
dieser Veranlassung hatten sie vor vier Jahren berichtet. Das
Leichenbegängnis, das am 5. Mai stattfand, bewies aufs Neue, in welch hohem
Ansehen der entschlafene Schulmann gestanden. Denn nicht nur die ganze
Gemeinde und die sämtlichen israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen
sich der trauernden Familie des Verewigten an, sondern auch das gesamte
Seminarkollegium und die meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle
christlichen Kollegen der an 40 Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und
viele christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug
auf einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit
der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen der
herzogliche Landrabbiner von Meiningen
und Lehrer Holländer aus Berkach.
Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,
erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der
Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.
1846 folgte Rosenthal einem Rufe seiner Schulbehörde und verwaltete von da
ab in der engeren Heimat die Schulstellen in
Bebra und Walldorf, bis er
endlich im Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand
und seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine
bedeutende wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein
Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und
äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die neidlos
anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des Vorstandes
vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige Hauptversammlungen
desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als auch durch seinen
reinen tadellosen Charakter hat der Verblichenen Kiddusch Haschem
(Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten einer, wie er überhaupt in
fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum wird gewiss
sein Andenken zum Segen bleiben." Artikel in "Der Gemeindebote" vom 15. Mai 1896: "Hildburghausen,
10. Mai. Die hiesige israelitische Gemeinde und die gesamte Lehrerschaft des
Herzogtums Meiningen hat einen schweren Verlust erlitten; am 2. Mai dieses
Jahres beschloss ein sanfter Tod das Leben des verdienstvollen Seminar- und
Gemeinde Lehrers Julius Rosenthal hier. Über dessen goldenes
Dienstjubiläum im Sommer 1892 und die zahlreichen Ehrungen des Jubilars aus
dieser Veranlassung hatten sie vor vier Jahren berichtet. Das
Leichenbegängnis, das am 5. Mai stattfand, bewies aufs Neue, in welch hohem
Ansehen der entschlafene Schulmann gestanden. Denn nicht nur die ganze
Gemeinde und die sämtlichen israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen
sich der trauernden Familie des Verewigten an, sondern auch das gesamte
Seminarkollegium und die meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle
christlichen Kollegen der an 40 Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und
viele christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug
auf einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit
der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen der
herzogliche Landrabbiner von Meiningen
und Lehrer Holländer aus Berkach.
Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu Gleicherwiesen,
erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der
Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever.
1846 folgte Rosenthal einem Rufe seiner Schulbehörde und verwaltete von da
ab in der engeren Heimat die Schulstellen in
Bebra und Walldorf, bis er
endlich im Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand
und seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine
bedeutende wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein
Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und
äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die neidlos
anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des Vorstandes
vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige Hauptversammlungen
desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als auch durch seinen
reinen tadellosen Charakter hat der Verblichenen Kiddusch Haschem
(Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten einer, wie er überhaupt in
fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum wird gewiss
sein Andenken zum Segen bleiben." |
| |
 Artikel in "Der Gemeindebote" vom 22. Mai 1896:
Gleicherwiesen, 15. Mai. Als Nachtrag zu ihrem Nekrolog auf Lehrer
Rosenthal in Hildburghausen
sende ich Ihnen noch folgenden Nachruf, der an der Spitze des 'Schulblattes
für Thüringen und Franken' in Nr. 9 gestanden: 'Am 2. dieses Monats starb
nach kurzer Krankheit an Herzlähmung der israelitische Religionslehrer am
Herzoglichen Seminar in Hildburghausen
Herr J. Rosenthal, dessen Hinscheiden im Kreise der Volksschullehrer unseres
Herzogtums allgemeine Teilnahme hervorgerufen haben wird. Der Verstorbene
hat im ehemaligen Centralkomitee des allgemeinen Meiningischen Lehrervereins
als Schriftführer eine ebenso eifrige als umsichtige Tätigkeit entfaltet.
Eine ganze Reihe von Jahren widmete er in selbstloser Hingabe Zeit und Kraft
der Wahrung und Förderungen unserer Standesinteressen. Dafür wird ihm die
Lehrerschaft allezeit ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren. Das
Gute, welches er für sie gewollt und gewirkt hat, wird unvergessen bleiben.
Möge dem Abgeschiedenen nach seiner langen, treuen Sämannsarbeit auf dem
Acker der Ewigkeit eine schöne und reiche Ernte zu Teil werden. Pösneck, den
6. Mai 1896. Namens des Hauptvorstandes des allgemeinen Meiningenschen
Lehrervereins. Adam."" Artikel in "Der Gemeindebote" vom 22. Mai 1896:
Gleicherwiesen, 15. Mai. Als Nachtrag zu ihrem Nekrolog auf Lehrer
Rosenthal in Hildburghausen
sende ich Ihnen noch folgenden Nachruf, der an der Spitze des 'Schulblattes
für Thüringen und Franken' in Nr. 9 gestanden: 'Am 2. dieses Monats starb
nach kurzer Krankheit an Herzlähmung der israelitische Religionslehrer am
Herzoglichen Seminar in Hildburghausen
Herr J. Rosenthal, dessen Hinscheiden im Kreise der Volksschullehrer unseres
Herzogtums allgemeine Teilnahme hervorgerufen haben wird. Der Verstorbene
hat im ehemaligen Centralkomitee des allgemeinen Meiningischen Lehrervereins
als Schriftführer eine ebenso eifrige als umsichtige Tätigkeit entfaltet.
Eine ganze Reihe von Jahren widmete er in selbstloser Hingabe Zeit und Kraft
der Wahrung und Förderungen unserer Standesinteressen. Dafür wird ihm die
Lehrerschaft allezeit ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren. Das
Gute, welches er für sie gewollt und gewirkt hat, wird unvergessen bleiben.
Möge dem Abgeschiedenen nach seiner langen, treuen Sämannsarbeit auf dem
Acker der Ewigkeit eine schöne und reiche Ernte zu Teil werden. Pösneck, den
6. Mai 1896. Namens des Hauptvorstandes des allgemeinen Meiningenschen
Lehrervereins. Adam."" |
| |
 Artikel
in "Der Israelit" vom 1. Juni 1896: "Berkach. Am 5.
dieses Monats wurde ein viel bewährter Schulmann des Meininger Landes, Herr
Lehrer Julius Rosenthal in
Hildburghausen, zur letzten Ruhe geleitet. Geboren in Gleicherwiesen
im Jahre 1823, genoss derselbe seine Berufsbildung auf dem Landesseminar zu
Hildburghausen von 1839 bis 1842
und wirkte 54 Jahre lang als Lehrer in Wolfenbüttel,
Jever, Bibra, und
Walldorf und zuletzt in
Hildburghausen, wo er 24 Jahre als
Lehrer der jüdischen Gemeinde, sowie als Seminarlehrer für israelitische
Religion und Hebräisch tätig war. Durch seltene Begabung und
außerordentliche Strebsamkeit war es ihm gelungen, sich außergewöhnliches
Wissen anzueignen. Dies, sowie sein bescheidenes, liebevolles Wesen und
seine Hilfsbereitschaft in Wort und Tat erwarben ihm die Zuneigung aller
derer, zu denen er in näherer oder ferner Beziehung stand. Dass seine
Fähigkeit und seine Biederkeit von seinen Standesgenossen im Meininger Lande
gewürdigt wurde, ist dadurch bewiesen, dass er 20 Jahre lang Mitglied des
Zentralkomitee des Meininger Lehrervereins und längere Zeit
stellvertretender Vorsitzender der Landeslehrerversammlungen war. Und seine
Tätigkeit dabei war derart, dass viele Kollegen aus nah und fern sich bei
ihm Rates erholten und stets, soweit als möglich, Erleichterung und Hilfe
fanden. Als gründlich gebildeter Pädagoge wusste er die von ihm geleiteten
Elementarschulen, sowie seine Religionsschule zu
Hildburghausen stets auf der Höhe
der Zeit zu erhalten, und da er seit mehr als zwei Dezennien auch am Seminar
wirkte, so sind fast alle zur Zeit in unserem Ländchen amtierenden
israelitischen Lehrer seine Schüler, gewesen, die stets voll Achtung zu ihm
emporblickten. Artikel
in "Der Israelit" vom 1. Juni 1896: "Berkach. Am 5.
dieses Monats wurde ein viel bewährter Schulmann des Meininger Landes, Herr
Lehrer Julius Rosenthal in
Hildburghausen, zur letzten Ruhe geleitet. Geboren in Gleicherwiesen
im Jahre 1823, genoss derselbe seine Berufsbildung auf dem Landesseminar zu
Hildburghausen von 1839 bis 1842
und wirkte 54 Jahre lang als Lehrer in Wolfenbüttel,
Jever, Bibra, und
Walldorf und zuletzt in
Hildburghausen, wo er 24 Jahre als
Lehrer der jüdischen Gemeinde, sowie als Seminarlehrer für israelitische
Religion und Hebräisch tätig war. Durch seltene Begabung und
außerordentliche Strebsamkeit war es ihm gelungen, sich außergewöhnliches
Wissen anzueignen. Dies, sowie sein bescheidenes, liebevolles Wesen und
seine Hilfsbereitschaft in Wort und Tat erwarben ihm die Zuneigung aller
derer, zu denen er in näherer oder ferner Beziehung stand. Dass seine
Fähigkeit und seine Biederkeit von seinen Standesgenossen im Meininger Lande
gewürdigt wurde, ist dadurch bewiesen, dass er 20 Jahre lang Mitglied des
Zentralkomitee des Meininger Lehrervereins und längere Zeit
stellvertretender Vorsitzender der Landeslehrerversammlungen war. Und seine
Tätigkeit dabei war derart, dass viele Kollegen aus nah und fern sich bei
ihm Rates erholten und stets, soweit als möglich, Erleichterung und Hilfe
fanden. Als gründlich gebildeter Pädagoge wusste er die von ihm geleiteten
Elementarschulen, sowie seine Religionsschule zu
Hildburghausen stets auf der Höhe
der Zeit zu erhalten, und da er seit mehr als zwei Dezennien auch am Seminar
wirkte, so sind fast alle zur Zeit in unserem Ländchen amtierenden
israelitischen Lehrer seine Schüler, gewesen, die stets voll Achtung zu ihm
emporblickten.
Als am Sonntag, den 3. Mai die Kunde von seinem in der vorangegangenen Nacht
erfolgten Ableben sich verbreitete, zeigte sich allgemeine Teilnahme
innerhalb und außerhalb der Lehrerkreise. Der Vorstand des Lehrervereins,
Herr Lehrer Adam aus Pösneck sprach namens sämtlicher Lehrer des Herzogtums
der tiefbetrübten Witwe sein innigstes Beileid aus in gebührender
Anerkennung dessen, was der Heimgegangene seinen Kollegen gewesen. Bei der
Beerdigung war das Lehrerseminar, das Gymnasium, sowie die Stadtschule durch
sämtliche Lehrer vertreten; aus dem Lehrerkonferenzbezirke
Hildburghausen waren alle
Mitglieder, die es ermöglichen konnten, und |
 außerdem
alle israelitischen Lehrer des Meininger Landes anwesend. Der Vorstand der
Pestalozzi-Stiftung war durch Herrn Müller aus Meiningen vertreten. Die ihm
gelegentlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums von seiner Hoheit, dem
Herzog, verliehenen Verdienstmedaille wurde ihm nachgetragen. Die
Beteiligung von Seiten der Stadt war eine so außerordentliche, dass der
Leichenzug einen imposanten Eindruck machte. Auf dem Friedhofe hielt der
Herzogliche Landesrabbiner, Herr L. Fraenkel aus
Meiningen, die Leichenrede. Obgleich
derselbe erst seit einigen Monaten amtiert und den Verstorbenen nur
vorübergehend kennengelernt, hatte er doch einen solchen Einblick in dessen
Leben und Wirken gewonnen, dass er in seiner Rede ein getreues Abbild dessen
gab, was der Verstorbene seiner Familie und allen Kreisen, denen er
angehörte, gewesen. Aus der Tiefe des Herzens kommend, fanden die Worte des
Redners Widerhall bei allen Zuhörern. Hierauf sprach Herr Lehrer Holländer
aus Berkach, als sein ehemaliger Schüler,
zugleich namens seiner Kollegen einige warm empfundene Worte der Anerkennung
und des Dankes. außerdem
alle israelitischen Lehrer des Meininger Landes anwesend. Der Vorstand der
Pestalozzi-Stiftung war durch Herrn Müller aus Meiningen vertreten. Die ihm
gelegentlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums von seiner Hoheit, dem
Herzog, verliehenen Verdienstmedaille wurde ihm nachgetragen. Die
Beteiligung von Seiten der Stadt war eine so außerordentliche, dass der
Leichenzug einen imposanten Eindruck machte. Auf dem Friedhofe hielt der
Herzogliche Landesrabbiner, Herr L. Fraenkel aus
Meiningen, die Leichenrede. Obgleich
derselbe erst seit einigen Monaten amtiert und den Verstorbenen nur
vorübergehend kennengelernt, hatte er doch einen solchen Einblick in dessen
Leben und Wirken gewonnen, dass er in seiner Rede ein getreues Abbild dessen
gab, was der Verstorbene seiner Familie und allen Kreisen, denen er
angehörte, gewesen. Aus der Tiefe des Herzens kommend, fanden die Worte des
Redners Widerhall bei allen Zuhörern. Hierauf sprach Herr Lehrer Holländer
aus Berkach, als sein ehemaliger Schüler,
zugleich namens seiner Kollegen einige warm empfundene Worte der Anerkennung
und des Dankes.
Auch der Beste und Würdigste muss das Zeitliche segnen und nur der gute
Namen, das edle Streben und Wirken reicht über das Grab hinaus. Darum wird
dem Heimgegangenen nicht nur von Seiten seiner Angehörigen, sondern auch von
der Gemeinde Hildburghausen, von
seinen Schülern und Kollegen ein dankbares Andenken bewahrt bleiben.
'Die Frommen werden glänzen wie des Himmels Glanz und die, welche viele in
der Tugend bestärkt, leuchten wie die Sterne auf ewig! Daniel 12, Vers 3.
G.H."
|
Zum Tod von Löb Schloss
(geb. in Gleicherwiesen; gest. 1896 in Weißenfels)
 Artikel in "Der Gemeindebote" vom 1. Januar 1896: "Weißenfels,
4. Januar. Vor kurzem starb hier nach längerem Leiden in 73. Lebensjahre der
Rentier Löb Schloss, ein in allen Kreisen hochgeachteter Mitbürger.
Derselbe zeichnete sich durch Wohltätigkeit und einen gottesfürchtigen
Lebenswandel aus. In Gleicherwiesen im Herzogtum Meiningen geboren,
kam er vor ungefähr zwölf Jahren nach hier und machte sich recht verdient um
die Gründung einer Religionsgesellschaft, Anstellung eines geprüften
Religionslehrers, sowie Erwerbung eines ständigen Betlokals. Ein großer
Leichenzug folgte der Bahre, nicht allein jüdische, sondern auch eine
stattliche Reihe christlicher Mitbürger. Herr Lehrer Hess schilderte in
würdiger Weise die hohen Verdienste des Verblichenen. Sein Andenken sei zum
Segen!" Artikel in "Der Gemeindebote" vom 1. Januar 1896: "Weißenfels,
4. Januar. Vor kurzem starb hier nach längerem Leiden in 73. Lebensjahre der
Rentier Löb Schloss, ein in allen Kreisen hochgeachteter Mitbürger.
Derselbe zeichnete sich durch Wohltätigkeit und einen gottesfürchtigen
Lebenswandel aus. In Gleicherwiesen im Herzogtum Meiningen geboren,
kam er vor ungefähr zwölf Jahren nach hier und machte sich recht verdient um
die Gründung einer Religionsgesellschaft, Anstellung eines geprüften
Religionslehrers, sowie Erwerbung eines ständigen Betlokals. Ein großer
Leichenzug folgte der Bahre, nicht allein jüdische, sondern auch eine
stattliche Reihe christlicher Mitbürger. Herr Lehrer Hess schilderte in
würdiger Weise die hohen Verdienste des Verblichenen. Sein Andenken sei zum
Segen!"
|
70. Geburtstag des aus
Gleicherwiesen stammenden Lehrers Heinrich Oppenheimer (1903 in
Darmstadt)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 5. März 1903: ""Darmstadt.
Heinrich Oppenheimer, Lehrer und Kantor Emeritus in Darmstadt, feiert
am 8. März sein 70. Wiegenfest. Der Jubilar, im Jahre 1833 zu
Gleicherwiesen geboren, besuchte das Seminar zu
Hildburghausen, wo er eine
gediegene pädagogische und zugleich musikalische Vorbildung erhielt. Seine
sonore, außerordentlich wohllautende Stimme befähigte ihn, noch jung an
Jahren, Künstlerisch-Vollendetes zu leisten und so kam er denn, nachdem er
in Meiningen und
Butzbach als Lehrer fungiert, an die
jüdische Religionsgemeinde zu Darmstadt,
in deren herrlichem Gotteshaus der Jubilar einen Gottesdienst einführte, wie
er erhebender nicht gedacht werden kann. Auch in den dortigen Musikvereinen
wirkte er als Solist in den bekanntesten Oratorien und oft war es ihm
vergönnt, vor dem Großherzog Ludwig IV. und anderen Fürstlichkeiten seine
klangvolle Baritonstimme hören zu lassen. Besonders gewürdigt wurde er aber
als Lehrer, galt er doch als einer der befähigtsten Pädagogen am
'Maurer'schen Institute', in welchem er 18 Jahre wirkte und Kindern aus den
vornehmsten christlichen Kreisen Unterricht erteilte. Sein bitterer
Charakter, sein heiteres Gemüt, seine Jovialität erwarten ihm in allen
Kreisen der Bevölkerung unzählige Freunde, die keine Gelegenheit vorüber
gehen ließen, den würdigen Lehrer und Gott Begnadeten Sänger zu ehren. Auch
der Großherzog Ernst Ludwig zeichnete den Jubilar mehrfach durch
Ordensverleihung aus. Wir aber wünschen dem teuren und treuen Kollegen, dass
es ihm vergönnt sein möge, sich im Kreise seiner Familie eines heiteren
Lebensabends zu erfreuen und rufen ihm zu: Ad meah Schana! (= (alles
Gute) bis 100 Jahre)."
Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 5. März 1903: ""Darmstadt.
Heinrich Oppenheimer, Lehrer und Kantor Emeritus in Darmstadt, feiert
am 8. März sein 70. Wiegenfest. Der Jubilar, im Jahre 1833 zu
Gleicherwiesen geboren, besuchte das Seminar zu
Hildburghausen, wo er eine
gediegene pädagogische und zugleich musikalische Vorbildung erhielt. Seine
sonore, außerordentlich wohllautende Stimme befähigte ihn, noch jung an
Jahren, Künstlerisch-Vollendetes zu leisten und so kam er denn, nachdem er
in Meiningen und
Butzbach als Lehrer fungiert, an die
jüdische Religionsgemeinde zu Darmstadt,
in deren herrlichem Gotteshaus der Jubilar einen Gottesdienst einführte, wie
er erhebender nicht gedacht werden kann. Auch in den dortigen Musikvereinen
wirkte er als Solist in den bekanntesten Oratorien und oft war es ihm
vergönnt, vor dem Großherzog Ludwig IV. und anderen Fürstlichkeiten seine
klangvolle Baritonstimme hören zu lassen. Besonders gewürdigt wurde er aber
als Lehrer, galt er doch als einer der befähigtsten Pädagogen am
'Maurer'schen Institute', in welchem er 18 Jahre wirkte und Kindern aus den
vornehmsten christlichen Kreisen Unterricht erteilte. Sein bitterer
Charakter, sein heiteres Gemüt, seine Jovialität erwarten ihm in allen
Kreisen der Bevölkerung unzählige Freunde, die keine Gelegenheit vorüber
gehen ließen, den würdigen Lehrer und Gott Begnadeten Sänger zu ehren. Auch
der Großherzog Ernst Ludwig zeichnete den Jubilar mehrfach durch
Ordensverleihung aus. Wir aber wünschen dem teuren und treuen Kollegen, dass
es ihm vergönnt sein möge, sich im Kreise seiner Familie eines heiteren
Lebensabends zu erfreuen und rufen ihm zu: Ad meah Schana! (= (alles
Gute) bis 100 Jahre)." |
Tod von Leopold Bachmann (1916)
 Mitteilung in "Bericht der Großloge für Deutschland" 1916 Nr. 5: Mitteilung in "Bericht der Großloge für Deutschland" 1916 Nr. 5:
"50. Am 28. Mai 1916 Bruder Leopold Bachmann, Mitglied des Jacob
Plaut-Loge in Nordhausen, seit dem 13.
September 1914, geb. am 26. April 1884 in Gleicherwiesen." |
Auszeichnung von Unteroffizier
Siegfried Ehrlich mit dem Eisernen Kreuz II für seinen Kriegseinsatz (1918)
 Mitteilung in Israelitisches Familienblatt" vom 20. Juni 1918: "Gleicherwiesen.
Unteroffizier Siegfried Ehrlich, Sohn der Witwe Frau Ehrlich." Mitteilung in Israelitisches Familienblatt" vom 20. Juni 1918: "Gleicherwiesen.
Unteroffizier Siegfried Ehrlich, Sohn der Witwe Frau Ehrlich." |
Zum Tod des früheren Gemeinderates
Aaron Heinemann (1928)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. März 1928: "Gleicherwiesen.
Herr Aaron Heinemann, Repräsentanz der Gemeinde und früherer Gemeinderat,
wurde dieser Tage unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zur letzten Ruhe
bestattet. In ihm verliert die Gemeinde ihren kaum zu ersetzenden geistigen
Führer. " Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 29. März 1928: "Gleicherwiesen.
Herr Aaron Heinemann, Repräsentanz der Gemeinde und früherer Gemeinderat,
wurde dieser Tage unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zur letzten Ruhe
bestattet. In ihm verliert die Gemeinde ihren kaum zu ersetzenden geistigen
Führer. " |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen von Moses Bachmann (1890 /
1892)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 3. März 1890: "Ich suche für
meinen Sohn, der 14 Jahre alt ist und dem gute Schulzeugnisse zur Seite
stehen, zum 1. Mai eine Stelle als
Anzeige in "Der Israelit" vom 3. März 1890: "Ich suche für
meinen Sohn, der 14 Jahre alt ist und dem gute Schulzeugnisse zur Seite
stehen, zum 1. Mai eine Stelle als
Lehrling
in einem Manufaktur- oder Ledergeschäft, Sabbat und Feiertage geschlossen,
mit Kost und Logis im Hause.
M. Bachmann, Gleicherwiesen. " |
| |
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 1. Februar 1892: "Suche für meinen
Sohn, der 14 Jahre alt und mit guten Schulzeugnis versehen ist, Stelle per
1. Mai als Anzeige
in "Der Israelit" vom 1. Februar 1892: "Suche für meinen
Sohn, der 14 Jahre alt und mit guten Schulzeugnis versehen ist, Stelle per
1. Mai als
Lehrling
in einem größeren Manufaktur- oder Modewarengeschäft, dass Samstags und
Feiertage streng geschlossen ist. Kost und Logis im Hause wird gewünscht.
Moses Bachmann, Gleicherwiesen." |
Anzeige von G. Mühlfelder (1892)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 14. März 1892: "
Suche für meinen Sohn, welcher gut beanlagt, eine Lehrlingsstelle in einem
größeren Manufaktur- und Modewaren- oder Engros-Geschäft. Anzeige in "Der Israelit" vom 14. März 1892: "
Suche für meinen Sohn, welcher gut beanlagt, eine Lehrlingsstelle in einem
größeren Manufaktur- und Modewaren- oder Engros-Geschäft.
G. Mühlfelder, Gleicherwiesen, Sachsen - Meiningen." |
Anzeige von Klara Gutmann (1898)
Vgl. im Artikel "Kittel" den Abschnitt "Kittel im Judentum"
https://de.wikipedia.org/wiki/Kittel.
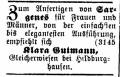 Anzeige in "Der Israelit" vom 26. Mai 1898: "Zum Anfertigen
von Sargenes für Frauen und Männer, von der einfachsten bis
elegantesten Ausführung empfiehlt sich
Anzeige in "Der Israelit" vom 26. Mai 1898: "Zum Anfertigen
von Sargenes für Frauen und Männer, von der einfachsten bis
elegantesten Ausführung empfiehlt sich
Klara Gutmann,
Gleicherwiesen bei Hildburghausen. " |
Anzeigen von N. Seligmann (1900 / 1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November
1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November
1900:
"Ein tüchtiges, selbstständiges, braves, älteres
Mädchen
zur Pflege und Stütze meiner älteren, alleinstehenden Mutter für sofort
gesucht.
N. Seligmann, Gleicherwiesen." |
| |
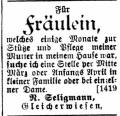 Anzeige
in "Der Israelit" vom 14. Februar 1901: "Für Anzeige
in "Der Israelit" vom 14. Februar 1901: "Für
Fräulein,
welches einige Monate zur Stütze und Pflege meiner Mutter in meinem Hause
war, suche ich eine Stelle per Mitte März oder Anfang April in kleiner
Familie oder bei einzelner Dame.
N. Seligmann, Gleicherwiesen." |
Verlobungsanzeige von Toni Kahn und
Werner Glaser (1923)
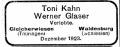 Anzeige in "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 20. Dezember
1923: Anzeige in "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 20. Dezember
1923:
"Toni Kahn - Werner Glaser
Verlobte.
Gleicherwiesen (Thüringen) - Waldenburg (Schlesien)
Dezember 1923. " |
Anzeige der Witwe Geittermann
(1924)
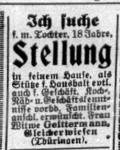 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 25. September 1924: "Ich
suche Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 25. September 1924: "Ich
suche
für meine Tochter, 18 Jahre,
Stellung
in feinem Hause, als Stütze für Haushalt eventuell auch für Geschäft. Koch-,
Näh- und Geschäftskenntnisse vorhanden. Familienanschluss erwünscht. Frau
Witwe Geittermann,
Gleicherwiesen (Thüringen), " |
Anzeige der Konditorei/Bäckerei A.
Heinemann (1925)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 15 Januar 1925: "Lehrstelle Anzeige
in "Der Israelit" vom 15 Januar 1925: "Lehrstelle
in einer Konditorei oder Bäckerei für meinen 15-jährigen Sohn
zu Ostern gesucht. Süddeutschland bevorzugt. Angebote erbittet
A. Heinemann,
Gleicherwiesen, S.-M." |
Danksagung anlässlich des Abschiedes von Rosa Katz (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar
1925: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar
1925:
"Für die vielen Beweise inniger Teilnahme beim Hinscheiden meiner
geliebten Gattin, unserer guten Mutter und Schwester
Frau Rosa Katz
sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Januar 1925.
Loeser Katz und Kinder.
Gleicherwiesen, Thüringen.
Frau B. Grünebaum
Frankfurt am Main." |
Verlobungsanzeige von Betty Katz und Bernhard
Schottenfels (1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1929:
"Betty Katz - Bernhard Schottenfels.
Verlobte.
Gleicherwiesen / Frankfurt am Main - Frankfurt am Main /
Stuttgart.
Oktober 1929." |
Verlobungsanzeige für Johanna
Heinemann und Louis Rommel (1930)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 22. Mai 1930: Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 22. Mai 1930:
"Johanna Heinemann - Louis Rommel.
Verlobte
New York Gleicherwiesen -
New York" |
Verlobungsanzeige für Irma Katz und
Erich Zaduk (1932)
Anmerkung: Erich Zaduk (geb. 1901), seine Frau Irma Zaduk geb. Katz (geb. 1900)
und die Tochter Rosa Rita Zaduk (geb. 1934 in Gleicherwiesen) wurden nach der
Deportation 1941 von Berlin nach Kowno (Kaunas) Fort IX ermordet. Vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/IX_fortas
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 21. Januar 1932: Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 21. Januar 1932:
"Irma Katz Erich Zaduk
Verlobte
Gleicherwiesen Berlin." |
Verlobungsanzeige für Frieda
Rosenberger und Hugo Lauber (1932)
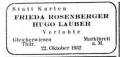 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 20. Oktober 1932: "Statt
Karten Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 20. Oktober 1932: "Statt
Karten
Frieda Rosenberger - Hugo Lauber
Verlobte
Gleicherwiesen Thüringen -
Marktbreit am Main. 22. Oktober 1932." |
Verlobungsanzeige für Hanna
Goldmeier und Josef Heinemann (1934)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 17. Mai 1934: "Hanna
Goldmeier - Josef Heinemann Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 17. Mai 1934: "Hanna
Goldmeier - Josef Heinemann
Verlobte
Fulda Königstraße 13b - Gleicherwiesen in Thüringen
Fulda " |
Todesanzeige für Sara Gärtner geb.
Kahn (1934)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juni 1934: "Unsere
geliebte Mutter, Frau Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juni 1934: "Unsere
geliebte Mutter, Frau
Sara Gaertner geb. Kahn aus Gleicherwiesen (Thüringen) ist von
ihrem Leiden erlöst worden.
Manfred Gaertner und Geschwister.
Berlin-Grunewald, Auguste-Victoria-Str. 3, 29. Mai 1934." " |
Hochzeitsanzeige für Bernhard
Schottenfels und Betty Schottenfels geb. Katz (1936)
|
 Anzeige in "Jüdische Rundschau" vom 3. Juli 1936: "Statt
Karten Anzeige in "Jüdische Rundschau" vom 3. Juli 1936: "Statt
Karten
Bernhard Schottenfels - Betty Schottenfels geb. Katz
Vermählte
Frankfurt am Main Weberstraße 25 -
Gleicherwiesen.
Trauung: Sonntag, den 5. Juli 1936, 12 1/2 Uhr,
Westendsynagoge, Freiherr-vom-Stein-Straße." |
Todesanzeige für Isaak Kahn (1938)
Anmerkung: in der Liste der aus Gleicherwiesen nach den Deportationen
Umgekommenen ist Liesel Elsoffer geb. Kahn (geb. 1907).
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juli 1938: "Nach
einem arbeitsreichen Leben entschlief am 1. Juli mein innigstgeliebter Mann,
unser treusorgender Vater, Schwiegervater, Großvater und Bruder Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. Juli 1938: "Nach
einem arbeitsreichen Leben entschlief am 1. Juli mein innigstgeliebter Mann,
unser treusorgender Vater, Schwiegervater, Großvater und Bruder
Isaak Kahn
im 73. Lebensjahre.
In tiefer Trauer: Frieda Kahn geb. Rosenthal Alfred
Altmann und Frau Toni geb. Kahn
Siegbert Kahn und Frau Meta geb. Straus Leopold
Elsoffer und Frau Liesel geb. Kahn
Coburg Rosenauerstr. 7
Ulm/Donau, Schwarzenau/Eder, Gleicherwiesen." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war vermutlich ein Betraum in einem der jüdischen
Häuser vorhanden.
1787 konnte eine Synagoge erbaut werden. Sie war gut 150 Jahre
Mittelpunkt des jüdischen Lebens am Ort.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
von einem SS-Kommando aus Hildburghausen überfallen. Das Mobiliar und die Kultgegenstände
wurden auf einem Leiterwagen an das Milzufer gebracht und dort verbrannt. Den
Leiterwagen mussten jüdische Männer der Gemeinde ziehen, anschließend wurden sie
misshandelt, inhaftiert und in das KZ Buchenwald verbracht. Eine Brandstiftung
wurde dadurch verhindert, dass einheimische Bauern auf die Gefahr für ihre
Scheunen durch den Funkenflug hinwiesen.
Das nun leer stehende Fachwerkgebäude blieb erhalten. Zunächst wollte es - mit
Unterstützung durch den Bürgermeister - die Hitlerjugend für ihre Versammlungen
haben. Der Landrat von Hildburghausen schlug vor, das Gebäude für die
Freiwillige Feuerwehr Gleicherwiesen zu verwenden. 1943 wurde das
Synagog4engebäude wegen angeblicher "Baufälligkeit" abgebrochen. Das
Grundstück blieb unbebaut (heute Wiese).
Adresse/Standort der Synagoge: Mittelgasse
Fotos
Skizze der Synagoge
(aus dem Beitrag von E. Witter, s.u.) |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Das "Haus
Bachmann"
in Gleicherwiesen im ehemaligen Schloss
(Website "Everything
Bibra web page") |
 |
 |
| |
Gesamtansicht des
Fotos:
nachstehend drei |
Firmenschild: "M. &
H. Bachmann, Inhaber
Hermann & Carl Bachmann" |
| |
|
|
 |
 |
 |
Ansicht des ehemaligen
Schlosses / "Haus Bachmann"
um 2005 (aus dem Beitrag von E. Witter s.u.) |
Ausschnittvergrößerungen
des obigen Fotos mit Personen vor dem Geschäft
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| Juni 2020:
Über die frühere jüdische
Gemeinde in Gleicherwiesen
|
Artikel
von Wolfram Nagel in der "Jüdischen Allgemeinen" vom 18. Juni
2020:
"Thüringen. Besuch in Gleicherwiesen. Im Kreis Hildburghausen gab
es ein ausgeprägtes Landjudentum
Eckhard Witter steht an einem Lattenzaun hinter der schon seit Jahren
geschlossenen Dorfgaststätte. Dort, auf dieser Wiese, stand bis zu ihrem
Abriss 1943 die Synagoge, erklärt der Ortschronist. Fotos gebe es nicht,
aber einen Bauplan und ein Schriftstück vom 6. Januar 1939. Darin schlug der
Landrat von Hildburghausen vor, das leer stehende Fachwerkgebäude als
Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Gleicherwiesen zu nutzen. Auf die
Idee des Bürgermeisters, den 'ehemaligen Schulraum' für die Hitlerjugend
herzurichten, ging er nicht ein.
Ein Rollkommando versuchte in der Pogromnacht, die Synagoge anzuzünden. Das
hätten die einheimischen Bauern mit einem Vorwand verhindert, berichtet der
pensionierte Lehrer. 'Sie haben gesagt, unsere Scheunen sind voll.
Funkenflug könnte sie in Brand stecken.' Daraufhin seien Möbel und
Ritualgegenstände auf einem Leiterwagen ans Milzufer gebracht und dort
verbrannt worden. 'Ziehen mussten ihn die jüdischen Männer, die anschließend
von den SA-Leuten misshandelt und nach Buchenwald geschafft wurden.'
Deportationen. 1942 deportierten die Nazis die letzten noch
verbliebenen Juden des Dorfes und besiegelten damit das Ende einer der
ältesten jüdischen Landgemeinden in Südthüringen. Geblieben sind der
Friedhof außerhalb des Ortes und spärliche Erinnerungen. Eines der wenigen
historischen Fotos zeigt Hausangestellte der Firma Bachmann vor dem
ehemaligen Schloss zu Bibra um 1900. Die Bachmanns hatten es gekauft und
umgebaut. Im Erdgeschoss befanden sich zu DDR-Zeiten der Konsum und das
Gemeindebüro. Einen Hinweis auf die jüdische Geschichte des gut erhaltenen
Gebäudes an der Lindener Straße gibt es bis heute nicht.
Um 1680 hatten sich unter dem Schutz der fränkischen Reichsritter von Bibra
die ersten Juden hier in Südthüringen niedergelassen. Um 1680 hatten
sich die ersten Juden hier niedergelassen, unter dem Schutz der fränkischen
Reichsritter von Bibra. 'Nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Herren
von Bibra einige 1671 aus dem Hochstift Fulda vertriebene Juden aufgenommen
haben', schreibt der Hildburghauser Heimatforscher Karl-Heinz Roß in der von
Hans Nothnagel herausgegebenen sechsbändigen Dokumentation des Thüringer
Landjudentums (Juden in Südthüringen, geschützt und gejagt, Suhl 1999). 1743
erhielt Gleicherwiesen das Privileg eines Marktfleckens. 1786 vereinigen
sich die jüdischen Gemeinden von Gleicherwiesen und dem benachbarten
Simmershausen. Sie legen später auch gemeinsam den Friedhof an. Bis 1847
mussten sie ihre Toten noch in
Kleinbardorf bei Bad Königshofen/Grabfeld im Unterfränkischen bestatten.
'Da schaut emol jetzt um: Eine berühmte Handelsstadt / ist Gleicherwiesen –
seit es Juden hat', heißt es in einem Richtfestspruch von 1856. Mehr als 40
Prozent der Dorfbevölkerung waren in dieser Zeit jüdisch. 1865 eröffnete die
auf etwa 250 Mitglieder angewachsene Gemeinde ihre neue Synagoge, mitgebaut
von den christlichen Nachbarn.
Aufschwung Nach Erlangung allgemeiner Bürgerrechte Mitte des 19.
Jahrhunderts erlebte die Gemeinde einen großen Aufschwung (ähnlich wie in
Franken und Hessen). Dafür stehen neben Gleicherwiesen auch Orte wie
Aschenhausen,
Berkach,
Bauerbach,
Dreißigacker,
Marisfeld bei Themar oder
Vacha in der Rhön. Erhalten
geblieben sind die Synagogen von
Aschenhausen und Berkach. Letztere
wurde restauriert und kann seit 1991 von der Landesgemeinde wieder als
Betraum genutzt werden.
Bis in die 20er-Jahre hinein prägten jüdische Geschäftsleute das
dörfliche Leben in Gleicherwiesen. Doch die gewonnenen Bildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten hatten auch einen Preis für das Landjudentum. Viele
junge Leute wanderten in die Städte ab. Dennoch prägten bis in die
20er-Jahre hinein jüdische Geschäftsleute das dörfliche Leben in
Gleicherwiesen. 'Es gab hier alles zu kaufen, landwirtschaftliche Maschinen,
Kunstdünger, Möbel, Kleidung, Modeartikel, Kleinhandel und so weiter.'
Nirgends sonst habe es so viele jüdische Handwerker gegeben, berichtet
Witter. 'Einen Schneider, eine Bäckerei, die Schächterei von Albert Levy,
die Gerberei und Lohmühle Bachmann. Und schon früh einen jüdischen Lehrer,
Leo Kahn.' Der auf dem Friedhof beerdigt ist. Nach der Reichsgründung 1871
erkannte die Regierung des Herzogtums Sachsen-Meiningen die jüdische Schule
als Volksschule an, als einzige im Land. Volksschullehrer Jacob Mühlfelder
unterrichtete christliche und jüdische Kinder gemeinsam.
Gedenktafel Heute finden Besucher den einzigen Hinweis auf die
jüdische Geschichte von Gleicherwiesen in der Dorfkirche. Rechts neben dem
Altar wurde 60 Jahre nach der Pogromnacht ein Holzbild angebracht: 'Im
Gedenken an die jüdischen Frauen, Männer und Kinder, die hier lebten
1848–1943'. Über dem Schriftzug sind die Umrisse von Menschen zu sehen, die
das Dorf verlassen. Ein einzelner Mann blickt fassungslos ins Leere. Pfarrer
Hans-Michael Buchholz aus Gleichamberg bemerkte, dass langsam die Erinnerung
an das jüdische Erbe verloren geht.
Initiator dieser an einen jüdischen Grabstein erinnernden Gedenktafel ist
Pfarrer Hans-Michael Buchholz aus Gleichamberg. Er habe gemerkt, dass
langsam die Erinnerung verloren geht, gerade unter den Jugendlichen. 'Da
haben wir überlegt, wie können wir das auffangen? Eine Gedenktafel draußen,
am Platz der alten Synagoge? Das ist immer ein bisschen gefährlich. Aber
hier in der Kirche ist ein sicherer Platz, zumal es einmal ein gutes
dörfliches Zusammenleben zwischen Christen und Juden gegeben hat.'
Von 91 jüdischen Einwohnern lebten nach der Machtübernahme der Nazis 1933
noch 42 in Gleicherwiesen. Einigen, wie Alfred Levy, gelang es zu
emigrieren, andere, wie Selma Schloß, Emmanuel Mühlfelder oder Sophie
Neumann, wurden in Minsk, Auschwitz oder Theresienstadt ermordet. 1940 gab
es die letzte Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof von Gleicherwiesen. Emma
Kahns schlichter Grabstein befindet sich gleich rechts neben dem
Eingangstor.
Der von einem einfachen Holzzaun umschlossene Gute Ort am Streufdorfer Weg
beherbergt rund 200 Gräber. Gepflegt wird er von der Freiwilligen Feuerwehr,
betreut und verwaltet von der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. "
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Karl-Heinz Roß: "Seit Gleicherwiesen Juden
hat, wird es berühmte Handelsstadt" (Aus einem Richtfestspruch des
Jahres 1856). In. Hans Nothnagel
(Hrsg.): Juden in Südthüringen - geschützt und gejagt. Band 2: Juden in
den ehemaligen Residenzstädten Römhild, Hildburghausen und in deren Umfeld. Suhl
1998 S. 75-91. |
 | Siegfried Erbach / Hans Nothnagel: Ein
Rückblick auf jüdisches Leben in Simmershausen. In: Juden in
Südthüringen geschützt und gehagt. Bd. 2 Suhl
1998. |
 | Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen. Berlin 1992. S. 272. |
 | Israel Schwierz: Zeugnisse jüdischer Vergangenheit
in Thüringen. Eine Dokumentation - erstellt unter Mitarbeit von Johannes
Mötsch. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ( www.lzt.thueringen.de)
2007. Zum Download
der Dokumentation (interner Link). Zu Gleicherwiesen: S. 135-139. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Band 8 Thüringen. Frankfurt am Main 2003. S. 124. |
 | Eckhard Witter: Aus der Geschichte der Juden in
Gleicherwiesen - für die Ortschronik von Gleicherwiesen zusammengestellt.
2015.
Eingestellt als pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Gleicherwiesen,
Thuringia. Jews first settled here in 1680 and a synagogue was dedicated in
1787. In 181, there were 139 Jews (26 families) in Gleicherwiesen, with 233 in
1875 and 46 in 1925. Following the Nazi assumption of power in 1933, most of the
26 Jews remaining sold their belongings and left. On Kristallnacht (9-10 November
1938), the synagogue's interior was ransacked and the building partly destroyed.
Jewish stores and homes and the cemetery were vandalized and Jewish men were
arrested and deported to the Buchenwald concentration camp. At least six Jews
were deported to their deaths in 1942. No further information is available about
those who failed to emigrate to safe havens overseas.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|