|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Bad Dürkheim"
Wattenheim (VG
Leiningerland, Kreis
Bad Dürkheim)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Wattenheim bestand eine jüdische Gemeinde bis um
1900. Ihre Entstehung geht in die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts
zurück. 1801 werden noch keine jüdischen Einwohner genannt (oder
möglicherweise bei der damaligen Zählung nicht erfasst), 1808 waren es 30
jüdische Einwohner, 1825 32 (3.3 % von der Gesamteinwohnerschaft). Dabei
handelte es sich (um 1810) um die vier jüdischen Familien des Joseph Lang,
Jacques Mann, Simon Michel und Lazare Strauß. Bis 1848 stieg die Zahl der
jüdischen Familien auf 12 mit zusammen 70 Personen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen
Einwohner durch Aus- und Abwanderung schnell zurück. 1875 wurden nur
noch 28 jüdische Einwohner gezählt, 1900 12. 1881 schloss sich die
jüdische Gemeinde Wattenheim mit ihren wenigen Mitglieder der Kultusgemeinde in
Hettenleidelheim an. Als auch dort
die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder sehr stark zurückging, erfolgte 1896
der Zusammenschluss der jüdischen Einwohner aus Hettenleidelheim,
Neuleiningen und Hertlingshausen zu
einer jüdischen Gemeinde mit Sitz in Wattenheim. Vorsteher der Gemeinde war in
den folgenden Jahren Nathan Köster. Seit 1905 kamen auch die noch in Altleiningen
lebenden jüdischen Personen zur Gemeinde in Wattenheim. 1920 bestand die Gemeinde insgesamt aus je
zwei Familien in Wattenheim und Hettenleidelheim, drei Familien in Hertlingshausen und inzwischen - durch dortigen Zuzug seit den 1870er-Jahren - zwölf
Familien in Eisenberg.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule
(seit 1849 im Gebäude der alten Synagoge) und vermutlich auch ein rituelles
Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof (alter und
neuer Friedhof) in Hettenleidelheim
beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Frankenthal-Bad
Dürkheim.
Um 1925, als in Wattenheim selbst nur noch eine jüdische Familie wohnte, waren die Vorsteher der
- in allen oben genannten Teilorten - insgesamt 38 Personen umfassenden Gemeinde
die Herren Nathan Mann, Isaak Michel, Wilhelm Fröhlich und Georg Hairt. 1927 verzog die letzte jüdische Familie
aus Wattenheim nach Lampertheim. Da zumindest theoretisch wieder eine Familie in
Wattenheim zuziehen konnte, wurde der Ort gemeinsam mit Hettenleidelheim,
Hertlingshausen, Altleiningen, Neuleiningen und Kerzenheim zur
jüdischen Gemeinde in Eisenberg gerechnet.
Von den in Wattenheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna Gertrud Jeanne
Durlacher geb. Mann (1907), Adam Nathan Köster (1854), Josef Köster (1865), die
drei Geschwister Walter Jacob Ludwig Mann (geb. 1897 in Wattenheim, später
in Leipzig), Lilly Mann (geb. 1895 in Wattenheim, später in Mannheim) und
Richard Mann (geb. 1898 in Wattenheim, später in Düsseldorf). Siegbert Mann
(1904), Berta Sommer geb. Schlossstein (1863), Babette Weiß geb. Köster
(1854).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
| In jüdischen Periodika des 19./20.
Jahrhunderts wurden noch keine Berichte zur jüdischen Geschichte in
Altleiningen gefunden. |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betsaal beziehungsweise eine erste
Synagoge vorhanden. Sie wird erstmals 1812 genannt. 1833 wurde
von den jüdischen Einwohnern aus Hettenleidelheim
berichtet, dass diese "seit 21 Jahren die jüdische Schule (gemeint
Synagoge) in Wattenheim" besuchen. Nach diesem Bericht wird die Synagoge in
Wattenheim als eine "eher schlechte Betstube" geschildert. Aus einem
wenige Jahre später erstellten Bericht erfährt man, dass der Betsaal im
rückwärtigen Teil eines Hauses an der Hauptstraße eingerichtet worden war.
Das Grundstück sei "vor sehr langer Zeit" an den Juden Seligmann
schenkungsweise übertragen worden.
Nach Einrichtung der neuen Synagoge (1849) wurde die alte Synagoge noch einige
Jahre für den Religionsunterricht verwendet. 1892 verkaufte die jüdische
Gemeinde das Gebäude der Synagoge zusammen mit dem als Wohnhaus genutzten
Vorderhaus an den Sattlermeister Daniel Hepp. Dieser ließ es 1893 abbrechen.
Auf dem Grundstück wurde eine Werkstatt mit Waschküche erbaut.
1847/48 erwarb die israelitische Kultusgemeinde einen Garten an der
Hauptstraße und erbaute hier eine Synagoge. Die Synagoge soll ein mit Walmdach,
Rundbogenfenstern und Empore versehenes kleines Gebäude gewesen sein.
1896 wurde das Gebäude renoviert, insbesondere das Dach erneuert und
Regenwasserschäden im Inneren beseitigt. Nachdem 1912 mehrfach die
Fensterscheiden eingeworfen worden waren, wollte die Gemeinde eiserne
Fensterläden anbringen und eine Mauer um das Grundstück errichten.
Nachdem auf Grund des Wegzuges der jüdischen Familien aus Wattenheim die
Synagoge nicht mehr gebracht wurde, ist sie von der Israelitischen Gemeinde der
Pfalz der katholischen Kirchenverwaltung Wattenheim als Geschenk angeboten
worden. Die Kirchenverwaltung kam nach Besichtigung des Gebäudes zum
Entschluss, das Gebäude anzunehmen. In konservativ-orthodoxen jüdischen
Kreisen wurde die Nachricht von der Schenkung einer Synagoge an die katholische
Kirche allerdings mit Unverständnis aufgenommen. Man konnte sich nicht
vorstellen, dass die ehemalige Synagoge möglicherweise als Kirche genutzt
werden sollte.
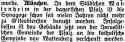 Meldung
in der (konservativ-orthodoxen) Zeitschrift "Der Israelit" vom
4. Dezember 1930: "München. In dem Städtchen Wattenheim in
der bayerischen Pfalz ist die Synagoge schon seit vielen Jahren nicht mehr
zu G'ttesdiensten benutzt worden. Infolgedessen ist das Gebäude jetzt von
der Israelitischen Gemeinde der Pfalz an die katholische Gemeinde von
Wattenheim verschenkt worden." Meldung
in der (konservativ-orthodoxen) Zeitschrift "Der Israelit" vom
4. Dezember 1930: "München. In dem Städtchen Wattenheim in
der bayerischen Pfalz ist die Synagoge schon seit vielen Jahren nicht mehr
zu G'ttesdiensten benutzt worden. Infolgedessen ist das Gebäude jetzt von
der Israelitischen Gemeinde der Pfalz an die katholische Gemeinde von
Wattenheim verschenkt worden." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1930:
"(Die verschenkte Synagoge.) Vor kurzem brachten wir die
Notiz, dass im Orte Wattenheim in der Pfalz die verlassene Synagoge der
katholischen Gemeinde geschenkt wurde. Zu dieser unglaublichen Meldung
wird nunmehr vom Vorstande des 'Verbandes Israelitischer Kultusgemeinden
in der Pfalz' eine Erklärung gegeben, in der es u.a. heißt: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1930:
"(Die verschenkte Synagoge.) Vor kurzem brachten wir die
Notiz, dass im Orte Wattenheim in der Pfalz die verlassene Synagoge der
katholischen Gemeinde geschenkt wurde. Zu dieser unglaublichen Meldung
wird nunmehr vom Vorstande des 'Verbandes Israelitischer Kultusgemeinden
in der Pfalz' eine Erklärung gegeben, in der es u.a. heißt:
'Zur Zeit sind in der Pfalz u.a. drei ehemalige ansehnliche
Kultusgemeinden entweder vollständig oder nahezu verwaist: Edesheim (bei
Landau), Fußgönheim (bei Ludwigshafen) und Wattenheim (bei Grünstadt).
Eine ganze Reihe von pfälzischen israelitischen Friedhöfen muss bereits
von dem Verbande pfälzischer israelitischer Gemeinden unter Aufwendung
ansehnlicher Geldmittel unterhalten werden. Anders mit den verwaisten
Synagogen. Sollen sie nicht ganz dem baulichen Verfall anheimgegeben sein,
so bleibt eben nichts anderes übrig, als sie zu veräußern. So wurde in
den letzten Wochen die Synagoge zu Wattenheim, nachdem die letzte
israelitische Familie daselbst schon vor Jahren nach Lampertheim
übersiedelte, vom Verbande der pfälzischen israelitischen Gemeinden der
katholischen Kultusgemeinde Wattenheim geschenkweise übertragen, nachdem
der besagte Verband die Gewissheit hatte, dass das Wachenheimer
Synagogengebäude auch in Zukunft nur ernsten, menschenfreundlichen und
wohltätigen Zwecken dienen wird. Nach Lage der Sache erschien eine
öffentliche Versteigerung der Synagoge unratsam, weil eben dann diese
Gewissheit nicht gegeben war.'
Unklar genug bleibt immer noch die Sache. Man hat in anderen ähnlichen
Fällen Synagogen unter den Schutz von weltlichen und kirchlichen
Behörden gestellt. Eine bedingungslose Verschenkung berechtigt aber die
geschenkte Gemeinde, die Synagoge auch in eine Kirche umzuwandeln. Und das
wäre doch auf alle Fälle etwas Ungeheuerliches!"
|
| 1937 wurde in einem Presseartikel von
Ludwig Strauß nochmals auf den Verkauf der Synagoge in Wattenheim Bezug
genommen, inzwischen unter völlig anderen Umständen: |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Dezember 1937: "Aus der Pfalz. Auflösung jüdischer Gemeinden -
Verkauf der Synagogen - Das Los unserer Friedhöfe. Von
Synagogenvorstand Ludwig Strauß (Bad Dürkheim). Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Dezember 1937: "Aus der Pfalz. Auflösung jüdischer Gemeinden -
Verkauf der Synagogen - Das Los unserer Friedhöfe. Von
Synagogenvorstand Ludwig Strauß (Bad Dürkheim).
Im Jahre 1933 erhob ich in einer Mitgliederversammlung unseres pfälzischen
Gemeindeverbandes den Hilferuf: 'Rettet die absterbenden Landgemeinden!'
Die Rettung ist ausgeblieben. Das Verhängnis ist nicht mehr abzuwenden.
Die Landgemeinden und auch die Gemeinden der Kleinstädte gehen von Tag zu
Tag mehr und mehr ihrer Auflösung, ihrem Ende entgegen. Als wir vor einem
Jahrzehnt die Synagoge in Wattenheim der dortigen katholischen
Kirche zur Errichtung einer Kleinkinderschule übergaben - weil eben die
letzte israelitische Familie Wattenheim verlassen hatte - da erhoben
mehrere größere jüdische Zeitungen heftige Vorwürfe gegen unsern
Verband.
Heute - dem Himmel sei es geklagt - berichten unsere jüdischen Zeitungen
fast in jeder Nummer von der Auflösung jüdischer Gemeinden, von dem
Verkaufe dieser und jener Synagoge. Wir müssen es hinnehmen.
Unser Pfalzverband hat bis heute 12 jüdische Gemeinden auflösen und ihre
Synagogen veräußern müssen. Das ist immer nach Anhörung der wenigen
Familien der Gemeinden - ihre Zahl ging durchweg über zwei oder drei nicht
hinaus - und mit deren Einverständnis geschehen. Wir haben jede Synagoge
vor dem Verkaufe eingehend besichtigt, alle Torarollen und die sonstigen
Ritualien in Obhut genommen. Manche dieser Synagogen ließen schon beim
Eintritt erkennen, dass seit Jahren kein Gottesdienst mehr in ihnen
stattgefunden, in anderen herrscht noch eine wohltuende Ordnung und
Reinlichkeit und der Aron Hakodesch trug noch vom letzten Gottesdienst her
ein weißes Gewand..." |
Obwohl das Gebäude der ehemaligen Synagoge im Besitz der
katholischen Kirchengemeinde war, wurde es beim Novemberpogrom 1938 dennoch
verwüstet. Wenige Tage nach der Schändung des Gebäudes beschloss die
Kirchenverwaltung am 22. November 1938 einstimmig, das Gebäude mit dem Hof für
200 Reichsmark an ein Ehepaar zu verkaufen. Dieses wollte das Gebäude zu einem
Wohnhaus umbauen, wozu freilich die behördliche Genehmigung nicht erteilt
wurde. Der neue Besitzer ließ daraufhin das Gebäude 1939 abbrechen und
legte auf dem 125 qm großen Grundstück einen Garten
an.
Adresse/Standort der Synagoge:
Straße "An der Synagoge" (zweigt von der Hauptstraße
ab)
Fotos
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter
besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.
S. 157. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 380 (mit weiteren Literaturangaben).
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|