|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zur Übersicht
"Synagogen im Donnersbergkreis"
Obermoschel (VG
Nordpfälzer Land, Donnersbergkreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Obermoschel
bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/39. Ihre Entstehung geht in die Zeit
des 18. Jahrhunderts zurück. Doch gab es bereits im Mittelalter Juden in
der Stadt. Nach dem Deutzer Memorbuch traf sie die Verfolgung in der Pestzeit 1348/49.
Auch 1429 wird ein Jude in Obermoschel genannt (Jud Salman, dem ein
Bergwerk im Selberg verliehen wird).
Danach lassen sich allerdings erst wieder in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts einzelne Juden nachweisen: 1674 wird ein jüdischer
Einwohner in der Stadt genannt. Bis Ende des 18. Jahrhunderts lebten zwei
bis fünf jüdische Familien in Obermoschel (1786 vier Familien). 1744 ist in
Obermoschel Elias Marx geboren, der sich später in
Ruppertshofen
niederließ (gest. 1823 ebd.).
Aus der Zeit des berüchtigten Räubers "Schinderhannes" (um 1800)
wird berichtet, dass dieser in Obermoschel in ein jüdisches Haus eingebrochen
sei, aber von wachsamen nichtjüdischen Bürgern in die Flucht geschlagen wurde.
Er entwich durch ein 'Törchen' in der Stadtmauer.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1801 36 jüdische Einwohner (5,0 % der Gesamteinwohnerschaft),
1808 43 (5,6 %), 1825 53 (5,3 %), 1837 75, 1844 64, 1861 69 in 15 Familien, 1867
81, 1880 60, 1885 77, 1890 und 1895 je 86, 1910 70, 1918 71.
1809/10 werden an jüdischen Haushaltsvorstehern genannt: Elias Landsberg
(Händler), Jacques Landsberg (Schrotthändler), Joseph Schneeberger (Händler),
Isaac Seligberg (Schrotthändler), Louis Simon (Händler), Abraham Stern (Händler)
und David Stern (Händler).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule (jüdische
Elementarschule bis 1926), ein rituelles Bad und ein
Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. unten die
Ausschreibungen der Stelle). Einer der Lehrer war bis 1868 Feist Straus (zu
seiner Biographie siehe Bericht unten), ein anderer dessen Schwiegersohn Lehrer
Leopold Gutmann (bis 1898 Lehrer in Obermoschel, danach lange Jahre Lehrer in
Oettingen).
Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Kaiserslautern.
Die jüdischen Familien waren im Leben der Stadt weitestgehend integriert.
Bereits 1853 wurde mit Elias Simon ein jüdischer Einwohner in den Stadtrat gewählt.
Viele jüdische Gemeindeglieder waren in den Vereinen der Stadt Mitglied.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Alfred Brück
(geb. 13.12.1882 in Obermoschel, gef. 26.9.1916) und Lehrer Siegmund Löb (geb.
22.6.1883 in Steinbach am Glan, gef. 4.5.1918). Außerdem sind gefallen:
Gefreiter Ludwig Gutmann (geb. 20.10.1897 in Obermoschel, Sohn des damaligen
Lehrers Leopold Gutmann, vor 1914 in Oettingen
wohnhaft, gef. 6.6.1918) und Hugo Stern (geb. 8.7.1897 in Obermoschel, vor 1914
in Bad Kreuznach wohnhaft, gef. 28.11.1917).
Um 1924, als zur Gemeinde noch 41 Personen gehörten (2,8 % von insgesamt
1.492 Einwohnern, dazu drei Gemeindeglieder in Niedermoschel und vier in
Odernheim),
waren die Gemeindevorsteher Albert Brück, Leopold Rheinstein, Josef
Maier und Isaak Brück. Als Religionslehrer und Kantor war S. Langstädter in
der Gemeinde tätig. Er erteilte damals vier Kindern der Gemeinde den
Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen gab es insbesondere den Wohltätigkeitsverein
Gemillus Chesed (1924 unter Leitung von Albert Brück). 1932 waren
die Gemeindevorsteher Julius Lob (1. Vors.), Leo Lorig (2. Vors.), Sally Speier
(3. Vors.).
1933 lebten noch 35 jüdische Personen in Obermoschel (von insgesamt
etwa 1.300 Einwohnern).
In den folgenden Jahren ist ein Großteil von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1938 wurden noch 23
jüdische Einwohner gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
verwüstet (s.u.). 1939 wurden noch 12 jüdische Einwohner gezählt. Die letzten
neun wurden im Oktober 1940 nach Gurs deportiert.
Von den in Obermoschel geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Alexander geb.
Abraham (geb. in Obermoschel; Suizid in Köln nach Aufforderung zur Deportation
nach Lódz am 29.10.1941);
Emma
Brunner geb. Rheinstein (1871), Adolf Brück (1870), Jenny (Johannette) Brück
geb. Mayer (1885), Oskar Brück (1880), Karoline Fuhrmann geb. Strauss (1866),
Heinz Justinus Isidor Langstädter (1921, Sohn des Lehrers Siegfried
Langstädter in Venningen), Karl Lorig (1923), Leo Lorig (1892),
Recha Lorig geb. Brück (1899), Henriette Löb geb. Kahn (1882), Julius Löb
(1879), Ida Strauss (1886), Otto Strauss (1894), Mathilde Strauß geb. Neu
(1873), Erna Wahnschaffe geb. Brück (1890).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1848 / 1889 /
1898
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar 1848:
"Erledigung der israelitischen Schulstelle zu Obermoschel in der
Pfalz, Königreich Bayern. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar 1848:
"Erledigung der israelitischen Schulstelle zu Obermoschel in der
Pfalz, Königreich Bayern.
Durch die heimliche Entfernung des Lehrers Löb ist die israelitische
Schulstelle zu Obermoschel in Erledigung gekommen und soll demnächst
wieder besetzt werden. Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche mit
beigefügten Befähigungs- und Moralitätszeugnissen binnen 6 Wochen an
das unterfertigte Amt einzusenden.
Der Gehalt des Lehrers besteht in:
1) Einhundert Gulden, welche von den israelitischen Kultusgenossen erhoben
werden 100 Fl.
2) Fünfzig Gulden an Schulgeld auf die schulpflichtigen Kinder
repartiert 50 Fl.
3) Wohnung, veranschlagt zu 25 Fl.
4) Mietzins aus dem Keller unter dem Gebäude 15 Fl.
5) dem mittelst Entschließung hoher königlicher Regierung vom 12. Juli
1843 zugesicherten jährlichen Zuschusse aus dem Kreisschulfond ad 35
Fl.
6) einem Beitrage aus der Gemeindekasse von jährlich 25
Fl.
7) Kasualien 50 Fl.
Ferner werden dem Lehrer für die Beheizung und Reinigung der
Schullokalitäten sowohl, als der Synagoge, das Anzünden und Auslöschen
der Lichter bei gottesdienstlichen Verrichtungen, die Beheizung der Schule
am Sabbate und an Feiertagen des Morgens und Abends vor dem Gottesdienste
zugesichert 30 Fl.
Summa 330 Fl.
Zugleich wird bemerkt, dass der anzustellende Lehrer das Amt als
Vorsänger zu versehen habe und musikalisch gebildet sein müsse, damit er
den Chor gehörig einüben und leiten könne.
Obermoschel, den 15. Dezember 1847.
Das Bürgermeisteramt. Max Neu." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1889: "Durch die
Pensionierung des Schulverwesers Schwarz ist die Verweserstelle an der
israelitischen Schule zu Obermoschel in Erledigung gekommen, und wird
hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit derselben sind folgende
Gehaltsbezüge verbunden: 1) Vorbetergehalt
Mark 242.80 2)
Schulverwesergehalt Mark
428.60 3) Zuschuss aus
Staatsfonds Mark 190.-
4) Wohnungsentschädigung Mark
100.- zusammen: Mark 951,40. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1889: "Durch die
Pensionierung des Schulverwesers Schwarz ist die Verweserstelle an der
israelitischen Schule zu Obermoschel in Erledigung gekommen, und wird
hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit derselben sind folgende
Gehaltsbezüge verbunden: 1) Vorbetergehalt
Mark 242.80 2)
Schulverwesergehalt Mark
428.60 3) Zuschuss aus
Staatsfonds Mark 190.-
4) Wohnungsentschädigung Mark
100.- zusammen: Mark 951,40.
Für Beheizung des Lehrsaales werden 51 Mark, für Instandhaltung und
Reinigung der Synagoge und des Lehrsaales 50 Mark vergütet; außerdem
wird die im Schulhause vorhandene Wohnung dem Schulverweser überlassen; für
Kellermiete kann derselbe ca. 36 Mark erzielen. Der Schächterdienst, mit
einem Einkommen von ca. 300 Mark, kann mit der erledigten Stelle verbunden
werden. Bei entsprechenden Leistungen ist die Umwandlung der Stelle in
eine Lehrerstelle beabsichtigt. Bewerbungsgesuche wollen bis längstens
den 31. Januar bei dem Unterzeichneten eingereicht werden. Obermoschel,
den 29. Dezember 1888. Der Vorstand: Julius Stern." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1889: "Nachdem
Schulverweser Schwarz nunmehr definitiv pensioniert ist, wird die hiesige
Schulverweserstelle hiermit wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit
derselben sind folgende Gehaltsbezüge verbunden: Gehalt als Vorbeter Mark
242.80, Gehalt als Schulverweser Mark
428.60. Zuschuss aus der
Staatskasse Mark 180.- Wohnungsentschädigung
Mark 100.- für
Beheizung des Lehrsaals Mark
51.- für Instandhalten und
Reinigen der Synagoge sowie des Lehrsaals Mark 50.-
Schächterdienst mutmaßlich Mark 300.-
ferner freie Wohnung im Schulhause mit Keller (aus letzterem können
durch Vermietung ca. Mark 36 erzielt werden). Bei Konvenierung ist die
Umwandlung der Stelle in eine Lehrerstelle beabsichtigt. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1889: "Nachdem
Schulverweser Schwarz nunmehr definitiv pensioniert ist, wird die hiesige
Schulverweserstelle hiermit wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Mit
derselben sind folgende Gehaltsbezüge verbunden: Gehalt als Vorbeter Mark
242.80, Gehalt als Schulverweser Mark
428.60. Zuschuss aus der
Staatskasse Mark 180.- Wohnungsentschädigung
Mark 100.- für
Beheizung des Lehrsaals Mark
51.- für Instandhalten und
Reinigen der Synagoge sowie des Lehrsaals Mark 50.-
Schächterdienst mutmaßlich Mark 300.-
ferner freie Wohnung im Schulhause mit Keller (aus letzterem können
durch Vermietung ca. Mark 36 erzielt werden). Bei Konvenierung ist die
Umwandlung der Stelle in eine Lehrerstelle beabsichtigt.
Obermoschel (Rheinpfalz). Der Kultusvorstand: Julius Stern." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juni 1898: "Besetzung der
israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel. Vorbehaltlich Genehmigung
hoher königlicher Regierung wird hiermit die israelitische
Volksschullehrerstelle zu Obermoschel, mit welcher der Vorbeter- und Schächterdienst
verbunden ist, mit nachfolgenden Bezügen zur Bewerbung ausgeschrieben:
Gehalt als Lehrer Mark
430.- Gehalt als Vorsänger
Mark 244.- Beitrag aus
Staatsfonds Mark 180.-
Kreisaufbesserungszuschuss Mark
70.- Wohnungsentschädigung
Mark 100.- Erträge aus dem
Schächterdienst ca. Mark 250.- Für
Beheizung des Schulsaales Mark
50.- Für Reinigung der
Synagoge und Schulsaal Mark
50.- Erträgnis aus der Miete
des Schulkellers Mark 36.- Summa:
Mark 1410. Für einen ledigen Herrn ist im Schulhause freie Wohnung
vorhanden. Meldetermin 7. Juli dieses Jahres. Bewerber, welche ein
bayerisches Seminar besucht und in Bayern die Anstellungsprüfung
bestanden haben, wollen ihre Zeugnisse gefälligst an den unterfertigten
Kultusvorstand einsehen. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juni 1898: "Besetzung der
israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel. Vorbehaltlich Genehmigung
hoher königlicher Regierung wird hiermit die israelitische
Volksschullehrerstelle zu Obermoschel, mit welcher der Vorbeter- und Schächterdienst
verbunden ist, mit nachfolgenden Bezügen zur Bewerbung ausgeschrieben:
Gehalt als Lehrer Mark
430.- Gehalt als Vorsänger
Mark 244.- Beitrag aus
Staatsfonds Mark 180.-
Kreisaufbesserungszuschuss Mark
70.- Wohnungsentschädigung
Mark 100.- Erträge aus dem
Schächterdienst ca. Mark 250.- Für
Beheizung des Schulsaales Mark
50.- Für Reinigung der
Synagoge und Schulsaal Mark
50.- Erträgnis aus der Miete
des Schulkellers Mark 36.- Summa:
Mark 1410. Für einen ledigen Herrn ist im Schulhause freie Wohnung
vorhanden. Meldetermin 7. Juli dieses Jahres. Bewerber, welche ein
bayerisches Seminar besucht und in Bayern die Anstellungsprüfung
bestanden haben, wollen ihre Zeugnisse gefälligst an den unterfertigten
Kultusvorstand einsehen.
Obermoschel (Pfalz), den 20. Juni 1898. Der
israelitische Kultusvorstand: Gustav Abraham." |
|
|
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1901: "Besetzung
der israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel..." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1901: "Besetzung
der israelitischen Lehrerstelle zu Obermoschel..."
Text weitgehend identisch mit dem der Anzeige von 1898 (siehe oben). |
Zum Tod des Lehrers Feist Strauß (1898)
Anmerkung: Feist Strauß war bis 1868 Lehrer in Obermoschel,
danach in Oettingen. In Obermoschel heiratete er die Lehrertochter Sophie Schwab
aus Westheim. Sein Schwiegersohn, ein Lehrer Gutmann, war um 1898 Lehrer in
Obermoschel. Aus diesem Grund wird der gesamte Nachruf zum Tod von Lehrer Feist
Strauß hier wiedergegeben, obwohl er überwiegend im Rückblick auf seine Zeit
in Oettingen verfasst wurde.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Oettingen
(Schwaben), im Monat Siwan Mai. (Hebräisch und deutsch:) ‚Wehe der
Gemeinde, die ihren Führer verloren, Wehe dem Schiffe, das seinen
Steuermann verloren.’ Diese Worte unserer Weisen, die im
Gemeindeleben nur allzu oft ihre Bestätigung finden, traten mir unwillkürlich
in ihrem hohen Ernste vor die Seele, als ich die Mitteilung von dem plötzlichen
Tode des Lehrers F. Strauß dahier, erhielt. So hat denn wieder einer der
hochachtbarsten und doch so still bescheidenen Schulmänner, ein edler
religiös-sittlicher Mann, eine Zierde seines Standes, sein treues Auge
geschlossen. Ja, am 27. April, 5. Ijjar, hat die kalte Hand des Todes einen schönen Lebenskranz
zerrissen, ein treues Lehrerherz zum Stillstand gebracht. Einen treuen
Gatten und liebevollen Vater, einen braven Kollegen und fleißigen,
gewissenhaften Lehrer hat der Tod von hinnen genommen und nichts weiter
von ihm zurückgelassen als die Erinnerung, die in den Herzen seiner tief
trauernden Hinterbliebenen sowie seiner dankbaren Gemeindemitglieder
fortleben wird. So dürfte es denn angebracht sein, dem Dahingeschiedenen
eine Palme der Erinnerung zu weihen, ihm einen Ehrenkranz aufs Grab zu
legen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Oettingen
(Schwaben), im Monat Siwan Mai. (Hebräisch und deutsch:) ‚Wehe der
Gemeinde, die ihren Führer verloren, Wehe dem Schiffe, das seinen
Steuermann verloren.’ Diese Worte unserer Weisen, die im
Gemeindeleben nur allzu oft ihre Bestätigung finden, traten mir unwillkürlich
in ihrem hohen Ernste vor die Seele, als ich die Mitteilung von dem plötzlichen
Tode des Lehrers F. Strauß dahier, erhielt. So hat denn wieder einer der
hochachtbarsten und doch so still bescheidenen Schulmänner, ein edler
religiös-sittlicher Mann, eine Zierde seines Standes, sein treues Auge
geschlossen. Ja, am 27. April, 5. Ijjar, hat die kalte Hand des Todes einen schönen Lebenskranz
zerrissen, ein treues Lehrerherz zum Stillstand gebracht. Einen treuen
Gatten und liebevollen Vater, einen braven Kollegen und fleißigen,
gewissenhaften Lehrer hat der Tod von hinnen genommen und nichts weiter
von ihm zurückgelassen als die Erinnerung, die in den Herzen seiner tief
trauernden Hinterbliebenen sowie seiner dankbaren Gemeindemitglieder
fortleben wird. So dürfte es denn angebracht sein, dem Dahingeschiedenen
eine Palme der Erinnerung zu weihen, ihm einen Ehrenkranz aufs Grab zu
legen.
Feist Strauß
war der Sohn des rühmlichst bekannten Lehrers Wohl Strauß aus Kleinheubach, wo er im Jahre 1834 das Licht der Welt erblickte. Klein und
bescheiden, wie die Räume des elterlichen Hauses, waren die Verhältnisse,
unter denen der kleine Feist seine ersten Jugendjahre verlebte. Sehr frühzeitig
offenbarte der Knabe eine hervorragende geistige Begabung und mit Freuden
auf den Lieblingswunsch des Vaters eingehend, wurde F. Strauß
Schullehrling und bezog mit einer gediegenen Vorbildung, nicht bloß im
profanen, sondern namentlich auch im talmudischen Wissensgebiete, ausgerüstet
das Schullehrerseminar in Würzburg. F. Strauß studierte mit anhaltendem
Fleiße und absolvierte im Jahre 1854 die genannte Anstalt mit sehr günstigem
Erfolge. Die ersten Felder seiner Wirksamkeit waren Privatstellen in
Eltville und Gedern und die Volksschulstelle in Obermoschel (Pfalz),
woselbst er überall, ganz allein seinem Berufe sich hingebend, mit der
ihm eigenen, zähen Ausdauer und Willenskraft an seiner Fortbildung
arbeitete und eine solche Tätigkeit in seiner Schule entfaltete, dass
sein Ruf weit über den Kreis hinaus drang, in welchem er zunächst Segen
und Liebe verbreitete. Als im Jahre 1868 die Lehrer- und Kantorstelle
dahier in Oettingen in Erledigung gekommen war, wurde ihm dieselbe
einstimmig übertragen.
Da jedoch in die Zeit seines Aufenthaltes in Obermoschel seine
Verehelichung mit der Lehrerstochter Sophie Schwab aus Westheim
(Unterfranken) fällt, so möge hier, ehe wir seinen weiteren Lebenslauf
in Oettingen verfolgen, gleich etwas über das häusliche Leben des
Dahingeschiedenen gesagt werden. Geziert mit den schönsten Tugenden der Häuslichkeit,
Sparsamkeit, Fleiß und Umsicht, fand die Gattin, die in des Wortes
umfassendsten Sinne eine ‚wackere Frau’ ist, ihr Glück nur im stillen
Frieden des Hauses, im bescheidenen Familienleben und in der treuen Sorge
um ihren Gatten und ihre Kinder. Die Erziehung seiner Kinder war dem
seligen Entschlafenen neben Schule und Privatstudien eine
Hauptlebensaufgabe. Strauß war das Muster eines Erziehers. Mit seiner
Strenge verband er eine aufrichtige Liebe, ein herzliches Wohlwollen, eine
treue Fürsorge für Frau und Kinder, von denen ein noch lediger Sohn und
drei verheiratete Töchter in glücklichen Verhältnissen leben.
Was
soll ich nach dem bisher Gesagten noch viel von seiner segensreichen
Wirksamkeit in Oettingen sprechen? F. Strauß war ein Charakter im
vollsten Sinne des Wortes, ein ganzer Mann, ein Lehrer, wie er sein soll,
darum auch allseitig geachtet und geliebt. Wie bisher, lebte er bis zum
Ende seines Daseins mit voller Hingabe seinem Berufe, den er in seiner
ganzen Tragweite und hohen Bedeutung erkannte und erfasste. Er war stolz,
ein Lehrer zu sein. Auf eine musterhafte Ordnung, Ruhe und Anstand hielt
er mit unerbittlicher Strenge bei seinen Schülern und besaß dabei deren
höchste Liebe und Verehrung. Doch,
was ich hier ganz besonders hervorheben möchte, ist, dass F. Strauß ein
Vorbild für echte Gottesfurcht (hebräisch dto.) war. Sein Tun und Lassen
war immer von den edelsten, wohlmeinendsten und besten Absichten geleitet,
sein Wandel war sittlich, rein und fleckenlos. Wie kindlich, fasslich und
anschaulich konnte Strauß im Religionsunterrichte erzählen! Diese
Unterrichtsstunden waren nicht, wie in vielen Schulen, den Kindern eine
Plage, sondern eine Erbauungsstunde, ein Kindergottesdienst. In gleicher
Weise war er ein meister in der Abhaltung der religiösen Vorträge in den
hier bestehenden Vereinen. In
atemloser Stille lauschte alles seinen geistvollen Auslegungen des
Midrasch und des Tanach (hebräische
Bibel), welch letzteres er in 30jähriger Tätigkeit in der Gemeinde
Oettingen einige Male durchwanderte. Es waren (hebräisch und deutsch)
‚Worte, die den Eingang ins Herz fanden.’ Die Liebe und Verehrung, die
ihm von Seiten seiner Gemeinde, Schüler, seiner Vorgesetzen und Kollegen
entgegen gebracht wurde, fanden ihren beredtesten Ausdruck gelegentlich
seines 25jährigen Dienstjubiläums im Jahre 1893, an welchem Tage |
 alles
wetteiferte, ihm die im vollen Maße verdiente Anerkennung zu zollen.
Nicht minder rührend war auch die erhebende Leichenfeier nach dem so plötzlich
erfolgten Hinscheiden des geliebten Lehrers. Es bewahrheitete sich dabei
der Spruch unserer Weisen ‚bei der
Trauerrede
erkennt man,
ob
ein Mensch wichtig war’.
Trotz der ungünstigen Zeit – es war Freitagnachmittag kurz
vor Schabbat – war
die Beteiligung eine so große, dass man mit Recht sagen: eine
große Trauer war diese für die Heilige Gemeinde Oettingen. In einer
tief ergreifenden Rede hob Herr Distriktsrabbiner Dr. Cohn aus Ichenhausen, der des Verstorbenen Wirken aus persönlicher Anschauung
kennen und schätzen gelernt, anknüpfend an die Anfangsworte der Sidra
‚Heilige sollt ihr sein’,
die edlen Charakterzüge und Verdienste des Entschlafenen hervor, die
Ermahnung an seine Schüler richtend, das edle Beispiel des Verblichenen
in ihrem Leben zu betätigen. – Hieran richteten sich noch verschiedene
Ansprachen von Seiten des Königlichen Distriktschulinspektors, des
Vorstandes des Bezirkslehrervereins, des israelitischen Kollegen H.
Friedmann aus Hainsfahrt und des Schwiegersohnes des Verstorbenen des
Lehrers Gutmann aus Obermoschel. In tiefster Wehmut verließ man die Stätte
der Trauer, der Worte unseres unsterblichen Raschi - seligen Andenkens -
gedenkend: 'Es hat sich gewendet der Fromme, es hat sich gewendet seine
Pracht, es hat sich gewendet sein Glanz.*
Seine Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens". alles
wetteiferte, ihm die im vollen Maße verdiente Anerkennung zu zollen.
Nicht minder rührend war auch die erhebende Leichenfeier nach dem so plötzlich
erfolgten Hinscheiden des geliebten Lehrers. Es bewahrheitete sich dabei
der Spruch unserer Weisen ‚bei der
Trauerrede
erkennt man,
ob
ein Mensch wichtig war’.
Trotz der ungünstigen Zeit – es war Freitagnachmittag kurz
vor Schabbat – war
die Beteiligung eine so große, dass man mit Recht sagen: eine
große Trauer war diese für die Heilige Gemeinde Oettingen. In einer
tief ergreifenden Rede hob Herr Distriktsrabbiner Dr. Cohn aus Ichenhausen, der des Verstorbenen Wirken aus persönlicher Anschauung
kennen und schätzen gelernt, anknüpfend an die Anfangsworte der Sidra
‚Heilige sollt ihr sein’,
die edlen Charakterzüge und Verdienste des Entschlafenen hervor, die
Ermahnung an seine Schüler richtend, das edle Beispiel des Verblichenen
in ihrem Leben zu betätigen. – Hieran richteten sich noch verschiedene
Ansprachen von Seiten des Königlichen Distriktschulinspektors, des
Vorstandes des Bezirkslehrervereins, des israelitischen Kollegen H.
Friedmann aus Hainsfahrt und des Schwiegersohnes des Verstorbenen des
Lehrers Gutmann aus Obermoschel. In tiefster Wehmut verließ man die Stätte
der Trauer, der Worte unseres unsterblichen Raschi - seligen Andenkens -
gedenkend: 'Es hat sich gewendet der Fromme, es hat sich gewendet seine
Pracht, es hat sich gewendet sein Glanz.*
Seine Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens". |
|
*Der
Webmaster von "Alemannia Judaica" freut sich über die
Rückmeldung einer präziseren Übersetzung des Zitates von Raschi,
Adresse siehe Eingangsseite. |
Zum Tod des Lehrers Leopold Gutmann (bis 1898 Lehrer in
Obermoschel, danach in Oettingen, wo er 1930 starb)
 Artikel in
der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Oktober 1930
(Nachruf des Lehrervereins): "Leopold Gutmann. Jäh und unerwartet traf
uns am 8. Juli die Trauerbotschaft von dem Ableben Leopold Gutmanns von Oettingen.
Gutmann gehörte unserem Verein seit dem Jahre 1899 als treues,
hilfsbereites und stets uneigennütziges Mitglied an. Immer war er zur
Stelle, wenn es galt, für den Verein und für die Interessen der
Lehrerschaft zu wirken. Durch das Vertrauen der Mitglieder wurde er 1914
in die Verwaltung berufen. In dankbarer Anerkennung seiner besonderen
Verdienste um die Unterstützungskasse wurde er 1922 nach seinem Rücktritte
als Verwaltungsmitglied zum Ehrenmitglied der Verwaltung ernannt. Gutmann
war als Volksschullehrer zuerst in Obermoschel (Rheinpfalz) und seit 1898
in Oettingen tätig. Seine ideale Berufsauffassung und seine hohe pädagogische
Begabung, seine Liebe zur jüdischen Gemeinschaft und zur Jugend, brachten
ihm nicht nur Anerkennung und Verehrung von Seiten seiner Gemeinde,
sondern schafften ihm auch darüber hinaus Ansehen und Freundschaft in
weiten Kreisen. Gutmann ist für uns nicht gestorben. Er lebt in unseren
Reihen weiter. Artikel in
der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Oktober 1930
(Nachruf des Lehrervereins): "Leopold Gutmann. Jäh und unerwartet traf
uns am 8. Juli die Trauerbotschaft von dem Ableben Leopold Gutmanns von Oettingen.
Gutmann gehörte unserem Verein seit dem Jahre 1899 als treues,
hilfsbereites und stets uneigennütziges Mitglied an. Immer war er zur
Stelle, wenn es galt, für den Verein und für die Interessen der
Lehrerschaft zu wirken. Durch das Vertrauen der Mitglieder wurde er 1914
in die Verwaltung berufen. In dankbarer Anerkennung seiner besonderen
Verdienste um die Unterstützungskasse wurde er 1922 nach seinem Rücktritte
als Verwaltungsmitglied zum Ehrenmitglied der Verwaltung ernannt. Gutmann
war als Volksschullehrer zuerst in Obermoschel (Rheinpfalz) und seit 1898
in Oettingen tätig. Seine ideale Berufsauffassung und seine hohe pädagogische
Begabung, seine Liebe zur jüdischen Gemeinschaft und zur Jugend, brachten
ihm nicht nur Anerkennung und Verehrung von Seiten seiner Gemeinde,
sondern schafften ihm auch darüber hinaus Ansehen und Freundschaft in
weiten Kreisen. Gutmann ist für uns nicht gestorben. Er lebt in unseren
Reihen weiter. |
| Hinweis: weitere Berichte zu Lehrer
Leopold Gutmann auf der Textseite zu
Oettingen. |
Über den Lehrer Siegmund Löb (gefallen im Ersten
Weltkrieg 1918)
Anmerkung: Dokumente erhalten von Leslie Haas-Koelsch, San Francisco)
 |
 |
Lehrer Siegmund Loeb ist am 22. Juni
1883 in Steinbach am Glan
geboren als Sohn des Viehhändlers Josef Löb und seiner Frau Sofie geb.
Aron (links Geburtsurkunde). Er war seit 25. August 1914 verheiratet mit Johanna
geb. Brück, mit der er eine Tochter hatte (geboren in Obermoschel).
Seine Frau Johanna geb. Brück war eine am 16. Juni 1891 in Obermoschel
geborene Tochter des Moritz Brück und seiner Frau Rosa geb. Sternheimer.
Siegmund Löb wurde vermutlich bald nach Beginn des Ersten Weltkrieges in
den Kriegseinsatz eingezogen. Das Familienregister (links) enthält den
Eintrag: "Am 9.11.1916 krank ins Lazarett". Am 4. Mai 1918 ist
er in Hangard gefallen bzw. an seinen Kriegsverletzungen gestorben.
In zweiter Ehe heiratete die Witwe Johanna Löb geb. Brück am 11. Mai
1925 in Obermoschel Ludwig Löb (geb. 21. März 1877 in
Gersheim). |
| |
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. Juni 1918: "Siegmund Löb.
Am 4. Mai fand bei den schweren Kämpfen im Westen der Lehrer Siegmund Löb
aus Obermoschel den Heldentod. Löb wurde 1883 als der Sohn des
derzeitigen Kultusvorstandes Josef Löb in
Steinbach am Glan geboren. Er
besuchte die israelitische Volksschule seines Geburtsortes. Seine berufliche
Ausbildung erhielt er in der königlichen Lehrerbildungsanstalt
Kaiserslautern und fand nach Absolvierung derselben Anstellung in
Leimersheim, Venningen und
Obermoschel. In letzterem Orte wurde ihm 1914 bis
zu seiner Einberufung im Jahre 1916 die Führung der protestantischen Schule
übertragen. Im ersten Kriegsjahre verheiratete er sich, und Gattin und ein
Töchterchen betrauern schmerzlich den Verlust des teuren Gatten und Vaters.
Die Gemeinde verliert in ihm einen gewissenhaften, pflichttreuen Beamten,
der sich durch sein biederes, von echter Religiosität getragenes,
vorbildliches Verhalten die Wertschätzung all derer erwarb, die mit ihm in
Verkehr standen. Wir Lehrer beklagen den Verlust eines wackeren Kollegen,
dessen heiteres, offenes Wesen ihn jedermann lieb und wert machte. Sein
charaktervolles Interesse, sein pflichttreues Schaffen und sein stets
bewährtes Interesse an allen Standesfragen sichern dem jungen Helden ein
dauerndes Andenken in unseren Reihen." Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 13. Juni 1918: "Siegmund Löb.
Am 4. Mai fand bei den schweren Kämpfen im Westen der Lehrer Siegmund Löb
aus Obermoschel den Heldentod. Löb wurde 1883 als der Sohn des
derzeitigen Kultusvorstandes Josef Löb in
Steinbach am Glan geboren. Er
besuchte die israelitische Volksschule seines Geburtsortes. Seine berufliche
Ausbildung erhielt er in der königlichen Lehrerbildungsanstalt
Kaiserslautern und fand nach Absolvierung derselben Anstellung in
Leimersheim, Venningen und
Obermoschel. In letzterem Orte wurde ihm 1914 bis
zu seiner Einberufung im Jahre 1916 die Führung der protestantischen Schule
übertragen. Im ersten Kriegsjahre verheiratete er sich, und Gattin und ein
Töchterchen betrauern schmerzlich den Verlust des teuren Gatten und Vaters.
Die Gemeinde verliert in ihm einen gewissenhaften, pflichttreuen Beamten,
der sich durch sein biederes, von echter Religiosität getragenes,
vorbildliches Verhalten die Wertschätzung all derer erwarb, die mit ihm in
Verkehr standen. Wir Lehrer beklagen den Verlust eines wackeren Kollegen,
dessen heiteres, offenes Wesen ihn jedermann lieb und wert machte. Sein
charaktervolles Interesse, sein pflichttreues Schaffen und sein stets
bewährtes Interesse an allen Standesfragen sichern dem jungen Helden ein
dauerndes Andenken in unseren Reihen." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Elias Simon wird zum Stadtrat gewählt (1853)
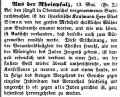 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juni 1853: "Aus der
Rheinpfalz, 13. Mai (Fr.J. =? Frankfurter Journal). Bei den jüngst in
Obermoschel vorgenommenen Stadtratswahlen ist der israelitische Kaufmann
Herr Elias Simon von der großen Mehrheit christlicher Wähler zum
Stadtrate ernannt worden, und wie wir hören, ist Aussicht vorhanden, dass
derselbe auch zum Bürgermeister erwählt werde. Diese Erscheinung, von
der Vorurteilslosigkeit der Christen sowohl, als von der Würdigkeit des
Juden Zeugnis gebend, ist doppelt erfreulich und verdient in einer Zeit,
wo der finstere Geist wieder überall umherschleicht, um die Konfessionen
zu trennen, und aus einem Lande, wo infolge des strengen Vorgehens der
Gerichte gegen einzelne Individuen das Vorurteil feindselig und ungerecht
so oft gegen alle Juden gerichtet ist, ganz besonders hervorgehoben zu
werden." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juni 1853: "Aus der
Rheinpfalz, 13. Mai (Fr.J. =? Frankfurter Journal). Bei den jüngst in
Obermoschel vorgenommenen Stadtratswahlen ist der israelitische Kaufmann
Herr Elias Simon von der großen Mehrheit christlicher Wähler zum
Stadtrate ernannt worden, und wie wir hören, ist Aussicht vorhanden, dass
derselbe auch zum Bürgermeister erwählt werde. Diese Erscheinung, von
der Vorurteilslosigkeit der Christen sowohl, als von der Würdigkeit des
Juden Zeugnis gebend, ist doppelt erfreulich und verdient in einer Zeit,
wo der finstere Geist wieder überall umherschleicht, um die Konfessionen
zu trennen, und aus einem Lande, wo infolge des strengen Vorgehens der
Gerichte gegen einzelne Individuen das Vorurteil feindselig und ungerecht
so oft gegen alle Juden gerichtet ist, ganz besonders hervorgehoben zu
werden." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Uhrmacher Jakob Strauß sucht einen Lehrling (1868 / 1869
/ 1871)
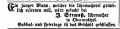 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1868: "Ein
junger Mann, welcher die Uhrmacherei gründlich erlernen will, wird
gesucht bei Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1868: "Ein
junger Mann, welcher die Uhrmacherei gründlich erlernen will, wird
gesucht bei
J. Strauß, Uhrmacher in Obermoschel. Sabbat- und Feiertage ist das
Geschäft geschlossen." |
|
|
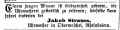 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.
Mai 1869: "Einem jungen Manne ist Gelegenheit geboten, die
Uhrmacherei gründlich zu erlernen; derselbe kann sofort eintreten
bei Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.
Mai 1869: "Einem jungen Manne ist Gelegenheit geboten, die
Uhrmacherei gründlich zu erlernen; derselbe kann sofort eintreten
bei
Jakob Strauss, Uhrmacher in Obermoschel, Rheinbayern". |
|
|
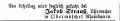 Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871: "Ein
Lehrling wird sogleich gesucht bei Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871: "Ein
Lehrling wird sogleich gesucht bei
Jakob Strauß, Uhrmacher in Obermoschel,
Rheinbayern." |
Joseph Lipold sucht für ein Mädchen eine Stellung
(1884)
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Januar 1884: "Ein jüdisches
junges Mädchen, 18 Jahre alt, aus achtbarer Familie, sucht zur Stütze
der Hausfrau bei anständigen Leuten oder zu einer einzelnen Dame für
sofort Stellung. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Januar 1884: "Ein jüdisches
junges Mädchen, 18 Jahre alt, aus achtbarer Familie, sucht zur Stütze
der Hausfrau bei anständigen Leuten oder zu einer einzelnen Dame für
sofort Stellung.
Joseph Lipold in Obermoschel, Bayern." |
Stelle für jüdischen Handwerkerlehrling gesucht
(1937)
Anmerkung: bei dem jüdischen Jungen, für den die Lehrstelle gesucht wurde,
handelte es sich um Karl Lorig, geb. 30. Mai 1923 in Obermoschel als Sohn
von Leo Lorig (geb. 1892 in Butzweiler) und seiner Frau Recha geb.
Brück (geb. 1899 in Obermoschel, verheiratet seit 1922), der im Frühjahr
1937 die Schule beendet hat. Er wurde am 22. Oktober 1940 in das
Internierungslager Gurs deportiert, danach in das Lager Drancy, am 6. März 1943
in das Vernichtungslager Auschwitz, wo er ermordet
wurde.
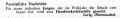 Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der
Rheinpfalz" vom 1. November 1937: "Persönliche Nachricht.
Für einen jüdischen Jungen, der im Frühjahr die Schule verlassen
hat, wird eine Handwerkerlehrstelle gesucht. Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der
Rheinpfalz" vom 1. November 1937: "Persönliche Nachricht.
Für einen jüdischen Jungen, der im Frühjahr die Schule verlassen
hat, wird eine Handwerkerlehrstelle gesucht.
Lorig, Obermoschel". |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betraum vorhanden. Der 1852 in einem
Zustandsbericht über den jüdischen Kultus im Bereich des Landkommissariats
Kirchheim genannte Betsaal war "schon seit 62 Jahren" im Haus des
Jacob Landsberg eingerichtet (das heißt seit 1790). 1814 hat die jüdische
Gemeinde dieses Haus für 900 Gulden erworben. Im Laufe der Jahre wurde der
Zustand des Betsaales immer schlechter. 1841 hieß es, das Gebäude sei
"demoliert", das heißt in baufälligen Zustand. Wenig später ist es
abgebrochen worden.
1844 wurde an Stelle des abgebrochenen Gebäudes mit dem alten Betsaal ein neues
Synagogengebäude erstellt. Im Erdgeschoss wurden Schulsaal und Lehrerwohnung
eingerichtet. Der Betsaal im Obergeschoss hatte 35 Plätze für Männer und 20
Plätze für Frauen auf einer Empore. Die Fassade des Gebäudes war durch
Lisenen und Rundbogenfenster gegliedert.
Über 90 Jahre war das Synagogengebäude Mittelpunkt des jüdischen
Gemeindelebens in Obermoschel. 1911 wurden aufwändige Renovierungsarbeiten
vorgenommen.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
am frühen Morgen des 10. November durch SA-Leute und andere Nationalsozialisten
aufgebrochen. Der Innenraum, die Einrichtung und die fünf wertvollen Buntglasfenster wurden zerstört.
Die Ritualien sowie die demolierte Einrichtung wurden auf den Marktplatz
geschleppt und dort verbrannt. Das Gebäude selbst blieb von einer Brandstiftung
verschont. Im Zweiten Weltkrieg wurden in dem Gebäude französische
Kriegsgefangene und Ostarbeiter untergebracht.
1952 kam das Gebäude im Zuge der Rückerstattung an die Jüdische
Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Der Betsaal wurde in der Folgezeit als
Abstellraum genutzt, die Fenster verkleinert und zum Teil vermauert. 1972
wurde das Gebäude an Privatleute verkauft und 1972/73 in ein Wohnhaus
umgebaut (die Hinweistafel nennt als Jahr des Verkaufs 1975). Das Äußere (und Innere) der früheren Synagoge wurde die Umbauten
unkenntlich gemacht beziehungsweise zerstört.
2006 wurde die frühere Portalinschrift in ein Denkmal bei der
evangelischen Kirche integriert (siehe Bericht unten). Am ehemaligen
Synagogengebäude befindet sich eine Gedenktafel mit dem Text: "Hier stand
die Synagoge der jüdischen Gemeinde Obermoschel, 1841 erbaut. Am 9. November
1938 wurde sie im Verlauf der Reichspogromnacht geschändet und als Gebetshaus
nicht mehr genutzt, 1975 verkauft und zum Wohnhaus umgebaut".
Adresse/Standort der Synagoge: Synagogenstraße
1 (NS-Zeit bis 1989: Mathildenstraße)
Fotos
(Quelle: Landesamt s.Lit. S. 294-296; O. Weber S.
129-131)
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
| November
2006: Denkmal zur Erinnerung an die
Synagoge |
Das Denkmal an
der Kirche des Ortes |
 |
 |
 |
Fotos oben
von Bernhard Kukatzki (Aufnahmen vom Dezember 2011);
weiteres Foto in hoch auflösender Form von Andreas
Andel über Link zu
Fotoseite (846 KB) |
| |
|
|
|
Beitrag von Prof. Dr. Rainer Schlundt und Dekan Stefan Dominke
in http://obermoschel.info/stadtgeschichte/geschichte/:
"Die Steine der Synagoge reden wieder. Zur Geschichte und Botschaft eines Mahnmals.
Überraschend und außergewöhnlich: Ein Rundbogen mit hebräischen Schriftzeichen, neben der Evangelischen Kirche auf einem exponierten Platz der Stadt. Was wollen diese Steine sagen, welche Botschaften sollen sie verkünden?
Bereits der Standort spricht für sich: Hier, auf dem 'Hewwel' steht seit 50 Jahren das Mahnmal für die Opfer der beiden Weltkriege. Erstaunlicherweise zeigt es nicht einen sterbenden Soldaten, wie das so oft zu sehen ist, und erfreulicherweise wiederholt es auch nicht die verlogene Phrase
'Wir starben, damit ihr leben könnt'. In kluger und einfühlsamer Symbolik wurde ein zeitloses, leises und deshalb umso wirkungsvolleres Zeichen gesetzt gegen Krieg und Tod. Hier steht eine Mutter, die beschützend ihre Hand über ihr spielendes Kind hält. Die Statue schließt das Denkmal an der Evangelischen Kirche ab, aber die Mutter steht am Weg zur Katholischen Kirche.
Sie verweist auf Mutter Maria, die in der Katholischen Kirche eine bedeutende Rolle spielt. Standort und Statue drücken Versöhnung zwischen beiden christlichen Gemeinden, Überwindung der Gegensätze zwischen den Konfessionen aus. In der Statue der Mutter als Sinnbild des Lebens ist das schreckliche und sinnlose Sterben, der Krieg schlechthin überwunden. Diese Botschaft des christlichen Mahnmals links von der Kirche wird nun ergänzt durch die
Steine der ehemaligen Synagoge rechts von der Kirche. So wird eine gute Beziehung hergestellt, eine notwendige Balance der Erinnerung um das Zentrum der
'Gotteshäuser'. Der Ursprung des christlichen aus dem jüdischen Glauben wird symbolisch erkennbar. Die Steine sollen anstelle der ehemaligen jüdischen Mitbürger reden. Sie selbst wurden zum Schweigen gebracht, nun werden diese Steine zu Erinnerung, Gedenken und Mahnung reden.
Portal der ehemaligen Synagoge. Der obere, steinerne Halbkreis schloss
ursprünglich das Portal, den Eingang zur Synagoge in Obermoschel ab. Die darunter stehenden Steintafeln symbolisieren die Tür zur Synagoge, die rechte ist etwas nach vorn gerichtet, leicht geöffnet, als lade sie zur Einkehr ein. 3 Inschriften interpretieren 3 Epochen unserer Geschichte.
Die erste Inschrift erinnert an über 600 Jahre christlich-jüdischer Kultur – bereits 1429 wurde dem
'Juden Salman' ein Bergwerk im Selberg verliehen, frühere Zeugnisse jüdischer Kultur sind zu vermuten. In den folgenden Jahrhunderten erlitt die Minderheit die Verfolgungen und Pogrome wie überall in Europa, ehe sie sich ab dem 19. Jahrhundert als gleichberechtigten Teil der Bürgerschaft fühlen konnte. Die Einweihung der repräsentativen Synagoge 1844 drückt Selbstbewusstsein und Emanzipation aus.
Zum Gedenken ruft die zentrale, zweite Inschrift auf. Unvorbereitet, brutal und menschenverachtend traf die Bürger eine verbrecherische Rassenpolitik des III. Reiches. Als die Synagogen in der Reichspogromnacht 1938 geschändet wurden, als die letzten Bürger in das französische Sammellager Gurs am Fuße der Pyrenäen verschleppt wurden, das wenige überlebten, war die jüdische Kultur der Stadt grausam beendet worden. Die Botschaften dieser beiden Tafeln, die Vergangenheit festhalten, fließen in der zentralen Botschaft des gesamten Mahnmals zusammen:
Aus dem Bewusstsein der eigenen Traditionen und in Verantwortung vor der Geschichte mahnt die dritte Inschrift zu friedvollem Miteinander in Gegenwart und Zukunft. Allen drei ethischen Appellen steht die jeweilige Nutzung der Synagoge im Laufe der Jahrhunderte gegenüber. Dieses Ensemble bewahrt einen wichtigen Aspekt der Obermoscheler Geschichte. In der Nähe zur ehemaligen Synagoge, der Synagogenstraße und dem
'Matzenberg' wird die Erinnerung an das Zentrum der jüdischen Gemeinde und zugleich an einen bedeutenden Teil der städtischen Geschichte erhalten. Christliche und jüdische Zeitrechnung nennen zwar andere Ziffern und Namen, meinen aber das gleiche Datum. Gibt es ein deutlicheres Zeichen gemeinsam erlebter Zeit?
Mit diesem Mahnmal wurde ein lang gehegter Plan Wirklichkeit: Vor über 30 Jahren – 1972/73- konnten die Steine des Synagogenportals vor der Müllkippe gerettet werden. Seit dem Jahr 2000 arbeiteten wir an der Realisierung. Briefe um finanzielle Unterstützung fanden wenig Gehör, zu zahlreiche Absagen von zuständigen Institutionen, sehr heftige, unsachliche Kritik ließen zuweilen den Gedanken ans Aufgeben zu. Doch dauernde emotionale Unterstützung, kleine und große Spenden selbst aus den USA, engagierte Mitarbeit Vieler drängten zum Durchhalten.
Am Freitag, den 10. November 2006 konnte dann endlich das Mahnmal der Öffentlichkeit übergeben werden. In einem beeindruckenden ökomenischen Gottesdienst erinnerte Dekan Stefan Dominke an die schrecklichen Verbrechen des Dritten Reiches. Jiddische Lieder, die Frau Silke Loettel – Forderer sehr überzeugend vortrug, ließen Erinnerungen an die ehemalige jiddische Kultur der Pfalz wach werden. Prof. Dr. Rainer Schlundt erläuterte die Botschaft des Mahnmals, das Bläserensemble der Kantorei umrahmte feierlich den Gottesdienst.
Über 400 Besucher aus nah und fern zeigten ihre Zustimmung zu den Botschaften des Mahnmals und seiner Initiatoren.
Zur anschließenden Enthüllung und Einweihung sprachen die Vertreter der Kirchen, der Jüdischen Kultusgemeinde der Pfalz und Repräsentanten der politischen Öffentlichkeit . Während die Namen der ermordeten Bürger und Familien verlesen wurden, legte Frau Mackie McMakin, die Enkelin des
'Uhren – Strauß' einen Stein nieder: Der alte Brauch lebte wieder auf, ein Überrest jüdischer Kultur.
Diese eindrucksvolle, würdige Feier und das Mahnmal sind zum Zeugnis einer ganzen Stadt geworden. Ihre Bürger bekennen sich damit zur Verantwortung vor ihrer Geschichte. Sie haben Marksteine der Erinnerung aufgerichtet, in Verneigung vor den Toten und dem Bekenntnis:
Nicht mehr, wie schon einmal, zu schweigen zu Unrecht und Gewalt!" |
| |
|
Oktober 2020:
Rundgang zur jüdische Geschichte
des Ortes aus Anlass des Gedenkens an die Deportation nach Gurs 1940
|
Artikel von Arno Mohr im
"Wochenblatt-Reporter" (Alsenz) am 27. Oktober 2020: "Spuren jüdischen
Lebens in Obermoschel. Rundgang anlässlich Gurs-Gedenkens.
Obermoschel. 'Sie haben uns heute allen ein besonderes Geschenk heute
gemacht', lobte am Ende des Rundgangs Rubrecht Beuther vor dem jüdischen
Mahnmal den in Obermoschel geborenen und aufgewachsenen Professor Dr. habil.
Dr. phil. Rainer Schlundt, der als profunder Kenner die Spuren jüdischen
Lebens in der kleinsten pfälzischen Stadt kundig und hochinteressant für die
rund 30 Gäste, darunter auch Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel und
VG-Bürgermeister Michael Cullmann, aufzeigte. Die Führung war Teil der
Veranstaltungsreihe anlässlich des Gurs-Gedenkens und wurde statt zentral in
in verschiedene Orte verlegt. Sie soll zum einen zum Nachdenken über die
Geschichte anregen, aber auch aufzeigen, was die Bürger heute dazu beitragen
können, dass der Unmenschlichkeit Einhalt geboten wird und so aus der
Vergangenheit für die Zukunft lernen, so Beuter.
In Obermoschel existierte bis zu ihrer Vernichtung in der Nazizeit eine
jüdische Kultusgemeinde, deren Wurzeln bis in das Mittel-alter
zurückreichen. Den höchsten Bevölkerungsanteil erreichte die jüdische
Gemeinde 1890, als die mit 86 Personen 6,3 Prozent der Bevölkerung stellte.
In das Jahr der Stadtrechteverleihung 1349 fällt auch die erste Erwähnung
von Juden. Heute leben ehemalige jüdische Bürger von Obermoschel und ihre
Nachfahren über alle Welt verstreut, von den USA über Kanada, Brasilien,
Kolumbien, Frankreich bis nach Belgien. Gelegentlich wird die Heimat ihrer
Vorfahren besucht.
Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus begann der Rundgang. Hier seien in der
Reichspogromnacht 1938 Möbel und Gegenstände aus der geschändeten Synagoge
verbrannt worden. Jüdische Mitbürger seien am 20. Oktober 1940 vom
Marktplatz aus in Viehwaggons nach Koblenz und von dort dann in die Lager
nach Gurs, einige auch nach Auschwitz, verbracht worden, so Schlundt. Nur
wenige hätten überlebt. Dies seien zwei negative Höhepunkte dieser Zeit für
dem zentralen Platz in Obermoschel gewesen.
Lange gutes Miteinander und gegenseitige Unterstützung und Hilfe.
Schlundt zeigte bei dem Rundgang auch auf, dass es eigentlich ein gutes und
normales Miteinander mit jüdischen Mitbürgern gegeben habe, bevor die
unselige Zeit über die Stadt hereinbrach. Neben normalen jüdischen
Mitbürgern waren einige auch geschäftlich tätig. Direkt am Marktplatz
betrieb der Jude Joseph Maier eine Eisenhandlung mit kombiniertem
Schuhwaren-, Kolonial- und Spezereiwarengeschäft. Später befand sich in
diesem Räumen die Firma Elektro-May. Als der Inhaber Karl. May als
Wehrmachtssoldat in Tulle in französische Kriegsgefangenschaft im Zweiten
Weltkrieg geriet, schickte ihm die frühere Nachbarin Frau Lorig ein Päckchen
mit Brot. In einem beigefügten Brief schrieb sie wörtlich: 'Obwohl die
Deutschen meinen Sohn und meinen Mann umgebracht haben, schicke ich Dir
dieses Päckchen'. Wie die Frau an die Adresse kam, ist bis heute nicht
geklärt. Ein ebenso gutes Zeichen mitmenschlichen Zusammenlebens war der
Einbruch von Räuberhauptmann 'Schinderhannes' - der zwischen 1797 und 1802
die Region unsicher machte und es vor allem auf jüdische Händler und Juden
selbst abgesehen hatte- bei dem Obermoscheler Eisenhändler Joel Elias. Auf
seine Hilferufe erschienen nicht wenige Moscheler, teils bewaffnet und teils
unbewaffnet und vertrieben den Räuberhauptmann samt seinem Gefolge vor die
Stadttore. Auch das sei ein Nachweis, so Schlundt, dass die Moscheler schon
bereit waren, jüdischen Nachbarn beizustehen. Dazu gehört sicherlich auch,
dass der Briefträger Klein trotz Verbot von höherer Stelle, Briefe an Juden
zuzustellen, dies dann über seine Tochter vornehmen ließ.
Eintrübung in Nazi-Zeit. Nach der Machtergreifung Hitlers und in der
Nazi-Zeit trübte sich dieses Verhältnis immer mehr ein. Viele jüdische
Familien wanderten dann aus und verließen die Stadt. Die die dablieben,
wurden in die menschenverachtenden Lager deportiert. In der Wilhelmstraße -
Unnergass - war dann der Eingang zum Polnischen Hof, der früher Danziger Hof
hieß, nächster Halt der Runde. Im Gebäude Nummer 30 wohnte der Viehhändler
Strauß, der im Volksmund nur als 'Ochsen-Strauß' bekannt war. Hier handelte
es sich um einen armen Viehhändler, so Schlundt aber auch wohl situierte
habe es gegeben. Ein Enkel von ihm aus Dallas besuchte in den 90er Jahren
den Ort seiner Vorfahren. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit könne
gesagt werden, ob sich hier auch das jüdische Ritualbad, die Mikwe befand,
Nach einem Klassifikationsplan von 1845 müsste sich das Bad im Anwesen Nr.
22 in der Wilhelmstraße befunden habe.
'Ochsen-Strauß' und 'Uhren-Strauß'. Amüsant war sicherlich der
Vortrag von Schlundt, dass es neben dem 'Ochsen-Strauß' auch einen
'Uhren-Strauß' (Wilhelm Strauß, Landsbergstraße 5) wie auch einen
'Gaul-(Pferde-)Strauß' (Leopold Strauß) gab, letzterer lebte im Haus Nr. 22
in der Wilhelmstraße, dem es mit sechs Kindern wirtschaftlich schlecht ging.
Daneben hatten weitere jüdische Mitbürger Geschäfte in der Stadt wie Isaak
Schneider, Joseph Rheinstein, Josef Maier, Siegfried, Moritz und Friedrich
Brück, Speier & Matthes oder Ferdinand Loeb, die Viehhandel, Kolonialwaren,
Bekleidung oder auch Wein und andere landwirtschaftliche Produkte und Güter
handelten. Auch ein Metzger Carl Lipold war in der Stadt (heutige
Richard-Müller-Straße) tätig und sie alle belebten damit das wirtschaftliche
Leben nicht nur in Obermoschel, sondern in der gesamten Region.
Schuck'sches Haus. Schlundt konnte auch viel Wissenswertes und
Historisches zu dem 'Schuckschen Haus' in der Wilhelmstraße, das aus dem
Jahr 1583/1584 stammt und im ersten Stockwerk im Fachwerk bemerkenswerte
holzgeschnitzte Fratzen und Gesichter, die wohl mit dem Bergbau der Stadt
zusammenhängen, erzählen.
'Weinbrück'. Auf dem Gelände der heutigen Sparkasse und dahinter war
der Weinhändler Friedrich Brück mit seiner Wein-, Branntwein- und
Zigarrenhandlung tätig, später war hier das Weingut/der Weinhandel H.C.
Lemke. Im heutigen Restaurant/Cafe Weinbrück (Weinbrück war 1934 die erste
Telegramm-Name von Friedrich Brück) ist über der Eingangstür das alte
Sandsteinportal mit den Initialen 'FB 1876' überarbeitet zu sehen. Ein
Hingucker besonderer Art ist der der Gastraum: Es ist der 1876 errichtete
große Sandstein-Gewölbekeller.
'Hinnerumweg' -Landsbergstraße. Im 'Hinnerumweg' (Landsbergstraße)
ging es dann zum Anwesen Landsbergstraße 5. Dort war die Familie von
'Uhren-Strauß' zu Hause. Die Frau wurde mit der Tochter (fünf Jahre) ins
Lager Auschwitz deportiert, wusste Schlundt zu berichten. Die Tochter
überlebte das Martyrium und kam später nach Obermoschel zurück und litt
lebenslang an den Folgen des grausamen Lageraufenthaltes.
Judenfriedhof. Über die
Landsbergstraße und Kanalstraße wurde dann der an der Feldstraße gelegene
Judenfriedhof besucht. Bestehend seit 1819 wird im Urkataster 1844 erwähnt,
dass der cica 17 Decimale große /rund 58o Quadratmeter große Begräbnisplatz
'Am Scheeb' bereits seit urdenklicher Zeit Eigentum der Judengenossenschaft
sei. Heute sind noch rund 30 Grabsteine ersichtlich, der Friedhof gibt ein
sehr gepflegtes Bild von sich. Die letzte Beerdigung fand auf besonderen
Wunsch einer Frau vor rund 20 Jahren hier statt. Jeder Grabstein sei
mittlerweile in einem Verzeichnis erfasst und mit Bildern versehen worden,
damit auch dieses Stück Geschichte von Juden in Obermoschel für die Nachwelt
dauerhaft erhalten bleibt, so Schlundt.
Über Judenpfad zur Synagoge. Ein Obermoscheler Teilnehmer wusste zu
berichten, dass der fußläufige Verbindungsweg von der Baumgartenstraße in
die Entengasse/Ringmauergasse als 'Judenpfad' bezeichnet wird, weil er die
kürzeste Verbindung zwischen Judenfriedhof und Synagoge ist. Dort
angekommen, informierte Rainer Schlundt über ein Kernstück jüdischer
Geschichte, die Synagoge, die im Jahre 1841 an der Ecke der Straße
Matzenberg/Synagogenstraße (Matze ist das ungesäuerte Brot, das Juden
während des Pessach esssen) neu errichtet wurde. Synagogen konnten erst
errichtet werden, wenn sich mindestens zehn religionsmündige Männer (Minjan)
zur Abhaltung des Gottesdienstes in einer Gemeinde zusammenfanden. Nur unter
großen Opfern war für die jüdische Gemeinde ein Neubau möglich. Die Fassade
war durch Lisenen und Rundbogenfries gegliedert. Über eine Treppe und ein
Rundbogenportal mit hebräischer Inschrift 'Dies ist das Tor des Herrn, die
Gerechten selbst werden in dasselbe eintreten' (Psalm 118,20). wurde die
Synagoge erschlossen. Im Obergeschoß befand sich der eigentliche Beetsaal,
in dem auch die Thorarollen aufbewahrt wurden. 35 Männerplätze gab es, auf
der Frauenempore waren 20 Plätze vorhanden. Die Decke war mit einem
Sternenhimmel ausgemalt. Im Erdgeschoß befand sich die Wohnung des Vorbeters
und des Lehrers, ebenso war ein Lehrsaal der jüdischen Schule untergebracht.
Es gab auch eine Synagogenordnung mit 24 Artikeln, die regelten, welche
Bräuche existierten und was nicht erlaubt ist. In der Reichspogromnacht
wurde die Syanagoge geschändet und im Innern demoliert, aber nicht in Brand
gesetzt, da wohl Angst bestand, dass das Feuer auf die in der engen Gasse
vorhandenen Nachbargebäude übergreift. Die in der Nazi-Zeit enteignete
Synagoge wurde Anfang der 40er Jahre für die Unterbringung französicher
Kriegsgefangener verwendet und 1952 an die Jüdische Kultusgemeinde der
Rheinpfalz zurückgegeben. Zwanzig Jahre später wurde die ehemalige Synagoge
in der Mathildenstraße 1 (auf Antrag von Rainer Schlundt erhielt diese
Straße durch Stadtratsbeschluß von 1989 wieder den Namen Synagogenstraße) an
den Metzgermeister Karl-Heinz Remdt aus Obermoschel verkauft, der das
Gebäude zu Mietwohnungen umfunktionierte.
Jüdisches Mahnmal auf dem 'Hewwel' an Protestantischer Kirche. Das
Eingangsportal mit der hebräischen Inschrift der Synagoge wurde 2006 als
Bestandteil des jüdischen Mahnmals an der Evangelischen Kirche mitverwendet.
Am 10. November 2006 wurde nach zuvor intensiven Diskussionen dieses würdige
Mahnmal an die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger/innen
errichtet. Schlundt verlas hier zum einen das in Bockenheim preisgekrönte
Gedicht 'Judenhaissje' des Rehorner Mundartdichters Norbert Schneider sowie
in Gedenken die Namen der mindestens elf Obermoschel Mitbürger, die in den
Lagern verstarben. Eine Tafel mit diesen Namen sei das Einzige, das am
Mahnmal noch fehle und ergänzt werden müsse, so Rainer Schlundt (am)."
Link zum Artikel |
| |
|
Januar 2024:
Neuer Beitrag zur Synagoge in
Obermoschel |
Artikel in der "Rheinpfalz"
(Lokalausgabe Donnersbergkreis) vom 11. Januar 2024: "Die 'Ausräumung'
der Synagoge von Obermoschel anlässlich der Reichspogromnacht wird im neuen
Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter beleuchtet.
Die Reichspogromnacht in der Nordpfalz ...ist u.a. Thema ... im neuen
Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter...
Berthold Schnabel aus Deidesheim schreibt über 'Ein Donnerstag im November –
der Reichspogrom vom 10. November 1938 in der Nordpfalz (Teil 1)'. Der
Aufsatz, der in mehreren Fortsetzungen erscheinen wird, orientiert sich in
seiner Untergliederung an der Schilderung des Landgerichts Kaiserslautern
von den Ereignissen des 10. November 1938 im Bereich der SA-Standarte
Rockenhausen. Wegen der an diesem Tag verübten Verbrechen waren 25 Männer
angeklagt, das Urteil wurde am 18. Februar 1949 gesprochen. Ausführlich wird
die sogenannte 'Ausräumung' der Synagoge von Obermoschel beleuchtet...
Das neue Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter ist erhältlich bei Timo
Scherne, Rognacallee 10 in Rockenhausen.
Weitere Infos:
www.nordpfaelzer-geschichtsverein.de"
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 617. |
 |  Jüdisches Leben in der
Nordpfalz. Eine Dokumentation des Nordpfälzer Geschichtsvereins von
einem Autorenteam des NGV (Gesamtredaktion: Paul Karmann).
1992. Jüdisches Leben in der
Nordpfalz. Eine Dokumentation des Nordpfälzer Geschichtsvereins von
einem Autorenteam des NGV (Gesamtredaktion: Paul Karmann).
1992. |
 | Alfred Hans Kuby (Hrsg.): Pfälzisches Judentum
gestern und heute. Beiträge zur Regionalgeschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts. 1992. |
 | Michael Tilly: Die Textfunde aus der ehemaligen
Synagoge von Obermoschel als Zeugnisse jüdischer Frömmigkeit im frühen
19. Jahrhundert. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 10. Jahrgang, Ausgabe 1/2000, Heft Nr. 18. S. 5-27. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter
besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.
S. 129-131. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S.294-296 (mit weiteren Literaturangaben). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Obermoschel Palatinate.
Four Jewish families were present in 1786 and 15 (64 Jews) in 1848. A cemetery
was opened in 1819 and a synagogue in 1841. The Jewish population was 85 (total
1.347) in 1900 and 35 in 1932-33. No Jews remained by September 1939. The local
Jewish elementary school closed in 1936 and the synagogue was wrecked on Kristallnacht
(9-10 November 1938).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|