|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der
Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Maßbach (Markt Maßbach,
Landkreis Bad Kissingen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(neu überarbeitet unter Mitarbeit von Klaus
Bub, Maßbach)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
(erstellt unter Mitarbeit des im März 2007 verstorbenen Reinhard Klopf,
Maßbach; weitere Überarbeitung auf Grund der Recherchen von Klaus Bub)
In Maßbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1942. Ihre Entstehung geht in
die Zeit des 15./16. Jahrhunderts zurück. 1446 gab es einen
Streit zwischen den Herren von Maßbach und Wilhelm von Schaumberg, bei dem es
u.a. über bestimmte Rechte der Christen und Juden zu Maßbach ging. Auch im 16.
Jahrhundert werden Juden am Ort genannt (1556). Damals wurden die
unter dem Schutz der Grafen von Henneberg lebenden Juden ausgewiesen, die unter
dem Schutz der Herren von Maßbach stehenden Juden konnten offenbar bleiben. 1687
werden in einer Übersicht 29 Maßbacher Juden genannt, die unter dem Schutz der
Grafen von Hatzfeldt standen. 1710 waren es 18 jüdische Haushaltungen am
Ort mit zusammen 90 Personen. Zwischen 1800 und 1816 werden 27 Häuser genannt,
die in jüdischem Besitz waren.
1766 wurde in Maßbach (zur selben Zeit wie in Burgpreppach) eine
Talmud-Tora-Schule gegründet.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1816 wurden 170 jüdische Einwohner gezählt (17,9 von
insgesamt 948 Einwohnern). Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde 1837
mit 180 Personen erreicht (bei einer Gesamteinwohnerzahl von 1.172
Personen). Danach ging die Zahl durch Aus- und Abwanderung zurück: 1848 147 jüdische
Einwohner (darunter 61 Kinder bis 15 Jahre), 1867 110 (8,9 % von insgesamt
1.236), 1880 127 (9,7 % von 1.306), 1890 103 (8,1 % von 1.275), 1900 83 (6,7 %
von 1.241), 1910 67 (5,2 % von 1.278).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Maßbach auf
insgesamt 33 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände
genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Haium Faibel Fränkel
(Viehhandel), Joseph Simon Uhlmann (Vorsinger, war schon seit ca. 1789 in Maßbach
tätig), Jacob Moses Hofmann (Pferdehandel), David Hirsch Herrmann (Spezerei-
und Viehhandel), Lazarus Kusel Frank (Viehhandel und Schlachten), Salomon Hirsch
Kraus (Viehhandel), Wolf Lazarus Rosenstein (Vieh- und Spezereihandel), Oscher
Maier Baumann (Schmusen), Maier Elias Federlein (Federhandel), Süßmann Isaac
Brandes (Viehhandel), Maier Faibel Feibelstein (Viehhandel), Isaac Bonfet
Heilmann (Schlachten, Schmusen), Moses Levi Rothenberg (Schlachten), Fradel,
Witwe von Samuel Seligmann Schwarzenbach (lebt vom eigenen Vermögen), David
Isaac Demar (Schlachten), Sara, Witwe von Seligmann Löw Seligmann (lebt vom
eigenen Vermögen), Machul Isaac Katzenberger (Schnür- und Bänderhandel),
Maier Levi Pollack (Kleinwarenhandel und Schmusen), Jacob Samuel Haßberger (Krämerei),
Samuel Jacob Eberhard (Krämerei und Viehhandel), Lazarus Seligmann Brumsack
(Kleiderhandel), Lazarus Moses Simon (Vieh- und Schnitthandel), Isaac Jacob Eißemann
(Viehhandel), Feufer (Feifer) Arrie Stoll (Schnitthandel, Schmusen), Marx Moses
Frankenbach (Viehhandel), Samuel Moses Rothländer (Kramwarenhandel), Anschel Löw
Roßmann (Schmusen), Simon Süßmann (Federhandel), Samuel Süßmann
(Kramhandel), Jacob Strub (Schmusen), Samuel Löw Löwenburg (Schmusen), Baruch
David Rosenbach (Viehhandel, Schlachten), Feibel Samuel Krempler (Schmushandel),
Samuel Löw Isaac Stern (Alteisenhandel), Hanna, Witwe von David Mendel
Jahrkauer (lebt vom eigene Vermögen), Aron Frank (Leder- und sonstigen
Produktenhandel, seit 1819), Alexander Haim Heim (Wein-, Waren- und
Landesproduktenhandel, seit 1820), Feibel Süßmann Strupp (Strub,
Kramwarenhandel, seit 1820), Nathan Meyer Pollack (Rauchwarenhandel, seit 1823),
Jacob Simon (Metzgerei, seit 1823), Hirsch Simson Levi Simson (Zehngebothandel,
seit 1825).
An Einrichtungen der jüdischen Gemeinde gab es eine Synagoge (s.u.),
eine jüdische Elementarschule (bis 1920, danach eine Religionsschule), ein
rituelles Bad und seit 1902/03 einen eigenen Friedhof.
Zuvor waren die Toten der Gemeinde in Kleinbardorf
beigesetzt worden. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war bis 1920
ein jüdischer Elementarlehrer (Volksschullehrer), nach 1920 ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter (Chasan) und Schächter (Schochet) tätig
war. Die Stelle wurde bei Neubesetzungen immer wieder ausgeschrieben (siehe
unten die Anzeigen aus der Zeitschrift "Der Israelit"). Unter den Lehrern
in der Gemeinde waren u.a. Götz Ullmann (1833-1870), Hirsch Goldstein
(vermutlich 1873 - 1895), Moses Nußbaum (1895 - 1910), Siegfried Freudenberger
(1910 bis nach 1915, vgl. zu ihm bei Thüngen),
Gustav Neustädter (1920 - 1924).
Letzter jüdischer Lehrer war bis 1935 David Cegla (s.u.).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Moritz Marx (geb.
5.7.1884 in Maßbach, vor 1914 in Würzburg wohnhaft, gef. 15.5.1915; siehe
Bericht zu seinem Tod unten) und Unteroffizier Dr. Max Goldstein (geb. 11.5.1883
in Maßbach, vor 1914 in Ludwigshafen am Rhein wohnhaft, gef. 14.9.1916). Ihre
Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
in der Neuen Strauße (beim alten Sportplatz bzw. neben einem Autohaus).
Mitte der 1920er-Jahre wurden noch 31 jüdische Gemeindeglieder gezählt
(2,3 % von insgesamt 1.350 Einwohnern). Die jüdischen Gemeindevorsteher
waren damals Samuel Eberhard, A. Friedmann, F. Heidelberger und A. Frank. Der
Religionsunterricht wurde für die noch drei schulpflichtigen jüdischen Kinder
von Lehrer Berlinger in Poppenlauer
gehalten. Anfang der 1930er-Jahre bildeten den Gemeindevorstand Abraham,
Frank und Hermann Heidelberger. Als Lehrer und Kantor war David Cegla tätig (im
Schuljahr 1932/33 gab es vier schulpflichtige jüdische Kinder am Ort; Cegla übersiedelte
1935 nach Erez Israel).
1933 lebten noch 34 jüdische Personen am Ort. Sie waren in der Folgezeit
eine massiven antisemitischen Propaganda und einem heftigen Wirtschaftsboykott
ausgesetzt, wodurch die jüdische Gemeinde stark verarmte. Dennoch konnten die jüdischen
Viehhändler des Ortes noch in beschränktem Umfang Geschäftsbeziehungen zu
Bauern der Umgebung wahrnehmen. Im Oktober 1938 gab es noch zwei jüdische Viehhändler
und einen Fellhändler in Maßbach. Den Unterricht der Kinder und die Betreuung
der jüdischen Gemeinde in Maßbach wurde seit 1935 von Lehrer Ignatz Popper übernommen
(1941 nach Deportation ermordet).
In der Pogromnacht im November 1938 wurde die Synagoge zerstört, jüdische
Wohnhäuser wurden verwüstet. Einem Teil der 1933 hier wohnhaften Personen
gelang noch die Auswanderung, andere verzogen in andere deutsche Städte. 1942
wurden acht Personen nach Izbica (Lublin) und nach Theresienstadt deportiert.
Von den in Maßbach geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben von
Klaus Bub): Irma Adler (1898?),
Dorothea (Dora) Eberhardt (1889), Johanna Eberhardt geb. Heumann (1878), Marianne Eberhardt (1881), Bianka Frank geb.
Gips (1876), David Frank (1869), Hannchen Frank geb. Haas (1873), Marie Gips geb. Nussbaum (1878), Max Gips
(1878), Louis Goldstein (1881), Lina Heidelberger geb. Rossmann (1861), Klara Hirschberg (1892), Betti Kahn geb. Nußbaum (1900),
Leo Katzenberger (1873), Max Katzenberger (1878), Rosa Kleemann geb. Simon
(1873), Gertrud Ledermann geb. Eberhardt (1913), Rosa Ledermann geb.
Katzenberger (1877), Fritz Nussbaum (1902), Otto Nussbaum
(1906), Simon Nussbaum (1866), Lehrer Ignatz Popper (1873), Käthe Popper geb. ? (1905), Cilli (Zilli)
Rosenberger geb. Eberhardt (1878), Ilse Rosenthal (1910), Rachel (Recha)
Rosenthal geb. Katzenberger (1883), Recha Rothschild geb. Nussbaum (1893),
Anselm Roßmann (1863), Lina Schäfer geb. Marx (1879), Meta Schwarzenberger
geb. Katzenberger (1870), Ida Sonnenberger geb. Katzenberger (1882), Eugen
Strauss (1885), Rebekka Strauß geb. Hubert (1862), Moritz Treuhold (1880),
Clotilde Weglein geb. Katzenberger (geb. 1869), Sophie Weil geb. Freudenthal
(1852), Dina Wolf geb. Strauß (1875).
Anmerkungen:
- die in der Liste bis November 2012 genannten Jette Frank (1845)
und Felix Heidelberger (1866) sind noch in Maßbach gestorben und wurden dort
begraben (Hinweis von Klaus Bub).
- für Lina Schäfer geb. Marx wurde am 23. Mai 2015 in Stuttgart-West ein
"Stolperstein" verlegt: Informationen
/ Verlegungsblatt.
Hinweis: der in der Liste genannte Leo Katzenberger (geb. 1873
in Maßbach) war der langjährige Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Nürnberg
Lehmann (Leo) Katzenberger, der am 3. Juni 1942 als Opfer der
NS-Rassenjustiz nach einem Schauprozess des Sondergerichts Nürnberg schuldlos
verurteilt und hingerichtet wurde. Über Leo Katzenberger siehe einen Wikipedia-Artikel
zu seiner Biographie sowie Seiten bei der Website
"Holocaust-Referenz und das Buch von Christiane Kohl (siehe unten im
Literaturverzeichnis).
 Weiterer
Hinweis: Über den Film
"Leo und Claire" (2001) zur Geschichte von Leo Katzenberger siehe
gleichfalls einen Wikipedia-Artikel. Weiterer
Hinweis: Über den Film
"Leo und Claire" (2001) zur Geschichte von Leo Katzenberger siehe
gleichfalls einen Wikipedia-Artikel.
Hinweis auf das DP-Lager im Schloss Maßbach: 1946/47 war im Schloss
Maßbach ein Lager für etwa 90 jüdische Überlebende der NS-Zeit eingerichtet
("Displaced Persons"). Es handelte sich um das "Kibbuz Lanegew".
Die jüdischen Bewohner des Schlosse Maßbach erhielten landwirtschaftliche
Grundkenntnisse im Ackerbau zur Vorbereitung der Auswanderung nach Palästina.
Weitere Informationen siehe in der Website www.after-the-shoah.org:
Seite
zu Maßbach.
Artikel von Jim G. Tobias: "Als Schloss Maßbach Kibbuz Lanegew hieß"
vom 8. Februar 2017: http://www.hagalil.com/2017/02/schloss-massbach/.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Lehrer-, Vorsänger- und
Schächterstelle von 1870 und 1920
Die Ausschreibung von 1870 war notwendig nach dem Tod des Lehrers
Götz Ullmann, der von 1833 bis 1870 Lehrer in der Gemeinde war.
 Ausschreibung in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1870: "Offene
Religionslehrerstelle. Ausschreibung in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1870: "Offene
Religionslehrerstelle.
Die Religionslehrer-, Vorsänger- und
Schächterstelle in Maßbach, Bezirksamt Kissingen, ist erledigt und wird
wie folgt ausgeschrieben: 1) der fixe Gehalt beträgt fl. 300. 2) die
jährliche Nebeneinkünfte fl. 50, 3) die Funktion als
Schächter fl. 150. In Summa fl. 500. nebst freier Wohnung in
schönem Wohnhaus mit Nebengebäuden und Garten. Bewerber wollen sich in
kürzester Frist an Unterzeichneten wenden.
Der Vorstand. A. L. Freudenthal". |
| Die Ausschreibung 1920 erfolgte nach der
Aufhebung der jüdischen Elementarschule: |
 Ausschreibung in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1920: "Zufolge
Aufhebung unserer Elementarschule bis 1. Mai, wegen zu geringer
Kinderzahl, suchen wir einen seminaristisch gebildeten Ausschreibung in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1920: "Zufolge
Aufhebung unserer Elementarschule bis 1. Mai, wegen zu geringer
Kinderzahl, suchen wir einen seminaristisch gebildeten
Religionslehrer,
Schochet und Chasen.
Fixum M. 3.000, garantiertes Nebeneinkommen M. 1000.
Schönes zweistöckiges Schulhaus (ev. für Pensionäre) mit
Gemüsegärtchen. Zeit und Gelegenheit zu Privatunterricht. Gefl.
Meldungen an
Kultusvorstand Samuel Eberhardt. Massbach bei Bad
Kissingen." |
| Auf die Ausschreibung bewarb sich
erfolgreich Gustav Neustädter (siehe unten). |
Zum Tod des Lehrers Götz Ullmann, 1833 bis 1870
Lehrer in Maßbach
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870: "Nekrolog.
Maßbach, Bezirksamt Kissingen, 21. Juni 1870. (Aus besonderen
Gründen verspätet). Ein unersetzlicher Verlust betraf heute die hiesige
israelitische Gemeinde. Unser geliebter Lehrer und More Horaah (=
Gesetzeslehrer), Herr Götz Ullmann, welcher 37 Jahre hier
fungierte, hat das Zeitliche gesegnet. Seine immensen Kenntnisse, sowohl
im Hebräischen, als auch in den profanen Wissenschaften, hätten ihn wohl
befähigt, den ersten Rabbinatssitz mit Ehren zu behaupten. Er war jedoch
in früheren Jahren durch anhaltende Luftröhrenkrankheiten verhindert,
solche Stellen, welche ihm sogar angetragen waren, anzunehmen. Seine
großen Kenntnisse erwarb er sich bei Rabbi Wolf Hamburger - seligen
Angedenkens - und noch bei verschiedenen Autoritäten damaliger Zeit;
seine Universitätsstudien genoss er in Würzburg. Von seinen vielen
Zöglingen, welche er auch im Kaufmännischen ausgebildet, sind manche
Chefs bedeutender Handlungshäuser. Mit seinem enormen Wissen vereinigte
der Selige zugleich strenge Rechtlichkeit, und sein großes Gottvertrauen,
seine Ergebenheit in Gottes Willen hielten an bis zum letzten Atemzuge.
Von seiner großen Wohltätigkeit, welche im vollen Sinne des Wortes keine
Grenzen kannte, zeugte das Wehklagen der christlichen Armen. Die tiefe
Trauer derjenigen, welche ihm die letzte Ehre erwiesen - es waren
sämtliche Israeliten der Nachbargemeinden, sowie der protestantische Herr
Pfarrer mit verschiedenen christlichen Bürgern anwesend - bewies
deutlich, dass der Verklärte nicht nur hier, sondern in der ganzen Gegend
sehr vermisst wird. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870: "Nekrolog.
Maßbach, Bezirksamt Kissingen, 21. Juni 1870. (Aus besonderen
Gründen verspätet). Ein unersetzlicher Verlust betraf heute die hiesige
israelitische Gemeinde. Unser geliebter Lehrer und More Horaah (=
Gesetzeslehrer), Herr Götz Ullmann, welcher 37 Jahre hier
fungierte, hat das Zeitliche gesegnet. Seine immensen Kenntnisse, sowohl
im Hebräischen, als auch in den profanen Wissenschaften, hätten ihn wohl
befähigt, den ersten Rabbinatssitz mit Ehren zu behaupten. Er war jedoch
in früheren Jahren durch anhaltende Luftröhrenkrankheiten verhindert,
solche Stellen, welche ihm sogar angetragen waren, anzunehmen. Seine
großen Kenntnisse erwarb er sich bei Rabbi Wolf Hamburger - seligen
Angedenkens - und noch bei verschiedenen Autoritäten damaliger Zeit;
seine Universitätsstudien genoss er in Würzburg. Von seinen vielen
Zöglingen, welche er auch im Kaufmännischen ausgebildet, sind manche
Chefs bedeutender Handlungshäuser. Mit seinem enormen Wissen vereinigte
der Selige zugleich strenge Rechtlichkeit, und sein großes Gottvertrauen,
seine Ergebenheit in Gottes Willen hielten an bis zum letzten Atemzuge.
Von seiner großen Wohltätigkeit, welche im vollen Sinne des Wortes keine
Grenzen kannte, zeugte das Wehklagen der christlichen Armen. Die tiefe
Trauer derjenigen, welche ihm die letzte Ehre erwiesen - es waren
sämtliche Israeliten der Nachbargemeinden, sowie der protestantische Herr
Pfarrer mit verschiedenen christlichen Bürgern anwesend - bewies
deutlich, dass der Verklärte nicht nur hier, sondern in der ganzen Gegend
sehr vermisst wird.
Möge ein würdiger Nachfolger unseren Verlust in Etwas ersetzen. Vollen Ersatz
können wir nicht gut bekommen. Ein dankbarer Schüler." |
Werbung für die jüdische Elementarschule in Maßbach
mit einem von Lehrer Nußbaum eingerichteten Pensionat (1905 / 1909)
Die Einrichtung eines solchen Pensionates hatte einen doppelten
Zweck. Zum einen konnten im Blick auf die klein gewordene Zahl der Schüler an
der jüdischen Elementarschule noch der eine oder andere Schüler von außerhalb
gewonnen werden. Zum anderen hatte der Lehrer beziehungsweise die Lehrerfamilie
dadurch ein zusätzliches kleines Einkommen.
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. März 1905:
"Knabenpensionat Massbach, Unterfranken, gewährt neben
tüchtiger Allgemeinbildung gründliche Vorbereitung für den
kaufmännischen Beruf. Besondere Unterrichtsfächer: Französische
Sprache, kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Wechsellehre,
Korrespondenz und Stenographie. Eintritt vom 12. Lebensjahre ab. - Beginn
des Schuljahres 1. Mai. Günstige Bedingungen - Beste Referenzen. Lehrer
Nussbaum." Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. März 1905:
"Knabenpensionat Massbach, Unterfranken, gewährt neben
tüchtiger Allgemeinbildung gründliche Vorbereitung für den
kaufmännischen Beruf. Besondere Unterrichtsfächer: Französische
Sprache, kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Wechsellehre,
Korrespondenz und Stenographie. Eintritt vom 12. Lebensjahre ab. - Beginn
des Schuljahres 1. Mai. Günstige Bedingungen - Beste Referenzen. Lehrer
Nussbaum." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1909:
"Israelitische Elementarschule mit Pensionat. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1909:
"Israelitische Elementarschule mit Pensionat.
Massbach
(Unterfranken). Gründliche Allgemeinbildung, besondere Vorbereitung in
allen Handelsfächern. Lehrgang ein- und zweijährige Aufnahme vom 11.
Lebensjahre ab. Beste Erfolge. Lehrer Nußbaum." |
Über Gustav Neustädter
(1920-1924 Religionslehrer in Maßbach)
Von 1913 bis 1914 war als Religionslehrer in Cham Gustav
Neustädter; zu seiner Biographie
https://www.bllv.de/projekte/geschichte-bewahren/erinnerungsarbeit/lehrerbiografien/gustav-neustaedter/
Gustav Neustädter ist in Sulzbürg geboren,
lernte an der jüdischen
Präparandenschule in Höchberg, 1913 Religionslehrerprüfung in Regensburg;
1913-14 Religionslehrer in Cham, 1914 bis 1918
als Soldat im Ersten Weltkrieg, wohnte danach in
Adelsdorf; verheiratet seit 1920 mit Paula
geb. Bacharach aus Rhina; 1920 bis 1924
Religionslehrer in Maßbach; ab 1924 bis 1938 Religionslehrer, Hilfskantor
und Schochet in Bad Kissingen, zuletzt
erster Kantor und Lehrer ebd.; 1942 wurden Gustav und Paula Neustädter mit Sohn
Ernst nach Izbica deportiert und ermordet.
Zum Tod von Lehrer Moses Nußbaum (1930, Lehrer in Maßbach von 1895 bis 1910)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem
Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege
Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er
war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in
Wiesenfeld als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach bei
Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit entfaltet
hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an sich selbst
gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre 1910 in
seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er sich
nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und
erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand
es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende
Stellung in seinem Berufe zu erobern. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem
Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege
Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er
war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in
Wiesenfeld als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach bei
Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit entfaltet
hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an sich selbst
gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre 1910 in
seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er sich
nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und
erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand
es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende
Stellung in seinem Berufe zu erobern.
An seinem Grabe vereinigte sich eine große Trauergemeinde. Neben den
jüdischen Kollegen des Bezirks waren die hiesigen Volksschullehrer sehr
zahlreich erschienen, die die Beerdigungsfeier mit einem ergreifenden
Grabgesang eröffneten. Nach der tief empfundenen Grabrede des Herrn
Rabbiners Dr. S. Bamberger, widmete ihm Ludwig Steinberger warme
Abschiedsworte als Freund und Kollege und sprach Dank und Verehrung im
Namen des Jüdischen Lehrervereins für Bayern aus. Nach einigen Abschiedsworten
des eigenen Bruders, des Herrn Hauptlehrers Nußbaum (Neumarkt), sprach
der Vorstand des Bezirkslehrervereins Kissingen im Namen des Bayerischen
Lehrervereins herzliche Worte ehrenden Gedenkens. Herr Gustav Neustädter
brachte im Namen der Gemeinde Maßbach, die sehr zahlreich am Grabe
erschienen war, Verehrung und Dankbarkeit derselben zum Ausdruck.
Mit Moses Nußbaum ist ein vorbildliches Lehrerleben verhaucht. Sein
Andenken wird in unserem Verein hoch in Ehren bleiben." |
Zum Tod von Adele Nußbaum, Witwe des Lehrers Moses
Nußbaum (1937)
 Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. Oktober 1937:
"Persönliches. Am Erew Jaum-Kippur (= 14. September 1937, Vorabend
zu Jom Kippur, Versöhnungstag) verschied Frau Adele Nußbaum, die Witwe
unseres Vereinsmitgliedes Moses Nußbaum seligen Angedenkens, Lehrers in
Maßbach. Auch an dieser Stelle sei den Kindern der verstorbenen
geschätzten Frau herzliches Beileid zum Ausdruck gebracht." Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. Oktober 1937:
"Persönliches. Am Erew Jaum-Kippur (= 14. September 1937, Vorabend
zu Jom Kippur, Versöhnungstag) verschied Frau Adele Nußbaum, die Witwe
unseres Vereinsmitgliedes Moses Nußbaum seligen Angedenkens, Lehrers in
Maßbach. Auch an dieser Stelle sei den Kindern der verstorbenen
geschätzten Frau herzliches Beileid zum Ausdruck gebracht." |
Lehrer Cegla übersiedelt nach Erez Israel (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1935:
"Maßbach (Ufr.), 3. Februar (1935). Lehrer David Cegla ist in
Erfüllung eines lang gehegten Wunsches Anfang des Monats nach Erze Israel
übergesiedelt, wo bereits zwei seiner Söhne wohnen. Cegla war wegen
seines freundlichen und zuvorkommenden Wesens sowie durch seine
Hilfsbereitschaft allgemein geschätzt. Besondere Hochachtung genoss er
wegen seiner Frömmigkeit und seines bedeutenden talmudischen Wissens,
weshalb er von dem verstorbenen Kissinger Raw - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - mit dem Chower-Titel ausgezeichnet
wurde. In einer ergreifenden Abschiedsrede verabschiedete er sich von
seiner Gemeinde, die ihm Dank für seine segensreiche Tätigkeit
aussprach." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1935:
"Maßbach (Ufr.), 3. Februar (1935). Lehrer David Cegla ist in
Erfüllung eines lang gehegten Wunsches Anfang des Monats nach Erze Israel
übergesiedelt, wo bereits zwei seiner Söhne wohnen. Cegla war wegen
seines freundlichen und zuvorkommenden Wesens sowie durch seine
Hilfsbereitschaft allgemein geschätzt. Besondere Hochachtung genoss er
wegen seiner Frömmigkeit und seines bedeutenden talmudischen Wissens,
weshalb er von dem verstorbenen Kissinger Raw - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - mit dem Chower-Titel ausgezeichnet
wurde. In einer ergreifenden Abschiedsrede verabschiedete er sich von
seiner Gemeinde, die ihm Dank für seine segensreiche Tätigkeit
aussprach." |
Lehrer i.R. Ignatz Popper aus Leer übernimmt die Religionslehrerstelle in Maßbach
(1935)
Anmerkung: Lehrer Ignatz Popper (geb. 25.1.1873 in Ahrensburg) war bis 1935
Lehrer und Kantor an der jüdischen Volksschule und in der Gemeinde in Leer /
Ostfriesland (zuvor in Weener); er war verheiratet mit
Nanette geb. Marx (geb. 1881 in Oberdorf); nach
seiner Zurruhesetzung übernahm Lehrer Popper noch einige Zeit den Unterricht
und die Betreuung der Gemeinde in Maßbach; am 22. November 1941 ist das Ehepaar
Popper von Frankfurt aus nach Kowno (Kauen) deportiert und dort wenige Tage
später ermordet worden. Die beiden Töchter Käthe (geb. 1905 in Lingen) sowie
Lea (geb. 1908 in Weener) wurden gleichfalls
von Frankfurt aus deportiert. Der einzige Überlebende der Familie, Sohn Alfred
(geb. 1911 in Weener) hat 1938 noch in die USA
emigrieren können (gest. 1992 in Falmouth, Maine, USA).
 Mitteilungen
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni
1935: "Stellenbesetzungen: Der Lehrer Hermann Rosental, bisher in
Frankfurt am Main, wurde nach Neumarkt,
der Schulamtsbewerber Färber nach Rockenhausen
berufen. - Der pensionierte Volksschullehrer Popper in Leer übernahm die
Religionslehrerstelle in Maßbach." Mitteilungen
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni
1935: "Stellenbesetzungen: Der Lehrer Hermann Rosental, bisher in
Frankfurt am Main, wurde nach Neumarkt,
der Schulamtsbewerber Färber nach Rockenhausen
berufen. - Der pensionierte Volksschullehrer Popper in Leer übernahm die
Religionslehrerstelle in Maßbach." |
Über jüdische Talmud-Tora-Schulen im 18. Jahrhundert
- in Burgpreppach und Maßbach werden 1766 Schulen gegründet
Bericht von 1938 (!) von Bezirksrabbiner (in Burgpreppach) Saul
Munk
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juli 1938: "'Talmud-Tauroh
limdinas Grabfeld'. Von Bezirksrabbiner Saul Munk in
Burgpreppach. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juli 1938: "'Talmud-Tauroh
limdinas Grabfeld'. Von Bezirksrabbiner Saul Munk in
Burgpreppach.
Am nördlichen
Ende Bayerns, südlich der Rhön, streckt sich eine Ebene hin, die den
Namen Grabfeld führt. Vor Jahrhunderten schon bestanden dort zahlreiche jüdische
Gemeinden. Einen Mittelpunkt unter ihnen bildete schon früh die Gemeinde
in Burgpreppach. Schwer ist es, den Entstehungszeitpunkt dieser Gemeinde
festzustellen. Er soll in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, oder
auch noch früher, liegen. Einen Anhaltspunkt dafür gibt der
traditionelle Fasttag der Gemeinde am Vortrag des Rausch Chaudesch Siwan,
von dessen Ursprung nur noch bekannt ist, dass ein Überfall bewaffneter
Scharen der Gemeinde drohte, und dass mit Hilfe der Schlossherrschaft
diese Gefahr gebannt wurde.
Die älteste – uns bekannte – Urkunde teilt mit, dass die
Schlossherrschaft den Juden Burgpreppachs im Jahre 1681 ein Gebäude als 'Schul' (Synagoge) zur Verfügung stellt, weil
'ihnen die Schul
ziemlich eng wurde'. Ein weiteres Datum ergibt sich aus dem Akrostichon
an der Ostwand der jetzigen Synagoge, welches das Datum des Jahres 5524 =
1764 ergibt. Eine andere Urkunde gibt bekannt, dass der Friedhof im Jahre
1706 angelegt wurde.
Die Gemeinden des Grabfeldes zeigen besonders beispielhaft, wie die Pflege
des Torastudiums als vornehmste Aufgabe der jüdischen Öffentlichkeit
betrachtet wurde. Wir besitzen ein Protokoll, das in Burgpreppach
aufgenommen wurde, und dessen Datum die Jahreszahl 5526 = 1766 aufweist.
Die Beschlüsse einer Versammlung vom 24. Tammus des genannten Jahres sind
da mit folgender Einleitung verzeichnet:
'An den oben bezeichneten Tage versammelten sich hier in
Burgpreppach Angehörige der ganzen Landschaft zur Gründung von
Thoraschulen in unserer Gegend. Es wurde ein Verein (Chewroh) gegründet.
An die Spitze desselben wurden 18 Männer gestellt; aus diesen wurden
wieder drei Oberbeamte gewählt (Obergabboim), und zwar …. (folgen
Namen). Aus der Menge der angemeldeten Schüler wurden die würdigsten und
fähigsten ausgewählt. Es wurden für diese zwei tüchtige Lehrer
bestellt. Nach dem augenblicklichen Bedürfnisse wurden zunächst zwei
Tora-Schulen gegründet, die eine am hiesigen Platze, die andere in Maßbach'.
Das Protokoll enthält weitere Angaben über die Verteilung der Schüler
auf die beiden Anstalten, über die Finanzierung des Unternehmens durch
Anlage eines Grundfonds, über die Verwaltung der Gelder, über die
Verewigung der Namen der Spender usw.
Der Stiftung wird der Name 'Talmud-Thauro limdinas Grabfeld'
gegeben.
Im Laufe der Jahre ist der materielle Bestand dieser Stiftung
ziemlich bedeutungslos geworden. Die Zinsen reichten bald nicht mehr zur
Erfüllung der Aufgabe aus. Ein kleiner, materiell unbedeutender Rest hat
sich aber über Krieg und Inflation hinweg erhalten und besteht heute noch
als 'Grabfelder Judenlandschaftsschulstiftung'.
In Burgpreppach aber ist die Idee, die der Stiftung zugrunde liegt,
seit ihrer Begründung hoch gehalten worden. Reichten die Zinsen der
Stiftung zur Erhaltung einer Schule nicht mehr aus, so flossen reichlich
Spenden, um die Tora-Schule oder eine Lernstätte zu unterhalten. So dürften
seit dem Jahre 1766 fast ununterbrochen in Burgpreppach jüdische Kinder
und Jünglinge 'Thora' gelernt haben, sei es in zu diesem Zwecke gegründeten
Schulen, sei es als Schüler der dort amtierenden Rabbiner.
Die letzte Schulgründung erfolgt im Jahre 1875 durch den verewigten
Distriktsrabbiner Abraham Hirsch seligen Andenkens. Damals wurde zur
Erhaltung der Schule ein besonderer Verein gegründet, der heute noch
bestehende 'Talmud-Thora-Verein'. Nach den Satzungen des Vereins
sollte die Schule 'gründliches, jüdisches Wissen, innige, gediegene
Religiosität, in Verbindung mit wahrer edler Bildung' verbreiten.
Die Schule hatte jeweils die Form angenommen, die den Zeitbedürfnissen
und Zeitverhältnissen entsprach. Jahrzehntelang war es eine Präparandenschule,
durch die viele nachmalige Lehrer in Deutschland gegangen sind. Später
wurde eine Bürgerschule angegliedert. Als Bürgerschule hat sich die
Anstalt bis zu ihrer Schließung im Frühjahr 1938 erhalten. Mag die
Tora-Schule in Burgpreppach nur ein winziges Element in der großen Zahl jüdischer
Schulen Deutschlands gewesen sein, so dürfte doch dieses Flämmchen jüdischer
Lehre, das dort 172 Jahre lang brannte, es verdienen, durch diese Zeilen
ganz der Vergessenheit entrissen zu werden." |
Das "Israelitische Unterrichts-Institut" zum
Vorbereitung auf gewerbliche und kaufmännische Berufe (1886)
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Maßbach ein
solches "Unterrichts-Institut". Die Werbung hierfür in der in ganz
Deutschland gelesenen orthodox-jüdischen Zeitschrift "Der Israelit"
zeigt eine gewisse überregionale Bedeutung der Einrichtung an. Bereits Lehrer
Götz Ullmann (gest. 1870, s.u.) bildete Schüler in Maßbach für
kaufmännische Berufe aus. Das Unterrichts-Institut könnte auf ihn
zurückgehen.
Bei dem unterzeichnenden Lehrer H. Goldstein handelt es sich um Hirsch
Goldstein (geb. 1854 in Bischwind, gest. 1929 in Würzburg), der von 1895
bis zu seiner Pensionierung 1913 Lehrer in Heidingsfeld
war. Er war zeitweise Vorsitzender des Israelitischen Lehrervereins für Bayern.
In Maßbach hat er geheiratet (Regina geb. Marx, geb. 1858 Maßbach, gest. 1925
Würzburg), mit der er drei in Maßbach geborene Kinder hatte (Louis (geb.
1881), Alfred (geb. 1882), Max (geb. 1883).
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1884:
"Vorbereitung zum Lehr- und Kaufmannsfache, Unterricht in
fremden Sprachen, Buchführung, kaufmännische Korrespondenz etc. bei H.
Goldstein, Maßbach bei Kissingen. Referenzen erteilen gütigst die
Herren Rabbiner zu Kissingen und Würzburg, sowie die Herren Lehrer des
israelitischen Seminars zu Würzburg." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1884:
"Vorbereitung zum Lehr- und Kaufmannsfache, Unterricht in
fremden Sprachen, Buchführung, kaufmännische Korrespondenz etc. bei H.
Goldstein, Maßbach bei Kissingen. Referenzen erteilen gütigst die
Herren Rabbiner zu Kissingen und Würzburg, sowie die Herren Lehrer des
israelitischen Seminars zu Würzburg." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1886:
"Unterrichts-Institut Maßbach bei Bad Kissingen. Gründliche
Vorbereitung zum gewerblichen und kaufmännischen Beruf. Beginn des
Semesters 2. Mai. Näheres durch den Vorstand H. Goldstein". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1886:
"Unterrichts-Institut Maßbach bei Bad Kissingen. Gründliche
Vorbereitung zum gewerblichen und kaufmännischen Beruf. Beginn des
Semesters 2. Mai. Näheres durch den Vorstand H. Goldstein". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1886:
"Israelitisches Unterrichts-Institut Massbach bei Bad Kissingen.
Gründliche Vorbereitung zum sofortigen Übertritt in bürgerlichen und
kaufmännischen Beruf. Billige und gute Pension. Beginn des Semesters 27.
Oktober. Näheres durch H. Goldstein, Vorstand." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1886:
"Israelitisches Unterrichts-Institut Massbach bei Bad Kissingen.
Gründliche Vorbereitung zum sofortigen Übertritt in bürgerlichen und
kaufmännischen Beruf. Billige und gute Pension. Beginn des Semesters 27.
Oktober. Näheres durch H. Goldstein, Vorstand." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Louis David Katzenberger (1904)
Zur Familiengeschichte siehe mehr unten bei Weitere
Dokumente.
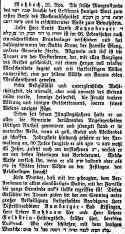 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1904:
"Maßbach, 21. November (1904). Die frühe Morgenstunde des Schabbat
wejeze (Schabbat mit der Toralesung 'und es ging hinaus', 19. November
1904) brachte des Erklärers sinniges Wort zum ersten Verse des
Wochenabschnittes 'du gingst als Gerechter hinaus von diesem Ort in das
Land des Wohlgefallens' uns in erschütternder Weise zum
Bewusstsein. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1904:
"Maßbach, 21. November (1904). Die frühe Morgenstunde des Schabbat
wejeze (Schabbat mit der Toralesung 'und es ging hinaus', 19. November
1904) brachte des Erklärers sinniges Wort zum ersten Verse des
Wochenabschnittes 'du gingst als Gerechter hinaus von diesem Ort in das
Land des Wohlgefallens' uns in erschütternder Weise zum
Bewusstsein.
Unser Herr Louis David Katzenberger - Herr Jehuda Sohn des David
HaKohen, des Gelehrten dieser Gemeinde - ist im 66. Lebensjahre nach
einwöchentlichem Krankenlager verschieden und hat dahingenommen der
Gattin Krone, der Familie Glanz, unserer Gemeinde Zierde. Allgemein und
tief ist die Trauer um den Verstorbenen, der, mit allen Vorzügen des
Geistes geschmückt, mit einem Herzen voll reinster Menschenliebe begabt
und mit tatkräftigem Willen ausgerüstet, eine gar seltene Blüte am
Baume edlen Menschentums gewesen.
Echte Religiosität und unvergleichliche Wohltätigkeit, die niemals, aber
auch niemals des Gebens müde wurde, sonnige Heiterkeit, die Frucht wahrer
Bildung und innigen Gottvertrauens, waren seines Wesens uneigne Züge.
Schon seit seinen Jünglingsjahren hatte er an allen die Gemeinde
berührenden Angelegenheiten tätigen Anteil genommen und jederzeit stand
er in vorderster Reihe, wenn es galt, Gutes und Bleibendes zu schaffen.
Jahrzehnte gehörte er der Verwaltung an, 30 Jahre fungierte er als Baal
tekoa (Schofarbläser an den Hohen Feiertagen) und wohl 45 Jahre,
zuletzt noch am verflossenen Jom Kippur (Versöhnungstag), versah
er an den hohen Feiertagen das Vorbeteramt. Welche Weihe umfloss ihn, wenn
er als Sch'tz (Vorbeter) dastand oder als Kohen (aus
dem Priestergeschlecht Stammender) in Mitten seiner Söhne an den
Festtagen den Priestersegen sprach!
Kein Wunder, dass mit der gebeugten, dem Verstorbenen in allem
ebenbürtigen Gattin, mit der Familie die ganze Gemeinde aufs tiefste
ergriffen ist! Diesen Gefühlen der Trauer gaben bei der am Sonntag unter
großer Beteiligung stattgehabten Beerdigung Herr Distriktsrabbiner
Bamberger - Bad Kissingen, Herr Lehrer Nußbaum hier und Herr Lehrer
Goldstein - Heidingsfeld, früher hier, beredten Ausdruck. Wir aber
schließen mit sinnigen Wunsch: 'Er macht verschwinden den Tod für
immer, und es löscht Gott, der Herr die Träne von jeglichem Angesicht'
(Jesaja 25,8)". |
Zum Tod von Fanny Marx, Ehefrau von M. A. Marx (1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1915:
"Maßbach (Unterfranken), 8. Februar (1915). Unter großer
Beteiligung von nah und fern wurde hier Frau Fanny Marx zur ewigen Ruhe
bestattet. Mit ihr ist eine wackere Frau in des Wortes schönster
Bedeutung ins Grab gesunken. Der nun vereinsamte Gatte, Herr M.A. Marx,
tief im Sterbezimmer mit tränenerstickter Stimme der so jäh Dahingeschiedenen
heiße Worte des Dankes für die ihm in 38jähriger Ehe erwiesene Treue
und Liebe nach, mit dem Hinweis, dass der jüngste Sohn in den
Schützengräben Nordfrankreichs in dieser Stunde noch keine Ahnung habe
von dem schweren Verlust, der die ganze Familie betroffen hat. Unter
Anlehnung an den Wochenabschnitt schilderte Herr Hauptlehrer Freudenberger
von hier die wahre Frömmigkeit, die Friedensliebe, die Mildtätigkeit,
die Bescheidenheit und die häuslichen Tugenden der Verstorbenen. Im Namen
der Familie widmete Herr Hauptlehrer Marx aus Gunzenhausen der geliebten
Schwägerin einen ehrenden Nachruf. Ihr Andenken bleibt ein gesegnetes. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1915:
"Maßbach (Unterfranken), 8. Februar (1915). Unter großer
Beteiligung von nah und fern wurde hier Frau Fanny Marx zur ewigen Ruhe
bestattet. Mit ihr ist eine wackere Frau in des Wortes schönster
Bedeutung ins Grab gesunken. Der nun vereinsamte Gatte, Herr M.A. Marx,
tief im Sterbezimmer mit tränenerstickter Stimme der so jäh Dahingeschiedenen
heiße Worte des Dankes für die ihm in 38jähriger Ehe erwiesene Treue
und Liebe nach, mit dem Hinweis, dass der jüngste Sohn in den
Schützengräben Nordfrankreichs in dieser Stunde noch keine Ahnung habe
von dem schweren Verlust, der die ganze Familie betroffen hat. Unter
Anlehnung an den Wochenabschnitt schilderte Herr Hauptlehrer Freudenberger
von hier die wahre Frömmigkeit, die Friedensliebe, die Mildtätigkeit,
die Bescheidenheit und die häuslichen Tugenden der Verstorbenen. Im Namen
der Familie widmete Herr Hauptlehrer Marx aus Gunzenhausen der geliebten
Schwägerin einen ehrenden Nachruf. Ihr Andenken bleibt ein gesegnetes. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Soldatentod von Moritz Marx (1915)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juni 1915:
"Maßbach (Unterfranken), 15. Juni (1915). Nunmehr hat auch in
der hiesigen jüdischen Gemeinde der schreckliche Krieg ein schweres Opfer
gefordert, das umso schmerzlicher berührt, als dadurch einem auch für
das Wohl der Gesamtheit vielversprechenden jungen Leben so
unerwartet rasch ein Ziel gesteckt wurde. Moritz Marx, Sohn des in weiten
Kreisen bekannten Herrn M. A. Marx dahier, rückte am 11. Mai voll
Gottvertrauen und Zuversicht nach dem Westen ab und schon am darauf
folgenden Heiligen Schabbat wurde er im Schützengraben von einer
feindlichen Granate tödlich getroffen. In ein Einzelgrab gebettet wurde
er von dem Leutnant Krämer, einem pfälzischen Lehrer, mit einem Grabstein
verstehen, doch soll die Überführung, wenn von militärischer Seite kein
Hindernis entgegensteht, in die Heimat und in ein jüdisches Grab
geschehen. Des Heimgegangenen stetes Streben war, dem mustergültigen
Vorbilde im elterlichen Hause gemäß sein Leben zu gestalten und dieses
mit den Vorschriften unserer heiligen Tora in Einklang zu bringen. In
seiner Militärzeit ertrug er öfters lieber Entbehrungen als etwas
Verbotenes zu genießen. Mit guten Stimmmitteln begabt, hat er besonders
an den Ehrfurchtgebietenden Tagen verschiedene Gemeinden durch
seinen Vortrag erbaut (sc. er übernahm zwischen Neujahr und Jom Kippur
im Herbst Vertretungsdienste als ehrenamtlicher Vorbeter). Als
charaktervoller junger Mann, voller Herzensgüte und Hilfsbereitschaft
gegen jedermann, fand er überall Achtung und
Wertschätzung.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juni 1915:
"Maßbach (Unterfranken), 15. Juni (1915). Nunmehr hat auch in
der hiesigen jüdischen Gemeinde der schreckliche Krieg ein schweres Opfer
gefordert, das umso schmerzlicher berührt, als dadurch einem auch für
das Wohl der Gesamtheit vielversprechenden jungen Leben so
unerwartet rasch ein Ziel gesteckt wurde. Moritz Marx, Sohn des in weiten
Kreisen bekannten Herrn M. A. Marx dahier, rückte am 11. Mai voll
Gottvertrauen und Zuversicht nach dem Westen ab und schon am darauf
folgenden Heiligen Schabbat wurde er im Schützengraben von einer
feindlichen Granate tödlich getroffen. In ein Einzelgrab gebettet wurde
er von dem Leutnant Krämer, einem pfälzischen Lehrer, mit einem Grabstein
verstehen, doch soll die Überführung, wenn von militärischer Seite kein
Hindernis entgegensteht, in die Heimat und in ein jüdisches Grab
geschehen. Des Heimgegangenen stetes Streben war, dem mustergültigen
Vorbilde im elterlichen Hause gemäß sein Leben zu gestalten und dieses
mit den Vorschriften unserer heiligen Tora in Einklang zu bringen. In
seiner Militärzeit ertrug er öfters lieber Entbehrungen als etwas
Verbotenes zu genießen. Mit guten Stimmmitteln begabt, hat er besonders
an den Ehrfurchtgebietenden Tagen verschiedene Gemeinden durch
seinen Vortrag erbaut (sc. er übernahm zwischen Neujahr und Jom Kippur
im Herbst Vertretungsdienste als ehrenamtlicher Vorbeter). Als
charaktervoller junger Mann, voller Herzensgüte und Hilfsbereitschaft
gegen jedermann, fand er überall Achtung und
Wertschätzung.
Sein früher Tod hat viele Hoffnungen zerstört, namentlich bei seinem
Vater, der in ihm eine zuverlässige Stütze und einen verständnisvollen
Mitarbeiter im Berufe, der zur späteren Übernahme des langbestehenden
Geschäftes bestimmt war, verloren hat. In Verwandten- und Freundeskreis
wird das Andenken unseres Moritz Marx ein dauerndes und gesegnetes sein. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Heinrich Simon (1923)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1923: "Moßbach
(= Maßbach, 31. Januar (1923). Unter sehr großer
Beteiligung der hiesigen Kultusgemeinde und Ortsbevölkerung, sowie einer
stattlichen Anzahl auswärtiger Freunde wurde heute unser ältestes
Gemeindemitglied Heinrich Simon zu Grabe gebracht. Ein Mann von
echt-jüdischer Frömmigkeit, mit einem bescheidenen Sinn und vornehmer
Denkungsart ist mit ihm in das Reich der Ewigkeit gegangen. Bei der
Beerdigung hob Herr Lehrer Neustädter die Verdienste des Verstorbenen
hervor und ermahnte die jüngere Generation, dem frommen Beispiele des
80jährigen zu folgen und ebenso eifrig im Besuche des Gottesdienstes zu
sein, wie es der Senior der Gemeinde bis fast zu seinem Ende gewesen. Mit Simon
ist einer der letzten alten Schlages einer weit bekannten und
echtjüdischen Gemeinde dahingegangen, was einen bemerkbaren Verlust für
das gesamte Judentum bedeutet. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1923: "Moßbach
(= Maßbach, 31. Januar (1923). Unter sehr großer
Beteiligung der hiesigen Kultusgemeinde und Ortsbevölkerung, sowie einer
stattlichen Anzahl auswärtiger Freunde wurde heute unser ältestes
Gemeindemitglied Heinrich Simon zu Grabe gebracht. Ein Mann von
echt-jüdischer Frömmigkeit, mit einem bescheidenen Sinn und vornehmer
Denkungsart ist mit ihm in das Reich der Ewigkeit gegangen. Bei der
Beerdigung hob Herr Lehrer Neustädter die Verdienste des Verstorbenen
hervor und ermahnte die jüngere Generation, dem frommen Beispiele des
80jährigen zu folgen und ebenso eifrig im Besuche des Gottesdienstes zu
sein, wie es der Senior der Gemeinde bis fast zu seinem Ende gewesen. Mit Simon
ist einer der letzten alten Schlages einer weit bekannten und
echtjüdischen Gemeinde dahingegangen, was einen bemerkbaren Verlust für
das gesamte Judentum bedeutet. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens". |
Max A. Marx erhält den Chower-Titel (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1921:
"Maßbach, 20. März. Herrn Max A. Marx ist in Anbetracht seiner
mannigfachen Verdienste vom Rabbinate Kissingen der Chower-Titel erteilt
worden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1921:
"Maßbach, 20. März. Herrn Max A. Marx ist in Anbetracht seiner
mannigfachen Verdienste vom Rabbinate Kissingen der Chower-Titel erteilt
worden." |
Zum 70. Geburtstag von Max A. Marx (1922)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1922:
"Maßbach, 27. August (1922). Vorige Woche feierte Herr M. A. Marx in
voller Rüstigkeit und Arbeitsfreude seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist
dank seiner steten Pflichttreue und seines unbedingten Festhaltens an den
Lehrern von unserer heiligen Tora seiner, wenn auch kleinen
Gemeinde, ein echt jüdisches Vorbild in althergebrachtem Sinne. Er ist
auch darüber hinaus eifriger Förderer edler Bestrebungen und hat es
verstanden, durch seine Gewissenhaftigkeit sich großes Ansehen und
Verehrung auch bei den nichtjüdischen Mitbürgern zu erwerben. Als Mohel
(Beschneider) genießt Herr Marx einen Ruf über sein Bayernland hinaus.
Möge es dem Jubilar vergönnt sein, noch recht lange in unserer Gemeinde
zu wirken." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1922:
"Maßbach, 27. August (1922). Vorige Woche feierte Herr M. A. Marx in
voller Rüstigkeit und Arbeitsfreude seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist
dank seiner steten Pflichttreue und seines unbedingten Festhaltens an den
Lehrern von unserer heiligen Tora seiner, wenn auch kleinen
Gemeinde, ein echt jüdisches Vorbild in althergebrachtem Sinne. Er ist
auch darüber hinaus eifriger Förderer edler Bestrebungen und hat es
verstanden, durch seine Gewissenhaftigkeit sich großes Ansehen und
Verehrung auch bei den nichtjüdischen Mitbürgern zu erwerben. Als Mohel
(Beschneider) genießt Herr Marx einen Ruf über sein Bayernland hinaus.
Möge es dem Jubilar vergönnt sein, noch recht lange in unserer Gemeinde
zu wirken." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1922: "Maßbach
(Unterfranken), 17. September (1922). Am Freitag, den 1. September,
feierte Herr M. A. Marx dahier, ein in den orthodoxen Kreisen ganz
Deutschlands nicht unbekannter Mann, seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist
Inhaber einer Metzgerei und eines Wurstwarenversandgeschäftes und
überzeugter Jehudi. Das Kissinger Rabbinat würdigte seine Verdienste um
die religiösen und profanen Institutionen der Gemeinde, des Distrikts und
der gesamten Judenheit durch Verleihung des Chawer-Titels. Herr
Marx ist Ausschussmitglied des bayerischen Rates und diverser anderer
Vereinigungen zur Förderung und Erhaltung des traditionellen Judentums.
Seit jungen Jahren übt er die Funktionen eines Mohels (Beschneiders)
unentgeltlich aus. Entbehrungen vieler Art war er dadurch ausgesetzt, aber
er scheute Wind und Wetter nicht, Verluste pekuniärer und ideeller Art,
um diese Mizwoh (göttliche Weisung) zu erfüllen. Wohl 600 oder
noch mehr Knaben wurden von ihm in Abrahams Bund eingeführt. Seit fünf
Jahrzehnten versieht er unentgeltlich das Amt eines Chasan
(ehrenamtlichen Vorbeters) an den ehrfurchtgebietenden Tagen in
prachtvollster Weise, ebenso das Amt eines Bal-Tokeah (Schofarbläsers).
Als infolge der geringen Kinderzahl die bayerische Regierung die
bestehende Elementarschule aufhob, war er es, der unermüdlich dafür
sorgte, dass Maßbach nicht ohne jüdische Lehrer blieb. Die Anlegung
eines Friedhofes in Maßbach ist sein Verdienst. Prüfungen mancher
Art waren ihm auferlegt. Sein unerschütterliches Gottvertrauen ließ ihn
göttliche Fügung hinnehmen und hielt ihn aufrecht. Möge es dem Jubilar
vergönnt sein, noch viele Jahre in gleich geistiger und körperlicher
Frische wie heute im Kreise seiner Enkel zum Segen seiner Familie, der
Interessen der jüdischen Gemeinde Maßbach und des Distrikts und der
gesamten Judenheit zu verbringen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1922: "Maßbach
(Unterfranken), 17. September (1922). Am Freitag, den 1. September,
feierte Herr M. A. Marx dahier, ein in den orthodoxen Kreisen ganz
Deutschlands nicht unbekannter Mann, seinen 70. Geburtstag. Herr Marx ist
Inhaber einer Metzgerei und eines Wurstwarenversandgeschäftes und
überzeugter Jehudi. Das Kissinger Rabbinat würdigte seine Verdienste um
die religiösen und profanen Institutionen der Gemeinde, des Distrikts und
der gesamten Judenheit durch Verleihung des Chawer-Titels. Herr
Marx ist Ausschussmitglied des bayerischen Rates und diverser anderer
Vereinigungen zur Förderung und Erhaltung des traditionellen Judentums.
Seit jungen Jahren übt er die Funktionen eines Mohels (Beschneiders)
unentgeltlich aus. Entbehrungen vieler Art war er dadurch ausgesetzt, aber
er scheute Wind und Wetter nicht, Verluste pekuniärer und ideeller Art,
um diese Mizwoh (göttliche Weisung) zu erfüllen. Wohl 600 oder
noch mehr Knaben wurden von ihm in Abrahams Bund eingeführt. Seit fünf
Jahrzehnten versieht er unentgeltlich das Amt eines Chasan
(ehrenamtlichen Vorbeters) an den ehrfurchtgebietenden Tagen in
prachtvollster Weise, ebenso das Amt eines Bal-Tokeah (Schofarbläsers).
Als infolge der geringen Kinderzahl die bayerische Regierung die
bestehende Elementarschule aufhob, war er es, der unermüdlich dafür
sorgte, dass Maßbach nicht ohne jüdische Lehrer blieb. Die Anlegung
eines Friedhofes in Maßbach ist sein Verdienst. Prüfungen mancher
Art waren ihm auferlegt. Sein unerschütterliches Gottvertrauen ließ ihn
göttliche Fügung hinnehmen und hielt ihn aufrecht. Möge es dem Jubilar
vergönnt sein, noch viele Jahre in gleich geistiger und körperlicher
Frische wie heute im Kreise seiner Enkel zum Segen seiner Familie, der
Interessen der jüdischen Gemeinde Maßbach und des Distrikts und der
gesamten Judenheit zu verbringen." |
Zum Tod von Babette Roßmann (1923)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1923: "Maßbach,
8. Juni (1923). Unter zahlreicher Beteiligung wurde am 7. dieses Monats
Fräulein Babette Roßmann zu Grabe getragen. Der elterlichen Erziehung
und den Grundsätzen der Religion treubleibend hielt sie mit besonderer
Gewissenhaftigkeit auf die Ausübung aller Mizwaus (Gebote). Ein
reiches jüdisches und profanes Wissen befähigte sie zu guten
Ratschlägen und einer angenehmen Gesellschafterin, wodurch sie sich die
Hochachtung und Freundschaft eines großen Kreises erwarb. Ihr
mustergültiges, friedliches Leben im Hause ihrer hier verheirateten Schwester
schilderte Lehrer Neustädter als ganz besonders rühmenswerte
Charaktereigenschaften der Verstorbenen. Möge uns ihr Verdienst
beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1923: "Maßbach,
8. Juni (1923). Unter zahlreicher Beteiligung wurde am 7. dieses Monats
Fräulein Babette Roßmann zu Grabe getragen. Der elterlichen Erziehung
und den Grundsätzen der Religion treubleibend hielt sie mit besonderer
Gewissenhaftigkeit auf die Ausübung aller Mizwaus (Gebote). Ein
reiches jüdisches und profanes Wissen befähigte sie zu guten
Ratschlägen und einer angenehmen Gesellschafterin, wodurch sie sich die
Hochachtung und Freundschaft eines großen Kreises erwarb. Ihr
mustergültiges, friedliches Leben im Hause ihrer hier verheirateten Schwester
schilderte Lehrer Neustädter als ganz besonders rühmenswerte
Charaktereigenschaften der Verstorbenen. Möge uns ihr Verdienst
beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von M. A. Marx - langjähriger
Gemeindevorsteher, Beschneider u.a.m. (1924)
vgl. unten Anzeige aus seinem Gewerbebetrieb 1893
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1924:
"Maßbach, 6. März (1924). Einen unersetzlichen Verlust
erleidet die hiesige Kultusgemeinde durch den Heimatgang ihres
langjährigen früheren Vorstandes, Herrn M.A. Marx. Im echt jüdischen
Elternhause nach den alten Traditionen erzogen, hielt er mit peinlicher
Gewissenhaftigkeit alle Mizwot (Gebote) und war er stets bestrebt,
seine Kinder in gleichem Sinne zu erziehen. Seine freie Zeit - nach des
Tages schwerer Arbeit - benützte er schon in Jugendjahren zur Vertiefung
in die jüdischen und profanen Wissenschaften und so konnte er - ein Fall,
der wohl selten dastehen dürfte - als jüdischer Metzger schön im
jüdischen Schrifttum lernen. Als Chasan (Vorbeter, oder sollte
hier wegen dem Nachfolgenden besser Mohel stehen = Beschneider?) ist
Herr Marx in weitesten Kreisen bekannt. 607 Knaben sind von ihm in den Heiligen
Bund eingeführt. Sein Sinn für Wohltätigkeit dürfte einzig
dastehen. Die hiesige Gemeinde, für deren Erhaltung er bis zu seinem Ende
bestrebt war, verdankt seinen Bemühungen ihre sämtlichen, der Neuzeit
entsprechenden, gut erhaltenen Institutionen, sodass ihm aus Anerkennung
seiner Verdienste vor zwei Jahren der Chawer-Titel zuerkannt
wurde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1924:
"Maßbach, 6. März (1924). Einen unersetzlichen Verlust
erleidet die hiesige Kultusgemeinde durch den Heimatgang ihres
langjährigen früheren Vorstandes, Herrn M.A. Marx. Im echt jüdischen
Elternhause nach den alten Traditionen erzogen, hielt er mit peinlicher
Gewissenhaftigkeit alle Mizwot (Gebote) und war er stets bestrebt,
seine Kinder in gleichem Sinne zu erziehen. Seine freie Zeit - nach des
Tages schwerer Arbeit - benützte er schon in Jugendjahren zur Vertiefung
in die jüdischen und profanen Wissenschaften und so konnte er - ein Fall,
der wohl selten dastehen dürfte - als jüdischer Metzger schön im
jüdischen Schrifttum lernen. Als Chasan (Vorbeter, oder sollte
hier wegen dem Nachfolgenden besser Mohel stehen = Beschneider?) ist
Herr Marx in weitesten Kreisen bekannt. 607 Knaben sind von ihm in den Heiligen
Bund eingeführt. Sein Sinn für Wohltätigkeit dürfte einzig
dastehen. Die hiesige Gemeinde, für deren Erhaltung er bis zu seinem Ende
bestrebt war, verdankt seinen Bemühungen ihre sämtlichen, der Neuzeit
entsprechenden, gut erhaltenen Institutionen, sodass ihm aus Anerkennung
seiner Verdienste vor zwei Jahren der Chawer-Titel zuerkannt
wurde." |

Todesanzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März
1924: "Nach langem schweren Leiden wurde uns unser innigstgeliebter
Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel Herr M.A.
Max heute Nacht durch den Tod entrissen. Massbach (Unterfranken), 4.
März 1924. Die tieftrauernden Hinterbliebenen". |
Jubiläum des Fleisch- und Wurstwarengeschäftes von Max A. Marx
(1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juni 1927:
"Maßbach (Unterfranken), 14. Juni (1927). Ein seltenes Jubiläum
konnte am 11. Juni dieses Jahres das Fleisch- und Wurstwarengeschäft M.A.
Marx in Maßbach begehen. Laut vorhandener amtlicher Urkunde vom 11. Juni
1827 erhielt der Großvater des jetzigen Inhabers an diesem Tage die
Konzession zur Ausübung des Metzgergewerbes in
Maßbach." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juni 1927:
"Maßbach (Unterfranken), 14. Juni (1927). Ein seltenes Jubiläum
konnte am 11. Juni dieses Jahres das Fleisch- und Wurstwarengeschäft M.A.
Marx in Maßbach begehen. Laut vorhandener amtlicher Urkunde vom 11. Juni
1827 erhielt der Großvater des jetzigen Inhabers an diesem Tage die
Konzession zur Ausübung des Metzgergewerbes in
Maßbach." |
Zum Tod von Jeanette Strupp geb. Eisemann (gest. 1928
in Brückenau)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Brückenau,
20. Mai (1928). Nach kaum vollendetem fünfundsiebzigsten Lebensjahre
verschied hier Frau Jeanette Strupp geb. Eisemann. Von ihrem Geburtsort Maßbach
(Ufr.), woselbst die schlichte, anspruchslose, stets pflichttreue Frau ein
echt jüdisches Haus gründete, siedelte sie in unsere Gemeinde über, die
ihr zur zweiten Heimat wurde. Wechselvoll zwar war ihr Lebensschicksal,
doch ihr Gottvertrauen hielt sie stets aufrecht. Nun hat ihr
arbeitsreiches Leben, das nicht nur zahlenmäßig, sondern mehr dem Inhalt
nach ihm Sinne der 'sieben vollen Wochen' (3. Mose 23,15)
bezeichnet werden darf, einen sanften Abschluss gefunden. Nicht nur im Kreise
ihrer Familie, auch in unserer Gemeinde wird ihr Andenken ein gesegnetes
bleiben. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Brückenau,
20. Mai (1928). Nach kaum vollendetem fünfundsiebzigsten Lebensjahre
verschied hier Frau Jeanette Strupp geb. Eisemann. Von ihrem Geburtsort Maßbach
(Ufr.), woselbst die schlichte, anspruchslose, stets pflichttreue Frau ein
echt jüdisches Haus gründete, siedelte sie in unsere Gemeinde über, die
ihr zur zweiten Heimat wurde. Wechselvoll zwar war ihr Lebensschicksal,
doch ihr Gottvertrauen hielt sie stets aufrecht. Nun hat ihr
arbeitsreiches Leben, das nicht nur zahlenmäßig, sondern mehr dem Inhalt
nach ihm Sinne der 'sieben vollen Wochen' (3. Mose 23,15)
bezeichnet werden darf, einen sanften Abschluss gefunden. Nicht nur im Kreise
ihrer Familie, auch in unserer Gemeinde wird ihr Andenken ein gesegnetes
bleiben. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Felix Heidelberger (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1935:
"Maßbach (Unterfranken), 13. Juni (1935). Vor kurzem starb hier
Felix Heidelberger im 69. Lebensjahre. Mit ihm ist ein frommer, guter Jehudi
dahingegangen, der seine Kinder in Gemeinschaft mit seiner gleichgesinnten
Gattin zu bewussten Juden erzogen hat. - Am Grabe zeichneten Herr
Hauptlehrer Popper, sowie Herr Kantor Neustädter, Bad Kissingen, das
Lebensbild des Dahingegangenen. Die große Beteiligung bei der Bestattung
zeugte von seinem guten Namen bei all seinen Bekannten. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1935:
"Maßbach (Unterfranken), 13. Juni (1935). Vor kurzem starb hier
Felix Heidelberger im 69. Lebensjahre. Mit ihm ist ein frommer, guter Jehudi
dahingegangen, der seine Kinder in Gemeinschaft mit seiner gleichgesinnten
Gattin zu bewussten Juden erzogen hat. - Am Grabe zeichneten Herr
Hauptlehrer Popper, sowie Herr Kantor Neustädter, Bad Kissingen, das
Lebensbild des Dahingegangenen. Die große Beteiligung bei der Bestattung
zeugte von seinem guten Namen bei all seinen Bekannten. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Der Toraschreiber (Sofer) B. Federlein zieht nach Schweinfurt (1867)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1867: "Ich
zeige hiermit an, dass ich nicht mehr in Maßbach, sondern in Schweinfurt,
Brückengasse Nr. 92, wohne und sind beständig Ritualien aller Art (Tefillot,
Machsorim, Chamuschim, Talitim, Tefillin und Messusot) vorrätig bei
mir zu haben. B. Federlein, Sofer (Toraschreiber)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1867: "Ich
zeige hiermit an, dass ich nicht mehr in Maßbach, sondern in Schweinfurt,
Brückengasse Nr. 92, wohne und sind beständig Ritualien aller Art (Tefillot,
Machsorim, Chamuschim, Talitim, Tefillin und Messusot) vorrätig bei
mir zu haben. B. Federlein, Sofer (Toraschreiber)." |
Anzeigen der Metzgerei M. A. Marx (1893 / 1903)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Koscher.
M. A. Marx, Maßbach, Unterfranken offeriert Koch- und Servelatwurst,
Rauch- und Pökelfleisch, ger. Zungen in bekannter Güte zu billigsten
Preisen. Versand gegen Nachnahme. Referenz Ihre Erwürden die Herren
Rabbiner Bamberger in Bad Kissingen, Buttenwieser in Straßburg im Elsass." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Koscher.
M. A. Marx, Maßbach, Unterfranken offeriert Koch- und Servelatwurst,
Rauch- und Pökelfleisch, ger. Zungen in bekannter Güte zu billigsten
Preisen. Versand gegen Nachnahme. Referenz Ihre Erwürden die Herren
Rabbiner Bamberger in Bad Kissingen, Buttenwieser in Straßburg im Elsass."
vgl. unten Nachruf zum Tod von M.A. Marx 1924. |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. Juni 1903: "Lehrling, Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. Juni 1903: "Lehrling,
Sohn religiöser Eltern, zum sofortigen Eintritt gesucht.
M.A. Marx, Metzgerei und Wurstwaren, Maßbach
(Unterfranken)." |
Anzeigen der Bäckerei Samuel Eberhardt (1900 / 1901 / 1903 / 1906)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1900: "Suche
für meine Samstags und Feiertage geschlossene Bäckerei einen Gesellen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1900: "Suche
für meine Samstags und Feiertage geschlossene Bäckerei einen Gesellen.
Samuel Eberhardt jun., Massbach, Bayern." |
| |
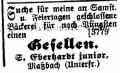 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901: Suche
für meine an Samstagen und Feiertagen geschlossene Bäckerei für nach
Pfingsten einen Gesellen. S. Eberhardt junior, Maßbach
(Unterfranken)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901: Suche
für meine an Samstagen und Feiertagen geschlossene Bäckerei für nach
Pfingsten einen Gesellen. S. Eberhardt junior, Maßbach
(Unterfranken)." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1903:
"Suche zum sofortigen Eintritt, oder für sogleich nach Ostern einen
Bäckergesellen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1903:
"Suche zum sofortigen Eintritt, oder für sogleich nach Ostern einen
Bäckergesellen.
S. Eberhardt, Maßbach, Unterfranken." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. März 1906:
"Suche für gleich nach Ostern einen Gesellen. Samstags
geschlossen. Samuel Eberhardt, Bäckerei, Massbach in
Unterfranken." Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. März 1906:
"Suche für gleich nach Ostern einen Gesellen. Samstags
geschlossen. Samuel Eberhardt, Bäckerei, Massbach in
Unterfranken." |
Anzeige der Metzgerei M. A. Marx, Inh. A. Friedmann (1924)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1924: "Kräftiger
Lehrling Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1924: "Kräftiger
Lehrling
von achtbaren Eltern per sofort gesucht. Schabbat und
Feiertag streng geschlossen.
M.A. Marx, Inh. A. Friedmann, Metzgerei und
Wurtwaren, Maßbach i.Ufr." |
Heiratsanzeige für Adolf Schäfer und Lina
geb. Marx (1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925: "Adolf
Schäfer und Lina Schäfer geb. Marx. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925: "Adolf
Schäfer und Lina Schäfer geb. Marx.
Vermählte.
Stuttgart - Reinsburgstr.
110 III und Massbach - Unterfranken. 7. Mai 1925." |
| Weitere Informationen zur Geschichte von
Adolf und Lina Schäfer siehe Verlegungsblatt
der Stolperstein-Initiative Stuttgart-West. |
Geburtsanzeige von Fanny und Marga Friedmann (1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar 1925: "Gott
sei gepriesen. Fanny-Marga. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Februar 1925: "Gott
sei gepriesen. Fanny-Marga.
Die glückliche Geburt zwei gesunder
Mädels zeigen dankerfüllt an
Adolf Friedmann und Frau Dora geb. Marx.
Massbach (Unterfranken), 9. Februar 1925 - 15. Schewat 5685." |
Weitere Dokumente
(Postkarte Katzenberger aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries; Erläuterungen auf
Grund der Recherchen von P. K. Müller)
Postkarte
von
Louis David Katzenberger (1878) |
 |
 |
Die (bayerische) Postkarte mit
geschäftlichem Inhalt wurde am 10. Januar 1878 versandt von Louis David Katzenberger aus Massbach
nach
Langensalza an Herrn C. Graeser's Witwe & Sohn (Baumwollweberei - Baumwollprodukte). L. D. Katzenberger fordert eine Preisliste der Fabrikate
der Firma an.
Zur Familiengeschichte: Louis David Katzenberger (geb. 30. Juni 1838 in
Maßbach; gest. 1904, siehe Bericht oben; Grab im jüdischen
Friedhof Maßbach), war seit Dezember 1867 verheiratet mit
Helene geb. Adelberg (auch: Adelburg; geb. 14. Juni 1846 in Aschbach,
gest. 1933 in Schweinfurt; Grab im jüdischen
Friedhof in Maßbach. Das Ehepaar hatte 13 Kinder, von denen vier oder
fünf bereits im frühen Kindesalter starben:
? Hulka ? (geb. 19. Oktober 1871, war das dritte Kind und starb bereits 20. März
1872), Hannchen (geb. 18. Januar 1880, war das achte Kind und starb bereits am 24. Juli
1880), Hugo (geb. am 20. April 1885, war das zwölfte Kind und starb
am 17. März 1890), Elsa (geb. am 25. Oktober 1888, war das dreizehnte Kind und starb am 17. März
1890), Samson (geb. 18. Januar 1880, kam zusammen mit Hannchen zur Welt, weitere Informationen
fehlen).
Die weiteren acht Kinder erlebten alle noch den Nationalsozialismus,
sieben davon wurden Opfer des Holocaust.
Clothilde, die Älteste, geboren am 1. Juli 1869 in Maßbach - Todestag, 17. Mai 1942 in Theresienstadt.
Meta, geboren am 5. Juni 1870 in Maßbach - Todestag, 14. Mai 1943 in Theresienstadt.
Leo (Lehmann), geboren am 25. November 1873 in Maßbach - Todestag, 3. Juni 1942 in München (siehe
weitere Informationen oben aus dieser Zeit beziehungsweise direkt http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Katzenberger).
Rosa, geboren am 24. April 1877 in Maßbach - Todesjahr 1942, in Izbica, Durchgangslager bei Lublin.
Max, geboren am 8. Oktober 1878 in Maßbach - Todesjahr 1942, Todeslager Belzec.
Ida, geboren am 10. Januar 1882 - Todesjahr 1942.
Recha, geboren 25. Juli 1883 in Maßbach - Todesdatum: Mai 1942 in Izbica.
Nur David, geboren am 11. Februar 1875 in Maßbach, deportiert nach Theresienstadt am 10. September 1942 überlebte
Theresienstadt und wanderte 1946 nach Palästina aus.
Leo Katzenberger´s Frau Claire wurde zusammen mit ihrem Schwager Max Katzenberger und dessen Frau Claire am 24. März 1942 nach Izbica bei Lublin transportiert.
vgl. Quellen: http://www.histvereinwor.de/pdf2012/hvw_oase_schweinfurt_rosenthal.pdf
http://www.geocities.ws/meira_freimann/fam00010.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Katzenberger
http://www.ns-archiv.de/system/justiz/katzenberger.php
|
| |
| |
| Über
den Gründer der Enzianbrennerei "L. Eberhardt" in München |
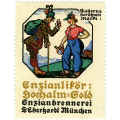 Der Gründer der Enzianbrennerei "L. Eberhardt" ("Blaukranz-Enzian")
war der in Maßbach geborene Lazarus Eberhardt. Er ist 1849 in
Maßbach als achtes von insgesamt neun Kindern des Handelsmannes Alexander
Eberhardt und seiner Frau Marianne geb. Rosenstein geboren.
Lazarus Eberhardt war verheiratet mit Cäcilie geb. Klopfer aus Hürben.
Die beiden lebten in München, wo Lazarus 1879 die Enzianbrennerei
"L. Eberhardt" gründete, die später zur bedeutendsten
Enziandestillerie in Deutschland wurde. Nach dem Tod von Lazarus Eberhardt
1902 übernahm sein Sohn Sigmund Eberhardt (verheiratet mit Gretchen
geb. Fleischmann aus Marktbreit)
das Geschäft. In der NS-Zeit wurde die Firma "arisiert" und
weit unter ihrem tatsächlichen Wert im Mai 1938 an Franz Weiss verkauft.
Im Zuge des Restitutionsverfahrens nach 1945 war die Firma 1950 bis 1952
nochmals im Besitz von Sigmund Eberhardt (gestorben 1957 in Forest Hills,
USA).
Der Gründer der Enzianbrennerei "L. Eberhardt" ("Blaukranz-Enzian")
war der in Maßbach geborene Lazarus Eberhardt. Er ist 1849 in
Maßbach als achtes von insgesamt neun Kindern des Handelsmannes Alexander
Eberhardt und seiner Frau Marianne geb. Rosenstein geboren.
Lazarus Eberhardt war verheiratet mit Cäcilie geb. Klopfer aus Hürben.
Die beiden lebten in München, wo Lazarus 1879 die Enzianbrennerei
"L. Eberhardt" gründete, die später zur bedeutendsten
Enziandestillerie in Deutschland wurde. Nach dem Tod von Lazarus Eberhardt
1902 übernahm sein Sohn Sigmund Eberhardt (verheiratet mit Gretchen
geb. Fleischmann aus Marktbreit)
das Geschäft. In der NS-Zeit wurde die Firma "arisiert" und
weit unter ihrem tatsächlichen Wert im Mai 1938 an Franz Weiss verkauft.
Im Zuge des Restitutionsverfahrens nach 1945 war die Firma 1950 bis 1952
nochmals im Besitz von Sigmund Eberhardt (gestorben 1957 in Forest Hills,
USA).
Siehe Beitrag von Joseph Maran in der "Jüdischen Allgemeinen vom
15. Mai 2014:: "'Bayerns berühmte Marke'. Der erfolgreichste
Produzent des Enzianschnaps war Juden..."
Link
zum Artikel |
| |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge bzw. eine Betstube war spätestens seit der Zeit
um 1700 vorhanden. Zunächst war eine solche Betstube in einem Haus
eingerichtet, das dem Barthel Hunefeldt gehörte. Dann konnte ein Betsaal in
dem kleinen Schloss (Eisenachisches Leben) eingerichtet werden. Kurz vor 1716
wurde eine neue Synagoge erbaut. Aus diesem Jahr ist ein Dokument erhalten,
in dem über
nähere Umstände zum Bau des Gotteshauses berichtet wird: die Herren von Rosenbach
hätten das
Bauholz gegeben hatten, das Gebäude selbst wurde jedoch auf fürstlich
Sachsen-Eisenachischem Grundstück erbaut. 1747 brannte die Synagoge
ab. Trotz des Protestes des evangelischen Pfarrers wurde sie wieder
aufgebaut.
Um 1860 ist die Synagoge umfassend renoviert wurden. Dabei wurden offenbar die
traditionellen Gitter der Frauenempore entfernt, da 1865 der orthodoxe Rabbiner
Bamberger die Gemeinde dazu drängen wollte, die Gitter wieder
anzubringen:
Rabbiner Bamberger möchte die Empore der Synagoge wieder traditionell mit
Gittern versehen (1865)
Anmerkung: Abschnitt aus einem kritischen Artikel in der liberal
geprägten "Allgemeinen Zeitung des Judentums", der sich gegen
orthodox-konservative Bestrebungen richtet, mit denen lierale Reformen
rückgängig gemacht werden sollen.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. August 1865:
"...Mittlerweile haust Bamberger als Verweser im Rabbinatsbezirke wie
ein Pascha. Er stellt eine förmliche Hetzjagd auf alle Synagogen an, die
ihren Frauen eine freie Aussicht in die unteren Räume gestatten. Schon
musste die Gemeinde Unsleben dem durch gerichtliche Maßregeln
unterstützten Ansinnen Bambergers sich fügen und ihre schöne, neue
Synagoge durch Vergitterung der Frauengalerie verunstalten. Und wieder
sucht man die Gemeinde Maßbach, welche wahrlich nicht zu den sogenannten
'Neuen' gehört, jedoch gesunde und vernünftige Elemente in sich birgt,
zu nötigen, ihre kürzlich renovierte Synagoge mit denselben
Tugendwächtern zu versehen. Die stets mit der Hierarchie gepaarte
Orthodoxie liebt nun einmal das Oktroyieren". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. August 1865:
"...Mittlerweile haust Bamberger als Verweser im Rabbinatsbezirke wie
ein Pascha. Er stellt eine förmliche Hetzjagd auf alle Synagogen an, die
ihren Frauen eine freie Aussicht in die unteren Räume gestatten. Schon
musste die Gemeinde Unsleben dem durch gerichtliche Maßregeln
unterstützten Ansinnen Bambergers sich fügen und ihre schöne, neue
Synagoge durch Vergitterung der Frauengalerie verunstalten. Und wieder
sucht man die Gemeinde Maßbach, welche wahrlich nicht zu den sogenannten
'Neuen' gehört, jedoch gesunde und vernünftige Elemente in sich birgt,
zu nötigen, ihre kürzlich renovierte Synagoge mit denselben
Tugendwächtern zu versehen. Die stets mit der Hierarchie gepaarte
Orthodoxie liebt nun einmal das Oktroyieren". |
Eine neue Synagoge wurde 1899 eingeweiht. Bis
1938 wurden in ihr Gottesdienste gefeiert. Im Januar 1938 predigte letztmals
Bezirksrabbiner Dr. Menachem Ephraim in der Synagoge.
In der Pogromnacht im November 1938 wurde
die Inneneinrichtung der Synagoge zerstört. Auf Befehl der SA-Standarte Bad Kissingen versammelten
sich am frühen Morgen des 10. November 1938 sämtliche 60 bis 70 Mann der
örtlichen SA und wurden in Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe zerstörte in der
Synagoge Türen, Fenster und Mobiliar. Torarollen wurden zerrissen und zertrampelt.
Eine Anzahl von Ritualien wurde aus der Synagoge geholt und an einen unbekannten
Ort gebracht. Die Toraschrein-Vorhänge und die Silbergeräte, die noch aus den
Anfängen der Gemeinde stammten, wurden vernichtet. Anschließend zogen die
SA-Leute nach Poppenlauer.
Nach dem Pogrom ließ der Bürgermeister die jüdischen Einwohner für die
Reparatur der Synagogenfenster RM 800 bezahlen. Außerdem bot er ihnen an, die
Synagoge für RM 50 zu verkaufen. Sattlermeister Karl Geiling, in dessen Hof die
Synagoge stand, bemühte sich, das Gebäude zu erwerben, was sich jedoch sehr
schwierig gestaltete. Seitens der nur noch kleinen jüdischen Gemeinde gab es
für den Verkauf an ihn im Juli 1942 keine Einwände. Die letzten beiden
jüdischen Männer - Sigmund Max Eberhardt und David Frank -
"bestätigten" in einem Dokument von 1942 ihre Einwilligung zum
Verkauf des Gebäudes an Karl Geiling (siehe unten).
Da der Besitzwechsel an Karl Geiling 1948 noch immer nicht vollzogen war,
wurde er von Simon Eberhardt, der mit seiner Familie nach Argentinien geflohen
war, durch ein weiteres Schreiben, das den Gebäudeverkauf ermöglichen sollte,
unterstützt (siehe unten).
Zum Verkauf an Karl Geiling ist es letztendlich doch gekommen. Dieser hat am
Gebäude bauliche Veränderungen vorgenommen. Äußerlich wurden die Giebelfront
und die Fenster verändert, der kleine Vorbau an der Ostwand im Bereich des
Toraschreines wurde beseitigt. Im Inneren wurde auf der Höhe der ehemaligen
Frauenempore eine Zwischendecke eingezogen. Unterhalb der neuen Decke wurde die
Sattlerwerkstatt eingerichtet. Oberhalb blieb das Gebäude fast unverändert, hier
wurde es als Lagerraum genutzt. Das Gebäude blieb bis 2012 im Besitz der
Familie Geiling; in diesem Jahr erfolgte ein Besitzerwechsel.
In der ehemaligen Synagoge konnte Museumsleiter Klaus Bub eine Ausstellung
unter dem Titel "Maßbach unterm Davidstern" einrichten. Die
Ausstellung berichtet über das jüdische Leben im Ort. 2009 wurde auf
dem Dachboden der Synagoge eine Genisa entdeckt (Aufbewahrungsort für
nicht mehr gebrauchte religiöse Schriften und Gegenstände). 2011 wurde
die ehemalige Synagoge in das Städtebauliche Entwicklungskonzept des Marktes
Maßbach aufgenommen.
Seit 2016 gibt es Pläne, die ehemalige Synagoge für die Zukunft zu
erhalten. In einem ersten Schritt soll ein Konzept entwickelt werden, wie
die ehemalige Synagoge und das Anwesen genutzt werden können. Die politische
Gemeinde möchte das Gebäude übernehmen und mit zu beantragenden staatlichen
Fördermitteln umbauen. Ziel ist eine bauliche Rekonstruktion der ehemaligen
Synagoge. Zur eventuellen Einrichtung eines Museums sind
zahlreiche Dokumente sowie Ritualgegenstände als Leihgabe des Münnerstädter
Hennebergmuseums vorhanden. Im Dezember 2016 beantragte die Gemeinde die Aufnahme
der Maßnahme "Synagoge" bei der Regierung von Unterfranken ab 2017 in
das Förderprogramm "soziale Stadt". Für den Zeitraum 2018 bis 2020
sollen Fördergelder in Höhe von einer halben Million Euro für die ehemalige
Synagoge beantragt werden.
Auch das angrenzende Haus an der Poppenlaurer Straße, das an die Synagoge
grenzte beziehungsweise mit diesem zusammengebaut ist, soll erworben werden. Bis
1920 war dieses Gebäude in jüdischem Besitz und wurde dann von Sattlermeister
Karl Geiling erworben. Dieser richtete in dem Gebäude seine Werkstatt ein
(Schuhhaus Geiling). Er war es, der 1942 dann auch das Synagogengebäude erwarb
(siehe oben).
Zu den Plänen der Restaurierung der Synagoge
vgl. Artikel von Isolde Krapf in der "Main-Post" vom 12. Oktober 2016:
"Massbach. Synagoge wieder sichtbar machen".
(Link
zum Artikel, kostenpflichtig)
vgl. Artikel von Dieter Britz in der "Main-Post" vom 21. Dezember
2016: "Massbach. Hoffnung auf Fördergelder"
(Link
zum Artikel, kostenpflichtig)
 "Bestätigung" von 1942 zum Verkauf der Synagoge
"Bestätigung" von 1942 zum Verkauf der Synagoge
Beim Verkauf des Hauses von Samuel Eberhardt Kultusvorstand der Maßbacher jüdischen Gemeinde wurde Karl Geiling Sattlermeister schon im Jahre 1921 die Zusicherung gegeben, sobald die Synagoge in anderen Besitz übergehe, nur Karl Geiling Sattlermeister von Maßbach in Frage käme. Da Geiling stets der jüdischen Gemeinde in jeder Art u. Weise freundschaftlich entgegen kam u. die Juden von Maßbach teilweise ausgewandert, verstorben u. verzogen sind, dass nur noch 2 Mitglieder von der Kultusgemeinde zugegen sind, nämlich Vertrauensmann David Frank sowie Sigmund Eberhardt befürworten dieselben laut Unterschrift und Gemeindestempel, dass nur dieses Objekt beim Verkauf an Karl Geiling Sattlermeister in Maßbach übergehen soll. Maßbach, den 2. Juli 1942.
Sigmund Max Israel Eberhardt
Maßbach
David Isr Frank Vertrauensmann
Israelitische Kultusgemeinde Maßbach Unterfranken
Dieses Dokument vom 2. Juli 1942 - mit den beiden Unterschriften von
Sigmund Max Eberhardt und David Frank - ist das letzte Zeugnis der israelitischen Gemeinde in Maßbach. Schon am 14. Juli 1942 wurden die letzten 6 Maßbacher Bürger jüdischen Glaubens zur
"Wohnsitzverlegung" nach Würzburg gebracht und von dort deportiert. Nur Sigmund Max Eberhardt nicht. Er war am 26. Juli 1942 in Würzburg gestorben und wurde auch dort begraben.
(Dokument erhalten von Klaus Bub) |
| |
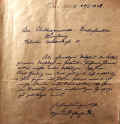 Aus
Argentinien schrieb Sigmund Eberhardt - ehemals wohnhaft in Maßbach Haus
Nr. 80 - an die Israelitische Kultusgemeinde in Würzburg im Blick auf den
Verkauf des Synagogengebäudes an seinen Freund Karl Geiling am 30. Mai 1948: Aus
Argentinien schrieb Sigmund Eberhardt - ehemals wohnhaft in Maßbach Haus
Nr. 80 - an die Israelitische Kultusgemeinde in Würzburg im Blick auf den
Verkauf des Synagogengebäudes an seinen Freund Karl Geiling am 30. Mai 1948:
"Chos Malal 30/5.1948
Isr. Kultusgemeinde Unterfranken Würzburg Valentin–Beckerstraße 11
Als ehemaliges Mitglied der Kultusgemeinde Maßbach meines Geburt– u früheren Heimatortes, möchte anbei bestätigen, dass Herr Karl Geiling von dort jederzeit sehr anständig u gut gegen uns Juden gesinnt war u ich möchte darum nur befürworten, dass ihm der Verkauf unserer einstmaligen Synagoge zu gebilligt wird.
Hochachtungsvoll Sigmund Eberhardt." |
Adresse/Standort der Synagoge: Poppenlauer Str. 4
Fotos/Pläne/Dokumente
(Fotos und Dokumente - wenn nicht anders angegeben - erhalten
von Klaus Bub, Maßbach)
Luftaufnahme
von Maßbach mit
Synagoge und jüdischer Schule (1936) |

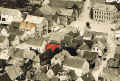 |
 |
| |
Auf der
Karte links (mit Ausschnittvergrößerung) ist zur Orientierung das Dach der
Synagoge
rot eingefärbt; das Dach des jüdischen Schulhauses, in dem sich
die Mikwe befand, ist
orange markiert. Rechts das Gebäude der jüdischen Schule nach 1945. |
| |
|
|
Lageplan
und Bauzeichnung
der Synagoge (1941) |
 |
 |
| |
Lageplan der
Synagoge (rot markiert)
zwischen Hauptstraße
und Wirthsgasse |
"Ansicht
Giebel Ost alt" - erkennbar ist
der kleine Vorbau nach Osten (im Inneren
hier der Toraschrein) |
| |
|
|
|
|
|
Foto von 1934
und
Rekonstruktionszeichnung
der Synagoge |

 |
 |
| |
Das Foto zeigt die
Kindergartenkinder von
1934; das Mädchen mit dem rot markierten
Kleid ist Inge Heidelberger (später: Lea
Neugebauer), das letzte jüdische Mädchen
in Maßbach |
Auf
Grund des Fotos links (eingearbeitet in
die Rekonstruktion oben) konnte von
Klaus Bub obige Rekonstruktionszeichnung
der Synagoge (mit dem Vorbau des
Toraschreines) erstellte werden. |
| |
|
|
Toraschreinvorgang
von 1739 |
 |
|
| |
Parochet - Vorhang
vor dem Toraschrein,
gestiftet 1739 für die Synagoge in Maßbach
(Quelle: Pinkas Hakehillot s. Lit. S. 508) |
|
| |
|
|
| Das
Synagogengebäude - gegenwärtige Ansichten |
|
 |
 |
 |
 |
Foto von Barbara
Eberhardt (2003)
(Quelle: www.synagogen.info) |
Foto von
Jürgen Hanke,
Kronach |
Foto
mit Ausschnittvergrößerung von Klaus Bub;
Hinweis: Das Backsteinhaus links wurde von
Leo Katzenbergers Schwester Metha und deren
Ehemann Bernhard Schwarzenberger erbaut.
Über dem Eingang steht noch heute das Bau-
und Hochzeitsjahr 1896. |
| |
|
| |
|
| |
|
|
Ausstellung
im
früheren Synagogengebäude |
 |
 |
| |
Seit 2009 ist
im Synagogengebäude - zumindest vorrübergehend - die jüdische Geschichte
des
Ortes wieder lebendig geworden. In einer Ausstellung "Maßbach unterm
Davidstern" wird an
die jüdische Gemeinde Maßbach erinnert. |
| |
Das
Foto oben in hoher Auflösung |
Das
Foto oben in hoher Auflösung |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Oktober 2012:
"Stolpersteine"-Verlegung in
Maßbach |
Artikel in der "Main-Post" vom 5.
Oktober 2012: "Massbach. Denkmal gegen das Vergessen. 13
Stolpersteine nun auch in Maßbach - Gunther Demnig vor Ort..."
Link
zum Artikel - auch eingestellt
als pdf-Datei |
| |
| November 2013:
Gedenkveranstaltung in der ehemaligen Synagoge in
Maßbach |
| Beitrag von Hubert Breitenbach und Klaus Hub:
"Maßbach - Der Retter aus Stadtlauringen. Gedenkstunde in
der ehemaligen Synagoge am 9. Nov. 2013 zum 75. Gedenktag der Pogromnacht
- Lag Neugebauer erzählt..." Bericht
als pdf-Datei eingestellt. |
| |
|
Juni 2016:
Über die ehemalige Synagoge in
Maßbach |
Artikel von Isolde Krapf in der "Main-Post"
vom 5. Juni 2016: "MASSBACH. Gitter für die Frauen-Empore
Die Geschichte der Maßbacher Synagoge ist lang. Spätestens seit der Zeit um
1700 soll ein solcher Betsaal in Maßbach vorhanden gewesen sein, haben die
Heimatforscher Reinhard Klopf und Klaus Bub herausgefunden. Zunächst soll es
eine solche Betstube im Haus eines gewissen Barthel Hunefeldt gegeben haben.
Später richtete man einen Betsaal im 'kleinen Schloss' ein. Kurz vor 1716
wurde dann eine neue Synagoge gebaut. In alten Dokumenten heißt es, dass die
Herren von Rosenbach das Bauholz gaben und dass das Gebäude auf fürstlich
sachsen-eisenach'schem Grundstück stand. 1747 brannte die Synagoge ab. Trotz
des Protestes des evangelischen Pfarrers wurde sie wieder aufgebaut. Um 1860
ist das Gebetshaus dann umfassend renoviert worden. Dabei wurden offenbar
die traditionellen Gitter der Frauenempore entfernt, denn es ist verbürgt,
dass im Jahr 1865 der orthodoxe Rabbiner Bamberger die Gemeinde dazu drängen
wollte, die Gitter wieder anzubringen.
Hierzu fanden die beiden Heimatforscher einen Artikel aus der 'Allgemeinen
Zeitung des Judentums', in dem es heißt: 'Mittlerweile haust Bamberger als
Verweser im Rabbinatsbezirke wie ein Pascha. Er stellt eine förmliche
Hetzjagd auf alle Synagogen an, die ihren Frauen eine freie Aussicht in die
unteren Räume gestatten. Schon musste die Gemeinde Unsleben dem durch
gerichtliche Maßregeln unterstützten Ansinnen Bambergers sich fügen und ihre
schöne, neue Synagoge durch Vergitterung der Frauengalerie verunstalten. Und
wieder sucht man die Gemeinde Maßbach, welche wahrlich nicht zu den
sogenannten 'Neuen' gehört, jedoch gesunde und vernünftige Elemente in sich
birgt, zu nötigen, ihre kürzlich renovierte Synagoge mit denselben
Tugendwächtern zu versehen. Die stets mit der Hierarchie gepaarte Orthodoxie
liebt nun einmal das Oktroyieren.' Eine neue Synagoge wurde 1899 eingeweiht.
Bis 1938 wurden in ihr Gottesdienste gefeiert. Im Januar 1938 predigte
letztmals Bezirksrabbiner Dr. Menachem Ephraim in der Synagoge. In der
Pogromnacht im November 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge von
SA-Leuten zerstört. Tora-Rollen wurden zerrissen und zertrampelt. Eine
Anzahl von rituellen Gegenständen wurde aus der Synagoge geholt und an einen
unbekannten Ort gebracht. Die Toraschrein-Vorhänge und die Silbergeräte, die
noch aus den Anfängen der Gemeinde stammten, wurden vernichtet. Anschließend
zogen die SA-Leute nach Poppenlauer
weiter."
Link zum Artikel |
| |
| Januar
2017: Über die Funde in
der ehemaligen Synagoge |
Artikel von Isolde Krapf in der "Main-Post"
vom 30. Januar 2017: "MASSBACH. Ritualien überregional bedeutsam
Dass im Ort eine Synagoge stand, wissen viele Maßbacher. Aber dass es das
Haus noch gibt, ist nicht jedem bekannt, vermutet Bürgermeister Matthias
Klement. Das könnte sich bald ändern, denn das frühere jüdische Gotteshaus
rückt immer mehr in den Blick der Öffentlichkeit. Die Kommune möchte das
Gebäude sanieren. Doch der Weg dorthin ist weit. Der Besuch zweier Experten
vom Landesamt für Denkmalpflege lässt jedoch hoffen. 'Wir sind dabei zu
erkunden, was möglich ist', sagt Klement über den einstigen Sakralbau, der
heute unscheinbar in zweiter Reihe zur Poppenlaurer Straße steht. Denn der
Grundriss des einstigen Massivbaus mit Fachwerkgiebeln ist nur an der
Ostseite nachvollziehbar, die übrigen Außenwände sind durch jüngere Anbauten
verstellt.
Bausubstanz näher untersuchen. Gebietsreferent Christian Schmidt und
Hans-Christof Haas, der Querschnittsreferent für Jüdisches Kulturgut vom
Landesamt für Denkmalpflege waren jedenfalls unlängst bei ihrem Besuch in
Maßbach begeistert und machten klar, dass man die Bausubstanz näher
untersuchen muss, sagt Klement. Denn wer weiß, vielleicht tauchen hinter den
modernen Anstrichen der Wände oder unter den Bodenbelägen historische Putze,
Gemälde oder Fassungen auf? An der Dachkonstruktion stellten die Fachleute
größere Schäden fest. Wichtig sei auch, die Statik des Hauses zu prüfen,
sagt der Bürgermeister. 'Wir müssen also zunächst eine Bestandsaufnahme
machen und die Ergebnisse ans Landesamt weitergeben. Parallel dazu sollten
wir mögliche Fördertöpfe anzapfen.' Die Fachleute des Landesamts hätten eine
Art Empfehlung abgegeben und Fördermittel für die Sanierung der Synagoge in
Aussicht gestellt, sagt Stadtplanerin Christiane Wichmann (Schweinfurt), die
die Kommune generell bei der Altortsanierung begleitet. Allerdings will die
Behörde dann auch ein Nutzungskonzept sehen, sagt sie. Doch bevor man solche
Pläne weiterverfolgt, müssen Voruntersuchungen getätigt werden, so Wichmann
weiter. Erst dann könne man genau planen und Kosten richtig einschätzen. Die
Architektin ist gerade dabei, diese Maßnahmen vorzubereiten. Dann gehen die
Vorschläge ans Landesamt.
Schließlich muss auch der Gemeinderat sein Plazet zu den Voruntersuchungen
geben, sagt Klement. Bis dahin hofft er, auch mit dem Erwerb des Gebäudes
schon weiter zu sein, denn die Kommune will das Haus von Privat kaufen. Bei
dem Gebäude handelt es sich um eine typische Landsynagoge aus der Mitte des
18. Jahrhunderts. Der Überlieferung nach soll es ein Neubau sein, der damals
anstelle des abgebrannten Vorgängerbaus errichtet wurde. In der Bayerischen
Denkmalliste ist das Maßbacher Anwesen beschrieben als 'eingeschossiger
massiver Halbwalmdachbau, entstanden um 1750, 1865 renoviert, 1938
beschädigt und 1941 umgebaut'.
Das Misrach-Fenster im Osten. Die Referenten Schmidt und Haas
stellten bei ihrer Begehung des Gebäudes fest, dass von der ursprünglichen
Synagoge noch die Umfassungsmauern, das Dachwerk mit einem Tonnengewölbe und
der Treppenaufgang zur Frauenempore erhalten sind. Interessant fanden sie
zudem, dass das Misrachfenster aus der Zeit um 1900 am Ostgiebel erhalten
ist – allerdings nicht als runde, sondern als hochrechteckige Öffnung.
Darunter war wohl in einem Erker, der heute nicht mehr besteht, der
Toraschrein untergebracht. Zur Erklärung: An der Ostwand in Richtung
Jerusalem (Misrach), in einem speziellen Schrein, wird die Tora-Rolle, ein
hebräischer Text der fünf Bücher Mose, aufbewahrt. Als überregional
bedeutend bewerteten Schmidt und Haas, dass wichtige Ritualien des jüdischen
Glaubens, wie die Torarolle, ein Schofarhorn und die Rimonim (Schmuck an der
Torarolle) in Maßbach erhalten geblieben sind. Zudem gibt es eine Geniza,
das ist ein Behältnis, in dem nicht mehr lesbare heilige Schriften
verschlossen aufbewahrt wurden."
Link zum Artikel |
| |
| September 2017:
Sonderausstellung in der ehemaligen Synagoge in
Maßbach |
 Im Rahmen der "Jüdischen Kulturtage Bad Kissingen 2017" ist die
Sonderausstellung "Zeugnisse jüdischen Lebens aus Maßbach und
Umgebung" aufgenommen. In dieser Ausstellung sind historische
Ritualgegenstände aus Maßbach und Umgebung zu sehen (u.a. Torarolle,
Besomimbüchse, Kidduschbecher, Chanukkaleuchter, Etrogdose, Schofarhorn
und Sederteller).
Im Rahmen der "Jüdischen Kulturtage Bad Kissingen 2017" ist die
Sonderausstellung "Zeugnisse jüdischen Lebens aus Maßbach und
Umgebung" aufgenommen. In dieser Ausstellung sind historische
Ritualgegenstände aus Maßbach und Umgebung zu sehen (u.a. Torarolle,
Besomimbüchse, Kidduschbecher, Chanukkaleuchter, Etrogdose, Schofarhorn
und Sederteller).
(Abbildung links aus dem Programm der Jüdischen Kulturtage Bad
Kissingen 2017) |
| |
|
September 2018:
Neue Beschilderung in Massbach
auch an Synagogengebäude und jüdischem Friedhof
|
Artikel von Isolde Krapf in der "Main-Post"
vom September 2018: "MAßBACH. Maßbach zeigt, was es zu bieten hat
„Selbst die Einheimischen bleiben stehen und lesen nach, was da zum Beispiel
über den Bahnhof oder das Schlossgut geschrieben steht“, hat Bürgermeister
Matthias Klement beobachtet. Denn seit kurzem gibt es in Maßbach nicht nur
rote Wegweiser, sondern auch acht große Stelen mit historischen Texten, an
denen man kaum vorbeikommt. Der neue Geschichtsweg wurde jetzt beim
Marktfest erstmals öffentlich präsentiert. Maßbach wurde 765 nach Christus
erstmals urkundlich erwähnt. Es ist ein Ort mit einer langen Geschichte,
sagt Klement. Warum also nicht einzelne Gebäude für den Besucher kenntlich
machen, indem man dort auf großen Tafeln die Historie gleich mitliefert. Im
Zuge des neuen Beschilderungskonzepts, für das der Markt aus dem
Städtebauförderungsprogramm Zuschüsse lockermachen konnte, war den Planern
diese Idee gekommen, so der Bürgermeister. Die acht Stelen in das Vorhaben
zu integrieren, sei kein Problem gewesen.
Interessante Details. Die Infos auf den Schautafeln sind interessant
aufgemacht und beinhalten auch Details, die vielleicht nicht mal Maßbacher
wissen. ...
Schön findet Klement, dass nun auch der Jüdische Friedhof durch die
neuen roten Hinweisschilder im Ort und die große Infotafel direkt am
Friedhof besser in den Blickpunkt rückt. Denn schließlich lassen sich über
einen Zeitraum von 500 Jahren Juden im Dorf nachweisen. Damals bestatteten
die Juden ihre Verstorbenen auf dem
Bezirksfriedhof in Kleinbardorf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde
dann der Friedhof in Maßbach angelegt.
Damals drang offenbar ein gewisser Metzgermeister Max Abraham, der schon
lange Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war, bei seinen Vorgesetzten
darauf, dass Maßbach einen eigenen Beisetzungsort bekäme. Er insistierte so
lange, bis man in den Jahren 1903/04 ein knapp 400 Quadratmeter großes Areal
einfriedete.
Auch auf die versteckt liegende frühere Synagoge weist jetzt an der
Ortsdurchfahrt eine große Tafel hin. Das erste jüdische Gebetshaus wurde in
Maßbach 1716 errichtet. 1747 und 1898 gab es auf die Synagoge
Brandanschläge.
Die letzte Predigt. Jedes Mal wurde das Haus wieder aufgebaut,
beziehungsweise saniert. Im Januar 1938 hielt der Bezirksrabbiner Menachem
Ephraim dort die letzte Predigt. In der Nacht zum 9. November 1938, einen
Tag vor der so genannten Kristallnacht, wurden auch in Maßbach die Wohnungen
und die Synagoge von den Nationalsozialisten zerstört. Erst 2008 wurde die
Synagoge wiederentdeckt. Museumsleiter Klaus Bub sichtete verschiedene
Gegenstände, die auf dem Dachboden des einstigen Geiling-Hauses zum
Vorschein kamen, und richtete eine Art Museum ein..."
Link zum Artikel |
| |
|
Februar 2019:
Beteiligung am "Denkort Aumühle"
https://denkort-deportationen.de/
|
Artikel von Isolde Krapf in der "Main-Post"
von 8. Februar 2019: "Bad Kissingen. Warum die Erinnerung wichtiger denn
je ist
Die Würzburger Initiative zum Gedenken an die 2069 deportierten Juden aus
Unterfranken hat in den vergangenen Jahren Kreise gezogen. Es fanden vor Ort
etliche Gedenkveranstaltungen statt. So machten sich zum Beispiel im Mai
2011 mehr als 3000 Menschen, darunter auch etliche aus dem Landkreis Bad
Kissingen, auf den "Weg der Erinnerung": Die Juden mussten nämlich damals,
streng bewacht von der Gestapo, von den Sammelplätzen aus- das war meist der
Platz'sche Garten am heutigen Friedrich-Ebert-Ring– zum Bahnhof Aumühle
laufen. Auch in den Ratsgremien der Kommunen im Landkreis Bad Kissingen
stößt der geplante DenkOrt Aumühle inzwischen auf allgemeines Interesse.
In Maßbach ist man dem Thema durch die noch bestehende Synagoge eng
verbunden, sagt beispielsweise Bürgermeister Matthias Klement. Im
Gemeinderat sei man sich daher "schnell einig" gewesen, bei der Drechslerei
Müller in Maßbach vier Holzkoffer in Auftrag zu geben. Gerade in der
heutigen Zeit, in der wieder, wie damals, judenfeindliche Äußerungen gemacht
werden, sei ein Mahnmal, wie der in Würzburg geplante DenkOrt, wichtig für
die Nachkommen... '"
Link zum Artikel . |
| |
|
Mai 2019:
Die ehemalige Synagoge wird von
der Gemeinde gekauft |
Artikel von Isolde Krapf in der "Main-Post"
vom 31. Mai 2019: "Maßbach. Kauf der Synagoge steht bevor.
Lange Zeit verhandelte die Marktgemeinde in Bezug auf den Erwerb des etwas
zurückgesetzten Hauses an der Poppenlaurer Straße hinter den Kulissen. Jetzt
scheinen die Pläne, den einstigen jüdischen Sakralbau wieder ins öffentliche
Bewusstsein zu rücken, aufzugehen. Die Kommune wird jetzt den gesamten
Gebäude-Komplex, in den die Synagoge eingebettet ist, kaufen und dort ein
Museum einrichten. 'Wir haben jetzt die einmalige Chance, aus der
bestehenden Substanz des Hauses ein Mahnmal für die Nachfahren zu machen',
sagt Bürgermeister Matthias Klement im Gespräch mit der Redaktion. Dies
werde immer wichtiger in einer Zeit, in der rechtsextreme Parteien wieder
versuchten, in der Politik Fuß zu fassen. Was unter dem Banner des
Nationalsozialismus mit den Juden geschah, dürfe sich nicht mehr
wiederholen, unterstreicht Klement die Bedeutung des Maßbacher Vorhabens.
Jahrzehnte des Schweigens. Dass die Synagoge erst 2009, rund 70 Jahre
nach dem Juden-Pogrom, wieder ins öffentliche Bewusstsein rückte, mag auch
damit zu tun haben, dass nach Kriegsende, über Generationen hinweg, die
Erinnerungen an die Juden und ihre gesellschaftliche Verwurzelung verdrängt
worden waren. Denn schließlich hatten sich einst an den Pogromen auch
Ortsansässige beteiligt. In Maßbach sollen, nach Quellenangaben, damals 60
SA-Männer aus dem Ort, gemeinsam mit etlichen Ortsbewohnern, die neun
jüdischen Wohnungen gestürmt haben. Heute sind viele Zeitzeugen in Maßbach
nicht mehr am Leben. Eine andere Generation von Bürgern ist nachgewachsen,
darunter etliche, die das Gedenken an die einstigen jüdischen Mitbürger neu
beleben möchten. Selbst Bürgermeister Klement rätselte, warum das jüdische
Leben im Ort so lange kein Thema war. Dass im Anschlussgebäude des einstigen
Schuhhauses Geiling einst Juden ihre Gottesdienste abhielten, mögen viele
ältere Maßbacher noch gewusst haben, sagt Bürgermeister Klement, der selbst
Geburtsjahrgang 1968 ist. Den Jüngeren sei das Haus aber kein Begriff mehr
gewesen. 'Als Kind und Jugendlicher habe ich zum Beispiel davon nichts
gewusst.'
Die Geniza auf dem Dachboden. Als Museumsleiter Klaus Bub 2004 auf
dem Dachboden der Synagoge eine Geniza (liturgische jüdische Schriften)
fand, kam der Stein zur Aufarbeitung eines Teils der Maßbacher Geschichte
schließlich ins Rollen, sagt Klement. Denn Bub fielen auch Briefe und Fotos
von Maßbacher Juden in die Hände - und er machte sich an die Recherche. Auch
vor dieser Zeit hatte man freilich das Gedenken an die einstigen Mitbürger
hochgehalten. So hatte zum Beispiel der verstorbene Bürgermeister Erhard
Klement am christlichen Friedhof einen Gedenkstein setzen lassen und unter
seinem Nachfolger Johannes Wegner wurden die ersten Stolpersteine verlegt.
Zu Matthias Klements kommunalem Vermächtnis wird es später zählen, dass
unter seiner Ägide die alte Synagoge wieder sichtbar gemacht wurde. 1920
hatte ein gewisser Karl Geiling, von Beruf Sattlermeister, das Haus neben
der Synagoge gekauft und sich dort eine Werkstatt eingerichtet. Er, der als
Freund der Juden galt, musste im Jahr 1938 die Zerstörung der Synagoge mit
ansehen. 1942 gelang es ihm, das Gebetshaus zu erwerben. Sein Sohn Hermann
Geiling eröffnete später in dem Laden an der Hauptstraße ein Schuhgeschäft.
Bis vor 20 Jahren hatten die verschachtelt angeordneten Gebäudeteile noch
Hermann Geilings Tochter Christa Sauer gehört.
Der Interessent aus Passau. Dann wurde es an einen Privatmann im
Schweinfurter Raum verkauft, der Anfang 2017 Insolvenz anmelden musste. Als
sein Maßbacher Besitz unter den Hammer kommen sollte, beschlossen die
Maßbacher, mitzubieten. Doch mit ihrem Gebot von 60 000 Euro kamen sie bei
zwei Terminen nicht zum Zug, obwohl es kaum andere Interessenten gab, sagt
Klement. Als für die Kommune schon alles aussichtslos erschien, tauchte
Mitte 2017 plötzlich ein Interessent aus Passau auf, der den Maßbacher
Gebäudekomplex kaufen und wieder herrichten wollte. Das Erfreuliche für die
Kommune: Er nahm auch mit der Gemeinde Kontakt auf. Von der Synagoge wusste
er schon aus den Versteigerungsunterlagen, sagt Klement. Als er von den
Absichten der Maßbacher erfuhr, habe er zugestimmt, zunächst das ganze
Ensemble von der Bank des Schuldners zu erwerben und später die Synagoge und
den Anbau wieder an die Kommune zu verkaufen, während er das frühere
Geschäft mit der Wohnung ursprünglich selbst herrichten wollte, erzählt der
Bürgermeister.
Kaufpreis wird gefördert. Dass die Verhandlungen für die Maßbacher so
erfolgreich ausgingen, hat, nach Klements Eindruck, sicher auch damit zu
tun, dass der Investor selbst Jude ist. 'Er hat einfach den Bezug zu den
historischen Fakten und zu den Funden jüdischen Glaubens in Maßbach.' Bis
der Interessent das Gebäude erworben hatte, ging ein Jahr ins Land. Im März
2019 sei der Mann dann schließlich mit seinem Sohn nach Maßbach gekommen und
habe sich vor Ort alles angeschaut. Als er mehr von den Plänen der Kommune
hörte, habe er später schließlich zugestimmt, das gesamte Ensemble an die
Gemeinde zu verkaufen. 'Der Verkauf wird nun gerade vorbereitet', sagt
Klement. 80 000 Euro muss die Kommune zunächst aufbringen. Zum Vergleich:
Das ursprüngliche Gebot der ersten Zwangsversteigerung hatte bei 127 000
Euro gelegen. Weil die Sanierung der denkmalgeschützten Synagoge 2011 ins
städtebauliche Entwicklungskonzept der Kommune aufgenommen worden war,
können die Maßbacher nun schon beim Kaufpreis für das Ensemble mit 60 bis 80
Prozent Förderung rechnen, hat Klement in Erfahrung gebracht. Das würde
bedeuten, dass die Kommune im Optimalfall lediglich 16 000 Euro aus der
eigenen Schatulle stemmen müsste."
Link zum Artikel |
| |
|
August 2019:
Die ehemalige Synagoge wird Museum
|
Artikel von Dieter Britz in der "Main-Post"
vom 2. August 2019: "Maßbach: Synagoge wird Museum
Die Gemeinde hat den Etat für 2019 verabschiedet. Größter Brocken ist die
Hangsicherung in der Parksiedelung. Für den Kauf der Synagoge sind heuer
85.000 Euro eingeplant.
Die Marktgemeinde hat nun einen Haushalt für das Jahr 2019. Der
Marktgemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung das Zahlenwerk,
das 9,44 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt (Einnahmen und Ausgaben der
laufenden Verwaltung) und 4,05 Millionen Euro im Vermögenshaushalt (vor
allem Investitionen) umfasst. ...
Die geplante Umgestaltung der Synagoge, in der schon jetzt ein Raum als
provisorisches Museum eingerichtet ist, findet man auch im Haushalt: Dieses
Jahr sind 85.000 Euro für den Kauf des Gebäudes eingeplant, nächstes und
übernächstes Jahr je 125.000 Euro für den Um-, Aus- und Neubau im nächsten
Jahr außerdem 30 000 Euro Planungskosten und Kosten für ein
Nutzungskonzept..."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens
in Bayern. 1988 S. 88. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 507-509. |
 | Michael Trüger: Der jüdische Friedhof in
Maßbach.
In: Der Landesverband der Israelit. Kultusgemeinden in Bayern. 16. Jahrgang
Nr. 85 vom April 2001 S. 16. |
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die jüdischen Gemeinden in
Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979 S. 360-362. |
 | Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /
Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.
Schweinfurt 1992. |
 | dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von
Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt
1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the
abministrative district of Bad Kissingen focusing on the period
1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den
Autoren/obtainable from: E-Mail.
Info-Blatt
zu dieser Publikation (pdf-Datei). |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 209-210.
|
 |  Christiane
Kohl: Der Jude und das Mädchen. Eine verbotene Freundschaft in
Nazideutschland. Goldmann Verlag 2002. 382 S. Christiane
Kohl: Der Jude und das Mädchen. Eine verbotene Freundschaft in
Nazideutschland. Goldmann Verlag 2002. 382 S.
Zum Inhalt: 'Rassenschande' lautete die Anklage im Schauprozess gegen den Juden Leo Katzenberger und die junge Arierin Irene Scheffler. Christiane Kohl zeigt in ihrer fesselnden Dokumentation, wie eine fatale Mischung aus Kleinbürgermief, Neid und sexuellen Phantasien der Nachbarn zu Denunziation und Justizmord führten. Ein beklemmender Einblick in die Lebens- und Gedankenwelt ganz gewöhnlicher Deutscher im
'Dritten Reich'! |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Massbach Lower
Franconia. The community was most likely founded in the early 18th century,
reaching a peak population of 180 in 1837 (total 1,172). In 1830-54, 23 young
bachelors emigrated overseas. A synagogue was constructed in 1899 and a cemetery
consecrated in 1904. In 1933, the Jewish population of 34 suffered from
anti-Jewish agitation and the economic boycott, though Jewish cattle traders
were still active in 1937. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the
synagogue and Jewish homes were vandalized. Forteen Jews emigrated in 1933-40;
another seven moved to other German cities and eight were deported to Izbica in
the Lublin district (Poland) and the Theresienstadt ghetto in 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|