|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
zur Übersicht
"Synagogen im Schwalm-Eder-Kreis"
Jesberg mit
Densberg (Schwalm-Eder-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Jesberg
bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/39. Ihre Entstehung geht in die Zeit
des 17. Jahrhunderts zurück. 1664 gab es jüdische Familien am Ort, 1744 waren
es fünf, 1776 sieben Familien.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1835 53 jüdische Einwohner, 1861 55 (4,9 % von insgesamt 1.105
Einwohnern), 1871 77 (8,0 % von 960), 1885 85 (10,1 % von 837), 1895 73 (8,8 %
von 834; etwa 20 Familien), 1905 89 (10,8 % von 827). Zur Gemeinde Jesberg gehörten
auch die in Densberg lebenden jüdischen
Personen: 1835 5 jüdische Einwohner, 1861 34, 1905 19, 1924 2. Die jüdischen
Einwohner betrieben Landwirtschaft, Vieh- und Pferdehandel sowie
Manufakturwarenhandel; dazu gab es Mitte des 19. Jahrhunderts auch einen jüdischen
Sattler und einen Metzger, in Densberg einen Schuhmacher.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine israelitische
Elementarschule (von 1838 bis 1922, danach Religionsschule), ein rituelles Bad
und ein Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt
(Elementarlehrer beziehungsweise Religionslehrer), der zugleich als Vorbeter und
Schochet tätig war. Die israelitische Elementarschule wurde 1868 von 29 Kindern
besucht, 1871 von 23 und 1874 von 10 Schülern; zwischen 1890 und 1900 gab es
noch zwischen 20 und 30 Schüler, danach ging die Zahl langsam zurück. An
Lehrern sind bekannt: I. Appel (vor 1851 bis ?; gest. 1867; war Vater des 1851
in Jesberg geborenen Rabbiner Dr. Meyer Appel), Isaak Emmerich (vor 1862, danach
in Rhina),
Lehmann Ballin (um 1868; Quelle
für 1865), Naphtali Sommer (um 1877), Salomon David (in den
1880er-/1890er-Jahren, wechselte 1899 nach Hofgeismar),
Jakob Höxter (1899 bis 1924),
Dagobert Löwenstein (bis 1925). Die Gemeinde gehörte zunächst zum
Kreisrabbinat in Gudensberg,
später mit den im damaligen Kreis Fritzlar bestehenden jüdischen Gemeinden zum
Rabbinatsbezirk Niederhessen mit Sitz in Kassel.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Max Katzenstein
(geb. 25.5.1893 in Jesberg, gef. 3.6.1915). Außerdem ist gefallen: Israel Stern
(geb. 24.6.1886 in Jesberg, vor 1914 in Kirchhain wohnhaft, gef. 16.6.1915).
Um 1924, als noch 77 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (0,62 %
von insgesamt 800 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Julius
Goldschmidt und Markus Katz. Als Religionslehrer, Kantor und Schochet wirkt noch
Jakob Höxter. Er hatte damals noch sieben Kindern den Religionsunterricht zu
erteilen. An jüdischen Vereinen gab es eine Frauenchewra
(beziehungsweise Frauen-Chewroth; 1924/32 unter Leitung von Nettchen
Schloß; Arbeitsgebiet: Wohltätigkeit) sowie eine Männerchewra
(beziehungsweise Männer-Chewroth, 1924 unter Leitung von Meier Katz). 1932
war Gemeindevorsteher Wolf Stein. Im Schuljahr 1931/32 besuchten noch sechs
Kinder den Religionsunterricht.
1933 lebten noch 58 jüdische Personen in Jesberg (5,3 % von
insgesamt 1.096 Einwohnern). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts
(bereits am 11. März 1933 hatten SA-Leute mit einer entsprechenden Aktion zum
Boykott der jüdischen Geschäfte aufgerufen), der zunehmenden Repressalien und
der Entrechtung (vgl. unten "Judenordnung" von 1935) ging ihre Zahl in
der Folgezeit durch Aus- und Abwanderung zurück. Zwischen 1933 und 1939 sind
insgesamt 27 Personen ausgewandert (20 in die USA, 7 nach Palästina [zwei
Familien Katzenstein]); zwei Familien verzogen 1938 nach Frankfurt. In den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert.
Von den in Jesberg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bella David (1894),
Else David (1896), Louis Frensdorff (1894), Rebekka Frensdorff geb. Katz (1864),
Rosa Ganß (1905), Sally Ganß (1893), Siegmund Gauß (1887), Bertha Goldwein
geb. Katz (1889), Siegfried Salomon Hirschberg (1879), Bertha Katz (1902),
Gustav Katz (1898), Hermann Katz (1891), Moses Katz (1873), August Katzenstein
(1876), Sally Katzenstein (1890, siehe unten), Jettchen (Settchen) Levi
geb. Katz (1862), Frieda Neuhaus geb. Gauß (1904), Rahel Potzernheim geb. Ganß
(1882. "Stolperstein" in Dessau,
Link), Klara Schirmer geb. Hirschberg (1881), Jettchen Speier geb. Katz
(1870), Edit Jeitel Stern geb. Löwenstein (1927), Frieda Stern geb. Löwenstein
(1896), Rosi Stern (1932), Sally Stern (1895), Rosa Weinthal geb. Speier
(1893).
Von den in Densberg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Aron Gans (1887),
Lisette (Jettchen) Schloss geb. Gans (1856), Rickchen Schwab geb. Stern (1883),
Abraham Stern (1877), Sally Stern (1895).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1878
Anmerkung: Von einer gewissen liberalen Prägung der Gemeinde
zeugt, dass noch 1878 die Lehrerstelle sowohl in der konservativ-orthodoxen
Zeitschrift "Der Israelit" wie auch in der liberalen "Allgemeinen
Zeitung des Judentums" ausgeschrieben wurde.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Februar 1878: "Die
israelitische Gemeinde Jesberg (Hessen) sucht zum 1. April dieses Jahres
einen tüchtigen, seminaristisch gebildeten Lehrer und Vorsänger. Gehalt
pro anno 750 Mark, für Feuerungsentschädigung 90 Mark nebst freier
Wohnung, sowie Aussichten auf nicht unbedeutende Nebenverdienste. Bewerber
wollen gefälligst ihre Zeugnisse sofort dem Unterzeichneten
einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Februar 1878: "Die
israelitische Gemeinde Jesberg (Hessen) sucht zum 1. April dieses Jahres
einen tüchtigen, seminaristisch gebildeten Lehrer und Vorsänger. Gehalt
pro anno 750 Mark, für Feuerungsentschädigung 90 Mark nebst freier
Wohnung, sowie Aussichten auf nicht unbedeutende Nebenverdienste. Bewerber
wollen gefälligst ihre Zeugnisse sofort dem Unterzeichneten
einsenden.
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde: Feist Katz." |
| |
 Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. März 1878: "Die israelitische Gemeinde Jesberg (Hessen) sucht per 1. April dieses
Jahres einen tüchtigen, seminaristisch gebildeten Lehrer und Vorsänger. Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. März 1878: "Die israelitische Gemeinde Jesberg (Hessen) sucht per 1. April dieses
Jahres einen tüchtigen, seminaristisch gebildeten Lehrer und Vorsänger.
Gehalt pro anno Fixum Mark 750. Für Feuerungsentschädigung Mark 90 nebst
freier Wohnung, sowie Aussicht auf nicht unbedeutende
Nebenverdienste.
Bewerber wollen gefälligst ihre Zeugnisse sofort dem Unterzeichneten
einsenden.
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde. Feist Katz." |
Zum Tod des aus Röhrenfurth stammenden und zeitweise
in Jesberg tätigen Lehrers Salomon David (gest. 1930 in Kassel, bis 1899 Lehrer
in Jesberg)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. Mai 1930: "Lehrer S. David. Am
Dienst dieser Woche verschied hier (sc. in Kassel) der pensionierte Lehrer
Salomon David nach längerem, schweren Leiden im 71. Lebensjahr. Geboren
in Röhrenfurth, erhielt er seine
Ausbildung in Malsfeld bei dem
frommen und gelehrten Privatmann Bensew, dessen Vorbild ihn stets leitete.
Nach Absolvierung des hiesigen Lehrerseminars war der Verstorbene in Jesberg,
Hofgeismar und Ziegenhain
tätig. Seine in sich geschlossene ruhige Natur und seine streng
religiöse Lebensführung verschafften ihm Anerkennung bei seinen Mitbürgern
und Behörden. Seinen Sarg umstanden viele Lehrer und Freunde. Still wie
er gelebt, wurde er zu Grabe geleitet. Secher zadik livrocho - das
Gedenken an den Gerechten ist zum Segen."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. Mai 1930: "Lehrer S. David. Am
Dienst dieser Woche verschied hier (sc. in Kassel) der pensionierte Lehrer
Salomon David nach längerem, schweren Leiden im 71. Lebensjahr. Geboren
in Röhrenfurth, erhielt er seine
Ausbildung in Malsfeld bei dem
frommen und gelehrten Privatmann Bensew, dessen Vorbild ihn stets leitete.
Nach Absolvierung des hiesigen Lehrerseminars war der Verstorbene in Jesberg,
Hofgeismar und Ziegenhain
tätig. Seine in sich geschlossene ruhige Natur und seine streng
religiöse Lebensführung verschafften ihm Anerkennung bei seinen Mitbürgern
und Behörden. Seinen Sarg umstanden viele Lehrer und Freunde. Still wie
er gelebt, wurde er zu Grabe geleitet. Secher zadik livrocho - das
Gedenken an den Gerechten ist zum Segen." |
Beiträge von Jakob Höxter für die Zeitschrift
"Der Israelit"
 |

|
Anmerkung:
Jakob Höxter ist am 13. Februar 1873 in Zimmersrode
geboren. 1899 wurde er Lehrer der jüdischen Gemeinde in Jesberg. Hier
unterrichtete er zuerst nur die jüdischen Kinder in der israelitischen
Elementarschule. Im Ersten Weltkrieg unterrichtete er die christlichen und
jüdischen Kinder in der Volksschule Jesberg gemeinsam. Nach seiner
Pensionierung als Volksschullehrer in Jesberg übernahm Jakob Höxter 1926
die Aufgabe als Vorbeter, Lehrer und Schächter in Heldenbergen
(kurzzeitig vermutlich noch in Lich).
1933/34 war er in Büdesheim bei seiner Tochter Gertie Strauß. 1934
verzog er nach Frankfurt, 1939 emigrierte er nach Brasilien, von dort 1943
nach Argentinien zur Tochter seiner Familie. Er starb 1950 in Buenos
Aires.
Das Foto links wurde 1949 in Argentinien aufgenommen und zeigt ihn mit
einem Enkelkind (Quelle des Fotos: siehe Seite zu Heldenbergen). |
 Überlegungen von Lehrer Höxter zur "Beschneidung"
(= miloh) (1903) -
Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. November 1903: "Eine
pädagogische Plauderei. Von Lehrer Höxter – Jesberg. Überlegungen von Lehrer Höxter zur "Beschneidung"
(= miloh) (1903) -
Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. November 1903: "Eine
pädagogische Plauderei. Von Lehrer Höxter – Jesberg.
Eine in diesen Tagen stattgefundene Brith Miloh gab mir Veranlassung,
einige Gedanken zum Ausdrucke zu bringen, die, da ich sie jetzt dem
Papiere anvertraue, sich zu einer pädagogischen Plauderei vereinigen
lassen.
Ein großer Dichter hat die denkwürdigen Worte ausgesprochen: ‚Das größte
Erziehungsprinzip trifft man beim Volke Israel an’, und in der Tat, fast
jedes Blatt der Geschichte unseres Volkes enthält eine Fülle pädagogischer
Grundwahrheiten, zeigt uns, wie Gott das Volk leitet, führt und nach
seinem Willen erzieht, um es würdig zu machen, seine Mission auf Erden zu
erfüllen. Auch der heutige Akt, die Miloh, die in diesem Hause
vorgenommen worden ist, ist ein wichtiges Kapitel in der göttlichen Pädagogik.
Der kleine Weltenbürger hat das Licht der Welt erblickt, ein neues
Zentrum ist entstanden, um das sich das ganze häusliche Leben, die
elterliche Liebe und Fürsorge dreht. Es sind nun sieben Tage vergangen,
und das zarte Kindlein soll aufgenommen werden in den Kiddusch Brith, in
den heiligen Bund, soll eintreten als Glied in eine Gemeinde, mit der Gott
sich verbunden hat, aber da muss eine schmerzhafte Operation an ihm
vorgenommen werden, und erst diese soll es befähigen, Mitglied eines
Gottesvolkes zu werden. Da haben wir einen Moment, der uns herrliche
Lehren gibt: ‚Schon von dem ersten kurzen Dasein an lerne, o Mensch,
Schmerzen ertragen, die dich fähig machen sollen, dein ganzes Dasein, das
nur aus Schmerzen zusammengesetzt ist, ertragen zu können. So nur kannst
du dich hindurch winden durch die Dornen und Disteln, die an deinem
Lebenswege stehen.’ Wir beten: ‚Unser Vater, unser Könige, wende ab:
Pest und Schwert, Hunger und Gefangenschaft und Verderben von den Kindern
deines Bundes.’ Hier haben wir ein ganzes Heer von Feinden, die dem
Menschen auflauern. Wer würde vor ihnen bestehen können, der nicht nach
dem Grundsatze erzogen wäre: Lerne Schmerzen ertragen! Während die
gewaltigen Diasporaschmerzen, die unser Volk zu erdulden hat, wohl
auszuhalten, wenn die Träger nicht schon von vornherein in dem Grundsatz
erzogen worden wären: Lerne Schmerzen ertragen schon vom kurzen Dasein
deines Wesens an! Also die Kinder seines Bundes, des mit Abraham
geschlossenen Bundes ‚der Miloh’ lässt Gott von solchen Feinden
umgeben sein. Beachte das wunderbare Erziehungswerk: Gott erzieht sich
erst seine Kinder, indem er sie kämpfen lässt mit solchen gewaltigen
Feinden. Nur aus Liebe trifft sie alles dieses. Nur dadurch werden sie
erst wert, mit der Gottheit in Verbindung zu treten, wenn in den
Feuergluten der Prüfungen und Heimsuchungen die Schlacken von dem
besseren Teile geschieden worden sind. Es ist bezeichnend, dass wir am
Neujahrstage den Abschnitt von der Miloh lesen, um gerade dem Menschen
beim Übertritt ins kommende Jahr zuzurufen. Fürchte dich nicht vor den
Schmerzen der Welt, Gott in seiner Liebe zu dir, hat sie gerade für dich
herausgesucht durch sie wirst du erst der wahre Träger des
Gottesgedankens.
Möge der Akt der Miloh, als ein herrliches Erziehungswerk Gottes, den
Eltern die beherzigenswerte Lehre geben: Wenn ihr euere Kinder zu guten,
braven und ordentlichen Menschen erziehen wollt, so dürfte auch ihr ihnen
keine Schmerzen und Tränen ersparen, manche Eltern begehen hierin die größten
Fehler. Gewöhnet euere Kinder an recht, strenge Erziehung, sie werden es
euch Dank wissen, wenn sie daran gewöhnt worden sind, stille zu halten
bei den unsäglichen Schmerzen und Tränen, die das Leben beschert, sie
werden erfüllen lernen, die Aufgabe, die Gott dem Abraham gestellt: 'Wandle vor mir und werde vollkommen.'" |
| |
| Von den nachfolgenden Artikeln wird
jeweils nur der Anfang zitiert. |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. Mai 1903:
"Die körperliche und geistige Freiheit. Von J. Höxter -
Jesberg. Zwischen dem Pesach. und Schowuothfeste ziehen sich 'die Tage
des Omer' als wichtige Verbindungskette hin, gleichsam beide
kulturhistorische Momente in der Geschichte unseres Volkes miteinander
verknüpfend. Ein Pesach- ohne Schowuothfest wäre in der Geschichte
Israels ebenso wenig denkbar, wie in unserem jetzigen täglichen
Leben...". Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. Mai 1903:
"Die körperliche und geistige Freiheit. Von J. Höxter -
Jesberg. Zwischen dem Pesach. und Schowuothfeste ziehen sich 'die Tage
des Omer' als wichtige Verbindungskette hin, gleichsam beide
kulturhistorische Momente in der Geschichte unseres Volkes miteinander
verknüpfend. Ein Pesach- ohne Schowuothfest wäre in der Geschichte
Israels ebenso wenig denkbar, wie in unserem jetzigen täglichen
Leben...". |
 |
| |
 Gedicht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1904: "Zur
Erinnerung an meinen Barmizwotag. Von Lehrer Höxter -
Jesberg. Gedicht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1904: "Zur
Erinnerung an meinen Barmizwotag. Von Lehrer Höxter -
Jesberg.
Rückwärts schweife der umflorte Blick,
Bringe längst Entschwundenes zurück;
Holde Jugendträume sollt vorüberrauschen,
Euerem Märchenzauber will ich still lauschen:..." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1904: "Betrachtungen
zum Sabbbat Sochaur. Von Lehrer Höxter – Jesberg. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1904: "Betrachtungen
zum Sabbbat Sochaur. Von Lehrer Höxter – Jesberg.
Der Sabbat vor dem lieben Purimfeste wird Sabbat Sochaur, 'Erinnerungssabbat', genannt, der aus der Tora verlesene
Schriftabschnitt gibt ihm seinen Namen. Wenn nun jene von Amalek kündenden
Schriftverse heute unser Ohr berühren, wenn gleichsam, das ganze
Auftreten dieses unseren Vorfahren so gefährlichen Feindes deutlich vor
unserem geistigen Auge vorüberzieht und uns bewusst wird, was Israel von
ihm zu erdulden hatte, wenn endlich das kurz bevorstehende Purimfest uns
daran erinnern soll, wozu es ursprünglich der Sohn Hamdatas bestimmt
hatte, wenn uns gesagt wird, warum der sonst so barmherzige und gütige
Gott unsere Vorfahren so schwer heimgesucht hat, so müssen wir bei
solchen Betrachtungen dem Gedanken in unserer Brust Raum geben: Wir selbst
verschulden es, wenn uns solche Dinge treffen, wenn der Feind zur
Zuchtrute in der Hand des erzürnten Gottes wird, wir aber können das
Andenken Amaleks auslöschen, dann haben wir Ruhe vor ihm…" |
| |
 Gedicht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1904: "Leil
Schimurim. (= erste Nacht des Pessachfestes) Gedicht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1904: "Leil
Schimurim. (= erste Nacht des Pessachfestes)
Hast du schon darüber nachgedacht,
Warum man gerade in der Nacht
Den Auszug aus Ägyptenland
In den Familien macht bekannt?..." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Mai 1904: Gedicht zum Omer-Zählen (Wikipedia-Artikel):
"Zähle. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Mai 1904: Gedicht zum Omer-Zählen (Wikipedia-Artikel):
"Zähle.
Sieben volle Wochen sollst du zählen, Von da ab dir die Stunde
wählen,
Wo der Sichel scharfe Schneide Mäht das stehende Getreide.
Zähle diese Wochen, ihre Tage, Nimm alsdann von deinem Feldertrage,
Gott ein Speiseopfer darzubringen, Der segnet deiner 'Händ' Gelingen.
---
Mensch, du gleichst dem stehenden Getreide, Stets verfallen scharfer
Todesschneide:
Dein Beginnen, Werden und Vergehen, Sieben Jahreszehnt' nur dein
Besteh'n.-
Drum auf deinem Lebenspfade, Folg' des Schöpfers weisem Rate:
Zähle, messe, wäge, wiege Deine Zeit, das führt zum
Siege.
Bei des Todes raschem Mähen, Deiner Tugenden Trophäen,
Die du gesammelt, darfst sie bringen, Als Priester deinem Gotte
schwingen. J. Höxter - Jesberg." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1925: "Zum Feste der
Thora. Von Jacob Höxter in Jesberg. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1925: "Zum Feste der
Thora. Von Jacob Höxter in Jesberg.
Vor mir liegt ein Blatt, in welchem zur Werbearbeit für den Keren Hathora
aufgefordert wird. Es ist deshalb wohl nötig, etwas über den Keren
Hathora selbst zu sagen und zwar im Interesse der Nichteingeweihten, deren
es wohl eine ganze Menge und zwar unter der ländlichen Bevölkerung geben
dürfte. Da muss zunächst an jene große Versammlung erinnert werden, die
im Jahre 1923 in den Mauern Wiens tagte, wo die Orthodoxie der gesamten
Welt zusammen kam unter dem Banner unserer heiligen Tauroh (Tora), die von
Männern getragen wird, die ihr den Weg zu bahnen suchen in den
mannigfachen verschlungenen Gängen der Diaspora, die einen festen schützenden
Damm errichten wollen gegenüber Abfall…" |
Anzeige der Geburt eines Sohnes von Lehrer Höxter und Frau (1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1904:
"Die glückliche Geburt eines kräftigen
Jungen
zeigen hoch erfreut an
Lehrer Höxter & Frau, Jesberg." |
Kindergedichte von Lehrer Jakob Höxter (1923)
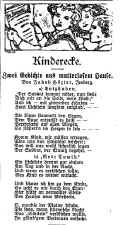 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1923: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1923:
Zum
Lesen bitte Textabbildung anklicken |
Über das Engagement des Lehrers Jakob Höxter im Blick
auf die Erhaltung des jüdischen Friedhofes (Borken-)Haarhausen siehe
zu diesem Friedhof
Lehrer Dagobert Löwenstein verlässt Jesberg und geht nach
Melsungen (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1925: "Melsungen,
3. März (1925). Lehrer Dillhof, der nach seiner Pensionierung als
Religionslehrer hier verblieben war, hat der Gemeinde das Amt gekündigt.
Die Gemeinde wählte nun Löwenstein aus Jeßberg, bisher im besetzten
Gebiet, als Lehrer und Vorsänger." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1925: "Melsungen,
3. März (1925). Lehrer Dillhof, der nach seiner Pensionierung als
Religionslehrer hier verblieben war, hat der Gemeinde das Amt gekündigt.
Die Gemeinde wählte nun Löwenstein aus Jeßberg, bisher im besetzten
Gebiet, als Lehrer und Vorsänger." |
Neubesetzung der Lehrerstelle in Lich mit dem
bisherigen Lehrer Jakob Höxter in Jesberg (1925)
 Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 16. Oktober 1925: "Lich
(Oberhessen). (Tod eines Gemeindevorstehers). Der zweite Vorsteher
unserer Gemeinde, Kaufmann Chambré, ist nach einem arbeitsreichen Leben
im 74. Jahre aus dem Kreise seiner Angehörigen geschieden. Die Gemeinde
betrauerte in dem Verstorbenen einen treuen Sachwalter ihrer Interessen,
dem sie über das Grab hinaus ein treues Gedenken bewahren wird. - Seit
vielen Jahren ist die hiesige Gemeinde ohne Lehrer und Kultusbeamten
gewesen, zum Leidwesen aller derjenigen, die an religiöser Erziehung und
Erhaltung der Gemeindeinstitutionen ein lebhaftes Interesse hatten. Umso
freudiger ist es zu begrüßen, dass die Wiederbesetzung der erledigten
Stelle bald in Aussicht steht, nachdem die auf etwa 30 Familien
angewachsene Gemeinde den Beschluss gefasst hat, Lehrer Jakob Höxter,
früher an der israelitischen Volksschule in Jesberg tätig, mit den
Funktionen eines Kultusbeamten zu betrauen. Der Gewählte wegen der
bestehenden Wohnungsnot noch nicht hierher übersiedeln könnte, hat an
den hohen Feiertagen und auch am Sukkausfeste (Laubhüttenfest) bereits
zur Zufriedenheit der Gemeinde den Gottesdienst geleitet. Es ist daher
auch der dringende Wunsch aller Beteiligten, dass er bald dauernd hier
seinen Wohnsitz nehmen möchte." Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 16. Oktober 1925: "Lich
(Oberhessen). (Tod eines Gemeindevorstehers). Der zweite Vorsteher
unserer Gemeinde, Kaufmann Chambré, ist nach einem arbeitsreichen Leben
im 74. Jahre aus dem Kreise seiner Angehörigen geschieden. Die Gemeinde
betrauerte in dem Verstorbenen einen treuen Sachwalter ihrer Interessen,
dem sie über das Grab hinaus ein treues Gedenken bewahren wird. - Seit
vielen Jahren ist die hiesige Gemeinde ohne Lehrer und Kultusbeamten
gewesen, zum Leidwesen aller derjenigen, die an religiöser Erziehung und
Erhaltung der Gemeindeinstitutionen ein lebhaftes Interesse hatten. Umso
freudiger ist es zu begrüßen, dass die Wiederbesetzung der erledigten
Stelle bald in Aussicht steht, nachdem die auf etwa 30 Familien
angewachsene Gemeinde den Beschluss gefasst hat, Lehrer Jakob Höxter,
früher an der israelitischen Volksschule in Jesberg tätig, mit den
Funktionen eines Kultusbeamten zu betrauen. Der Gewählte wegen der
bestehenden Wohnungsnot noch nicht hierher übersiedeln könnte, hat an
den hohen Feiertagen und auch am Sukkausfeste (Laubhüttenfest) bereits
zur Zufriedenheit der Gemeinde den Gottesdienst geleitet. Es ist daher
auch der dringende Wunsch aller Beteiligten, dass er bald dauernd hier
seinen Wohnsitz nehmen möchte." |
Lehrer Jakob Höxter wechselt nach Heldenbergen (1926)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1926: "Jesberg,
21. März (1926). Der pensionierte Lehrer Jakob Höxter, der seit 1899 am
hiesigen Orte amtiert, ist als Religionslehrer und Kultusbeamter nach Heldenbergen
berufen worden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1926: "Jesberg,
21. März (1926). Der pensionierte Lehrer Jakob Höxter, der seit 1899 am
hiesigen Orte amtiert, ist als Religionslehrer und Kultusbeamter nach Heldenbergen
berufen worden." |
Berichte aus dem jüdischen Gemeindeleben
55-jähriges Bestehen des Israelitischen Frauenvereins
(1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 14. Januar 1927: "Aus Jesberg. Der Israelitische
Frauenverein, welcher auf ein zirka 55-jähriges Bestehen
zurückblickt und dessen Hauptzweck in der Ausübung von Wohltätigkeit
besteht, veranstaltete in der K.schen Wirtschaft einen Gesellschaftsabend.
Herr Lehrer Katz (Borken) sprach
über Entstehung und Wertung biblischer Frauennamen. Die interessanten
Ausführungen des Redners fesselten die Zuhörer. Sehr eindrucksvoll wurde
von der Schülerin Lotte Goldschmidt das Gedicht 'Heimat in der
Fremde' vorgetragen, wofür sie reichen Beifall
erntete." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 14. Januar 1927: "Aus Jesberg. Der Israelitische
Frauenverein, welcher auf ein zirka 55-jähriges Bestehen
zurückblickt und dessen Hauptzweck in der Ausübung von Wohltätigkeit
besteht, veranstaltete in der K.schen Wirtschaft einen Gesellschaftsabend.
Herr Lehrer Katz (Borken) sprach
über Entstehung und Wertung biblischer Frauennamen. Die interessanten
Ausführungen des Redners fesselten die Zuhörer. Sehr eindrucksvoll wurde
von der Schülerin Lotte Goldschmidt das Gedicht 'Heimat in der
Fremde' vorgetragen, wofür sie reichen Beifall
erntete." |
Chanukka-Ball der Ortsgruppe des Reichsbundes
Jüdischer Frontsoldaten (1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und
Waldeck"
vom 13. Dezember 1929: "Zimmersrode. Die Ortsgruppe des
Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten Zimmersrode-Jesberg
feiert am 29. Dezember dieses Jahres im Gasthaus "Zum Bahnhof"
(Inhaber Ferdinand Theune) zu Zimmersrode
ihren diesjährigen Chanukah-Ball, verbunden mit der Feier des
fünfjährigen Bestehens der Ortsgruppe, wozu sämtliche Ortsgruppen,
Freunde und Bekannte eingeladen werden. Ganz besonders wird darauf
hingewiesen, dass die in Hessen und Waldeck als erstklassig bekannte
einzige jüdische Konzert- und Tanzkapelle Gebrüder Gelonka für den
Abend verpflichtet ist, sodass für eine gediegene Tanzmusik garantiert
wird. Für rituelle Küche bestens Sorge getragen."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und
Waldeck"
vom 13. Dezember 1929: "Zimmersrode. Die Ortsgruppe des
Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten Zimmersrode-Jesberg
feiert am 29. Dezember dieses Jahres im Gasthaus "Zum Bahnhof"
(Inhaber Ferdinand Theune) zu Zimmersrode
ihren diesjährigen Chanukah-Ball, verbunden mit der Feier des
fünfjährigen Bestehens der Ortsgruppe, wozu sämtliche Ortsgruppen,
Freunde und Bekannte eingeladen werden. Ganz besonders wird darauf
hingewiesen, dass die in Hessen und Waldeck als erstklassig bekannte
einzige jüdische Konzert- und Tanzkapelle Gebrüder Gelonka für den
Abend verpflichtet ist, sodass für eine gediegene Tanzmusik garantiert
wird. Für rituelle Küche bestens Sorge getragen." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Betty Katz (1876)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1876: "Jesberg in
Hessen. ‚Die Frommen schwinden
dahin, die Redlichen hören auf unter den Menschenkindern’. Mit
schmerzlichem Bewusstsein hat man die Wahrheit obigen Spruches auch in
unserer Gemeinde erfahren, indem derselben ein herber Verlust bereitet
wurde durch den Tod einer wackeren Frau. Betty Katz hieß die Verblichene; sie war die Frau
des Herrn Peritz Katz und hat diesem in den 36 Jahren, die sie in der Ehe
mit ihm verlebte, beigestanden als eine treue Gattin, als wahre Gehilfin.
Bei ihrem Tode, welcher am 13. Tag im Monat Tammus eintrat, konnte man mit
dem größten Rechte mit Raschi ausrufen: ‚geschwunden
ist der Schmuck, der Glanz und die Herrlichkeit’.
Ja, eine Zierde war die Verstorbene ihrem Hause, ihren Verwandten;
ein Schmuck der ganzen Gemeinde. Wem es vergönnt war, ihr einfaches mit nützlichen
Beschäftigungen ausgefülltes Leben etwas näher zu kennen; wer einen
Einblick tun konnte in ihr Wohl tun und in ihre Pflege, welche beide sie
Armen und Bedürftigen ohne Unterschied mit der größten Liebe zukommen
ließ; wer schließlich weiß, mit welchem Eifer und mit welcher Hingebung
und Selbstverleugnung sie alle einzelnen Gebote unseres Gottes ausübte,
der muss offen gestehen, dass eine Fromme in jeder Hinsicht durch ihren
Tod von der Erde hinweg genommen ist. Nicht hielt sie ein kleines
Unwohlsein ab, an irgend einem Fasttag zu fasten; nicht konnte sie Sturm,
Regen oder sonstiges Unwetter veranlassen, am Sabbat, Fest- und
Selichottagen nicht zum Gottesdienst zu gehen, um hier in ungestörter
Andacht ihr Herz auszugießen vor dem Allmächtigen, den sie aus seinen
Schriften so sehr erkannt und wegen seiner Güte so verehrt hat. Auch bei
keiner Angelegenheit vergaß sie das Wohl tun ihres Schöpfers; ohne ihn
zu loben, genoss sie keine seiner Gaben. Ja, als schwere Krankheit sie
ergriff und ihre Kräfte mit jedem Tage schwanden, verrichtete sie sogar,
so lang es ihr möglich war, morgens und abends ihr Gebet. So lange ihr
die Besinnung noch war, nahm
sie keine Arznei ein, ohne vorher einen Segensspruch (Berachah) gemacht zu
haben (Anmerkung des Korrektors: Das
war wohl nicht ganz korrekt. Über Arznei, namentlich überschmeckende,
macht man keine Berachah; man nimmt daher vorher etwas anderes, Wasser,
Wein oder Derartiges und spricht darüber die Berachah). Die
Verblichene wird nicht nur von ihrer großen Verwandtschaft allein beweint
und betrauert, sondern von der ganzen Gemeinde. Ganz besonders aber haben
die Armen Ursache, ihren schon im 58. Lebensjahre eingetretenen Tod zu
beweinen. Am Morgen des schon erwähnten Tages hauchte sie ihre Seele
in die Hand Gottes aus, um in der
kommenden Welt zu ernten, was
sie in dieser Welt ausgesät hat.
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1876: "Jesberg in
Hessen. ‚Die Frommen schwinden
dahin, die Redlichen hören auf unter den Menschenkindern’. Mit
schmerzlichem Bewusstsein hat man die Wahrheit obigen Spruches auch in
unserer Gemeinde erfahren, indem derselben ein herber Verlust bereitet
wurde durch den Tod einer wackeren Frau. Betty Katz hieß die Verblichene; sie war die Frau
des Herrn Peritz Katz und hat diesem in den 36 Jahren, die sie in der Ehe
mit ihm verlebte, beigestanden als eine treue Gattin, als wahre Gehilfin.
Bei ihrem Tode, welcher am 13. Tag im Monat Tammus eintrat, konnte man mit
dem größten Rechte mit Raschi ausrufen: ‚geschwunden
ist der Schmuck, der Glanz und die Herrlichkeit’.
Ja, eine Zierde war die Verstorbene ihrem Hause, ihren Verwandten;
ein Schmuck der ganzen Gemeinde. Wem es vergönnt war, ihr einfaches mit nützlichen
Beschäftigungen ausgefülltes Leben etwas näher zu kennen; wer einen
Einblick tun konnte in ihr Wohl tun und in ihre Pflege, welche beide sie
Armen und Bedürftigen ohne Unterschied mit der größten Liebe zukommen
ließ; wer schließlich weiß, mit welchem Eifer und mit welcher Hingebung
und Selbstverleugnung sie alle einzelnen Gebote unseres Gottes ausübte,
der muss offen gestehen, dass eine Fromme in jeder Hinsicht durch ihren
Tod von der Erde hinweg genommen ist. Nicht hielt sie ein kleines
Unwohlsein ab, an irgend einem Fasttag zu fasten; nicht konnte sie Sturm,
Regen oder sonstiges Unwetter veranlassen, am Sabbat, Fest- und
Selichottagen nicht zum Gottesdienst zu gehen, um hier in ungestörter
Andacht ihr Herz auszugießen vor dem Allmächtigen, den sie aus seinen
Schriften so sehr erkannt und wegen seiner Güte so verehrt hat. Auch bei
keiner Angelegenheit vergaß sie das Wohl tun ihres Schöpfers; ohne ihn
zu loben, genoss sie keine seiner Gaben. Ja, als schwere Krankheit sie
ergriff und ihre Kräfte mit jedem Tage schwanden, verrichtete sie sogar,
so lang es ihr möglich war, morgens und abends ihr Gebet. So lange ihr
die Besinnung noch war, nahm
sie keine Arznei ein, ohne vorher einen Segensspruch (Berachah) gemacht zu
haben (Anmerkung des Korrektors: Das
war wohl nicht ganz korrekt. Über Arznei, namentlich überschmeckende,
macht man keine Berachah; man nimmt daher vorher etwas anderes, Wasser,
Wein oder Derartiges und spricht darüber die Berachah). Die
Verblichene wird nicht nur von ihrer großen Verwandtschaft allein beweint
und betrauert, sondern von der ganzen Gemeinde. Ganz besonders aber haben
die Armen Ursache, ihren schon im 58. Lebensjahre eingetretenen Tod zu
beweinen. Am Morgen des schon erwähnten Tages hauchte sie ihre Seele
in die Hand Gottes aus, um in der
kommenden Welt zu ernten, was
sie in dieser Welt ausgesät hat.
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
|
Zum 90. Geburtstag von Levi Katz (1912)
 Mitteilung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. August
1912: "Jesberg bei Marburg. Rentner Levi Katz feiert
Samstag seinen 90. Geburtstag." Mitteilung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. August
1912: "Jesberg bei Marburg. Rentner Levi Katz feiert
Samstag seinen 90. Geburtstag." |
| |
 Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. September
1912: "Dieser Tage beging der Nestor der israelitischen Gemeinde in Jesberg,
der Rentner L. Katz, in völliger körperlicher Frische seinen 90.
Geburtstag. Nach Abhaltung eines Gottesdienstes begab sich die Gemeinde in
die Wohnung des Greises, um zu gratulieren. Herr Katz erfreut sich bei
allen Ortsbewohnern großer Beliebtheit." Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. September
1912: "Dieser Tage beging der Nestor der israelitischen Gemeinde in Jesberg,
der Rentner L. Katz, in völliger körperlicher Frische seinen 90.
Geburtstag. Nach Abhaltung eines Gottesdienstes begab sich die Gemeinde in
die Wohnung des Greises, um zu gratulieren. Herr Katz erfreut sich bei
allen Ortsbewohnern großer Beliebtheit." |
Zum Tod von Rebekka Katz geb. Katzenstein (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. März 1927: "Jesberg. Unerwartet entriss
der Tod die Ehefrau Rebekka Katz geb. Katzenstein ihrem
Wirkungskreis. Mit ihr ist eine echt religiöse und mildtätige Frau
dahingegangen. Lehrer Katz - Borken
würdigte Leben und Wirken der Entschlafenen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. März 1927: "Jesberg. Unerwartet entriss
der Tod die Ehefrau Rebekka Katz geb. Katzenstein ihrem
Wirkungskreis. Mit ihr ist eine echt religiöse und mildtätige Frau
dahingegangen. Lehrer Katz - Borken
würdigte Leben und Wirken der Entschlafenen." |
Zum Tod von Johanna Vogel geb. Weinberg (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. Juli 1927: "Jesberg. Am Sonntag wurde die
vor drei Jahren nach hier verzogene und bei ihrer Tochter, Frau Boni
Katz, wohnende Witwe Johanna Vogel geb. Weinberg, zu Grabe
getragen. An ihrem Sarge hob Herr Lehrer Katz - Borken
ihr treues Wirken hervor." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. Juli 1927: "Jesberg. Am Sonntag wurde die
vor drei Jahren nach hier verzogene und bei ihrer Tochter, Frau Boni
Katz, wohnende Witwe Johanna Vogel geb. Weinberg, zu Grabe
getragen. An ihrem Sarge hob Herr Lehrer Katz - Borken
ihr treues Wirken hervor." |
Goldene Hochzeit von Levi Katzenstein und
Jeanette geb. Bendheim (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1928:
"Jesberg, 14. August (1928). Am heutigen Tage begeht Herr Levi
Katzenstein, das älteste Mitglied der hiesigen israelitischen
Gemeinde, im 77. Lebensjahre stehend, mit seiner Gattin Jeanette geb.
Bendheim, in größter Frische die goldene Hochzeit. Das Paar genießt
in allen Kreisen der Bevölkerung Achtung und
Beliebtheit." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1928:
"Jesberg, 14. August (1928). Am heutigen Tage begeht Herr Levi
Katzenstein, das älteste Mitglied der hiesigen israelitischen
Gemeinde, im 77. Lebensjahre stehend, mit seiner Gattin Jeanette geb.
Bendheim, in größter Frische die goldene Hochzeit. Das Paar genießt
in allen Kreisen der Bevölkerung Achtung und
Beliebtheit." |
| |
 Mitteilung
in der Zeitschrift des "Central-Vereins" (CV-Zeitung) vom 10.
August 1928: "Die goldene Hochzeit des Ehepaares Katzenstein in
Jesberg (Bezirk Kassel) findet am 15. (nicht 14.) August
statt." Mitteilung
in der Zeitschrift des "Central-Vereins" (CV-Zeitung) vom 10.
August 1928: "Die goldene Hochzeit des Ehepaares Katzenstein in
Jesberg (Bezirk Kassel) findet am 15. (nicht 14.) August
statt." |
| |
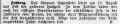 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 10. August 1928: "Jesberg. Das Ehepaar
Katzenstein feiert am 14. August das Fest der goldenen Hochzeit. In
dem Jubilar haben wir noch den rüstigen Repräsentanten der altjüdischen
Zeit, in der Jubilarin eine Person, die infolge ihrer Allgemeinbildung mit
der Zeit fortzuschreiten weiß. Möge dem Jubelpaar eine Reihe
ungetrübter Jahre beschieden sein." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 10. August 1928: "Jesberg. Das Ehepaar
Katzenstein feiert am 14. August das Fest der goldenen Hochzeit. In
dem Jubilar haben wir noch den rüstigen Repräsentanten der altjüdischen
Zeit, in der Jubilarin eine Person, die infolge ihrer Allgemeinbildung mit
der Zeit fortzuschreiten weiß. Möge dem Jubelpaar eine Reihe
ungetrübter Jahre beschieden sein." |
70. Geburtstag von Rosa Renß (1929)
 Mitteilung in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juli 1929:
"Jesberg, 1. Juli (1929). Ihre 70. Geburtstag begeht heute in
körperlicher Rüstigkeit und Geistesfrische Frau Rosa Renß dahier." Mitteilung in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juli 1929:
"Jesberg, 1. Juli (1929). Ihre 70. Geburtstag begeht heute in
körperlicher Rüstigkeit und Geistesfrische Frau Rosa Renß dahier."
|
75. Geburtstag von Settchen Schloss geb. Gans
(1931)
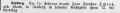 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Februar 1931: Jesberg. Am 15. Februar begeht
Frau Settchen Schloß geb. Gans, in Jesberg in seltener
Rüstigkeit ihren 75. Geburtstag."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Februar 1931: Jesberg. Am 15. Februar begeht
Frau Settchen Schloß geb. Gans, in Jesberg in seltener
Rüstigkeit ihren 75. Geburtstag." |
Zum Tod des Pferdehändlers Josef Katz (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1931: "Jesberg,
11. Mai (1931). Hier verstarb im Alter von 76 Jahren der in weiten Kreisen
bekannte Pferdehändler Josef Katz. Ein Mann von biederem Charakter und
trefflichen Eigenschaften ist in ihm dahingegangen, der auch eine Zeitlang
durch das Vertrauen der Gemeinde das Amt des Gemeindeältesten verwaltete,
die in ihm einen eifrigen Minjanmann und pflichteifrigen Besucher der Synagoge
verliert. Der Verstorbene stand bei der Mit- und Umwelt in hohem Ansehen,
wovon die zahlreiche Beteiligung bei der Beisetzung ehrendes
Zeugnis ablegte. Der Schwager des Verstorbenen entwarf an der Bahre ein
treues Lebensbild von demselben, ihn als Gatten, Vater, Juden, Mensch und
Bürger zeichnend. Möge Gott die trauernden Hinterbliebenen
trösten. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1931: "Jesberg,
11. Mai (1931). Hier verstarb im Alter von 76 Jahren der in weiten Kreisen
bekannte Pferdehändler Josef Katz. Ein Mann von biederem Charakter und
trefflichen Eigenschaften ist in ihm dahingegangen, der auch eine Zeitlang
durch das Vertrauen der Gemeinde das Amt des Gemeindeältesten verwaltete,
die in ihm einen eifrigen Minjanmann und pflichteifrigen Besucher der Synagoge
verliert. Der Verstorbene stand bei der Mit- und Umwelt in hohem Ansehen,
wovon die zahlreiche Beteiligung bei der Beisetzung ehrendes
Zeugnis ablegte. Der Schwager des Verstorbenen entwarf an der Bahre ein
treues Lebensbild von demselben, ihn als Gatten, Vater, Juden, Mensch und
Bürger zeichnend. Möge Gott die trauernden Hinterbliebenen
trösten. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 15. Mai 1931: "Jesberg. Eine große
Trauergemeinde hatte sich am Donnerstag der verflossenen Woche versammelt,
um dem Pferdehändler Josef Katz das letzte Geleit zu geben. In
einer eindrucksvollen Rede betonte Lehrer Höxter (Heldenbergen) die
Vorzüge des Verstorbenen, der sich in allen Bevölkerungskreisen der
größten Beliebtheit erfreute. Aber auch über die Grenzen der Heimat
hinaus war er bekannt und geachtet. Die israelitische Gemeinde Jesberg
hatte den Verstorbenen vor längeren Jahren zu ihrem Vorstand
gewählt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 15. Mai 1931: "Jesberg. Eine große
Trauergemeinde hatte sich am Donnerstag der verflossenen Woche versammelt,
um dem Pferdehändler Josef Katz das letzte Geleit zu geben. In
einer eindrucksvollen Rede betonte Lehrer Höxter (Heldenbergen) die
Vorzüge des Verstorbenen, der sich in allen Bevölkerungskreisen der
größten Beliebtheit erfreute. Aber auch über die Grenzen der Heimat
hinaus war er bekannt und geachtet. Die israelitische Gemeinde Jesberg
hatte den Verstorbenen vor längeren Jahren zu ihrem Vorstand
gewählt." |
Über den aus Jesberg stammenden Lehrer Sally
Katzenstein (geb. 1890 in Jesberg, ermordet in Auschwitz)
 Sally Katzenstein ist 1890 in Jesberg
geboren. Er war von 1911 bis 1921 Lehrer in Breitenbach,
danach bis 1935 Lehrer der jüdischen Gemeinde in Soest, schließlich noch in der Gemeinde Minden/Westfalen. Im Mai 1943 wurde er
mit seiner Frau nach
Theresienstadt, von dort 1944 nach Auschwitz deportiert und
ermordet. Sally Katzenstein ist 1890 in Jesberg
geboren. Er war von 1911 bis 1921 Lehrer in Breitenbach,
danach bis 1935 Lehrer der jüdischen Gemeinde in Soest, schließlich noch in der Gemeinde Minden/Westfalen. Im Mai 1943 wurde er
mit seiner Frau nach
Theresienstadt, von dort 1944 nach Auschwitz deportiert und
ermordet.
"Stolpersteine" erinnern an Sally Katzenstein und seine Frau vor
dem Haus Wilhelmstraße 18 in Minden.
(Quelle: Website
friedenswoche-minden.de ) |
Über den aus Jesberg stammenden Rabbiner Dr. Maier
(Meier) Appel (geb. 1851 in Jesberg, gest. 1919 in
Karlsruhe)
Dr. Maier (Meier) Appel
wurde 1851 in Jesberg
(nach anderen, nicht richtigen Angaben in Fritzlar) geboren; er starb 1919 in Karlsruhe; er war verheiratet mit Anna Willstätter,
Tochter von Rabbiner Benjamin Willstätter: Nach dem Studium im
Rabbinerseminar in Breslau 1870-1878 wurde er Rabbiner in Bad
Homburg, 1887-1894 Stadtrabbiner in
Mannheim, 1894-1919 Rabbiner in Karlsruhe (Stadt- und Konferenzrabbiner).
Texte zu seinem Tod (Biographie, Würdigungen) siehe Seite
mit Texten zur Geschichte der Rabbiner in Karlsruhe.
|
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Todesanzeige für Salomon F. Katz (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924:
"Am vergangenen Samstagmorgen entschlief sanft infolge eines
Schlaganfalles mein innigstgeliebter Gatte, unser guter edler Vater,
Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel
Salomon F. Katz
im vollendeten 71. Lebensjahre.
Die trauernden Hinterbliebenen.
Jesberg, Selters (Westerwald), Borken
(Main-Weser-Bahn), den 17. Februar 1924". |
Anzeige von Jacob Katzenstein (1924)
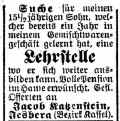 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924:
"Suche für meinen 15 1/2-jährigen Sohn, welcher bereits ein
Jahr in meinem Gemischtwarengeschäft gelernt hat, eine
Lehrstelle,
wo er sich weiter ausbilden kann. Volle Pension im Hause erwünscht.
Gefällige Offerten an
Jacob Katzenstein,
Jesberg (Bezirk Kassel)." |
Anzeige von Moses Ganß (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 3. April 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 3. April 1924:
"Suche für meine 18-jährige Tochter
Aufnahme
in besserem, rituellem Hause zwecks Erlernung des Haushalts, wo
Dienstmädchen vorhanden, bei vollständigem Familienanschluss. Angebote
erbittet Moses Ganß, Jesberg (Bezirk
Kassel)." |
Geburtsanzeige für eine Tochter von Jakob Katz und
Rosa geb. Alexander (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 17. Juli 1924: "Die glückliche
Geburt ihres Töchterchens zeigen hocherfreut an Jakob
Katz und Frau Rosa geb. Alexander. Jesberg, den 13. Juli
1924." Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 17. Juli 1924: "Die glückliche
Geburt ihres Töchterchens zeigen hocherfreut an Jakob
Katz und Frau Rosa geb. Alexander. Jesberg, den 13. Juli
1924." |
Verlobungsanzeige von Blanka Löwenstein und
Siegfried Katz (1930)
 Anzeige
in der Zeitschrift des "Central-Vereins"
("CV-Zeitung") vom 24. Oktober 1930: Anzeige
in der Zeitschrift des "Central-Vereins"
("CV-Zeitung") vom 24. Oktober 1930:
"Blanka Löwenstein - Siegfried Katz
grüßen als Verlobte. Fritzlar - Jesberg. 26. Oktober
1930." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betraum oder eine erste Synagoge
vorhanden.
1831/32 konnte die jüdische Gemeinde eine Synagoge erbauen und im
Sommer 1832 einweihen.
Über die Einweihung der Synagoge in Jesberg und das
von der Kirchenleitung nicht gewollte Engagement des Pfarrers Bach (1832;
Bericht von 1908)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juli 1908: "Aus
Kurhessen. Wenn man von dem Verhältnis der Nichtisraeliten zu den
Israeliten Kurhessens nach der Anzahl der abgegebenen antisemitischen
Stimmen schließen wollte, käme man zu einem falschen Urteil. Die
Bekenner beider Konfessionen leben in Dorf und Stadt in steter Harmonie, -
und so war es auch vor vielen Jahren. Im Sommer 1832 wurde in dem
Dörfchen Jesberg die Synagoge eingeweiht, der auch der Ortspfarrer
beiwohnte. Infolge dessen richtete er an das Kurfürstliche Konsistorium
nachstehendes Schreiben: Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juli 1908: "Aus
Kurhessen. Wenn man von dem Verhältnis der Nichtisraeliten zu den
Israeliten Kurhessens nach der Anzahl der abgegebenen antisemitischen
Stimmen schließen wollte, käme man zu einem falschen Urteil. Die
Bekenner beider Konfessionen leben in Dorf und Stadt in steter Harmonie, -
und so war es auch vor vielen Jahren. Im Sommer 1832 wurde in dem
Dörfchen Jesberg die Synagoge eingeweiht, der auch der Ortspfarrer
beiwohnte. Infolge dessen richtete er an das Kurfürstliche Konsistorium
nachstehendes Schreiben:
Der Pfarrer Bach zu Jesberg hat uns die Anzeige gemacht, dass am
10. dieses Monats die Einweihung der daselbst erbauten neuen jüdischen
Synagoge statt gehabt, welcher er mit den hiesigen Beamten Schullehrern
und mehreren anderen dazu eingeladenen christlichen Einwohnern beigewohnt
habe. Nach geendigter Predigt des Kreisrabbiners am Schluss des
Gottesdienstes sei es ihm Bedürfnis gewesen, aus der Fülle des Herzens
der kleinen Gemeinde zu dieser Festfeier Glück zu wünschen und hieran an
kleinen Vortrag zu knüpfen, der von denselben mit solchen Äußerungen
der Rührung und Dankbarkeit aufgenommen worden, dass er, weil ihn das
arme Volk seines erbärmlichen mechanischen Gottesdienstes und der
gänzlichen Entbehrung alles religiösen Zuspruches wegen wahrhaft
jammere, versprach, wenn man nichts dagegen habe, ihnen von Zeit zu Zeit
in ihrer Versammlung am Sabbat einen Religionsvortrag zu halten, und hat,
da dieses von den Anwesenden, namentlich auch von dem Kreisrabbiner mit
Wohlgefallen aufgenommen worden, und er sich die Hoffnung mache, dadurch
mit der Zeit einigen Nutzen stiften zu können, bei uns angefragt, ob wir
dazu die Erlaubnis erteilen wollten. Da wir uns von dem Antrage des
Pfarrers in mancher Hinsicht eine wohltätige Wirkung versprechen, so sind
wir nicht abgeneigt, unsere Zustimmung hierzu zu geben, wünschen jedoch
zuvor die Ansicht der Kurfürstlichen Regierung hierüber zu
erfahren.
Ordnungsgemäß hörte das Konsistorium die Meinung des
Regierungs-Kollegiums; der Bescheid lässt an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig:
Auf das gefällige Schreiben Kurfürstlichen Konsistoriums beehren Wir uns
ergebenst zu erwidern, dass wir mit der Ansicht nicht einverstanden sein
können. Fühlt der Pfarrer Bach sich etwa getrieben, das Christentum
unter den Juden in Jesberg zu verbreiten, und stellen sich einzelne
Israeliten daselbst zur Annahme desselben empfänglich und geneigt, so
steht durchaus nichts im Wege, dass dieser privatim in seiner Wohnung
christlichen Religionsunterricht erteilen, oder dass solche zu dem Ende
die christliche Kirche besuchen. Dagegen erscheint es mit dem Berufe eines
christlichen Predigers überhaupt nicht verträglich, solche
Religionsvorträge zu halten, welche des eigentümlichen Gepräges der
christlichen Glaubenslehre entbehren, und können wir von solche
Religionsvorträgen, welche sich nicht auf das Evangelium gründen, keinen
wahren Nutzen versprechen." |
Aus der Geschichte der Synagoge liegen nur wenige Informationen vor. Es handelte
sich um ein zweigeschossiges Fachwerkhaus. Im Betsaal im Erdgeschoss hatte es 44 Plätzen für Männer, 41 für
Frauen auf der Empore. Neben dem Betsaal war die Schulstube; die
Lehrerwohnung war über zwei Stockwerke verteilt. Das Gebäude lag neben
dem Ortsbach. Aus dem Jahr 1904 ist eine Predigt von
Landrabbiner Dr. Prager (Kassel) in der Synagoge in Jesberg
überliefert:
Predigt von Landrabbiner Dr. Prager in der Synagoge
Jesberg (1904)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1904: "Jesberg, 21. Januar
(1904). Anlässlich der hiesigen Schul- und Schächterprüfungen durch
Seine Ehrwürden den Herrn Landrabbiner Dr. Prager – Kassel nahm
letzterer die Gelegenheit wahr, an die um 5 Uhr Nachmittags in der
hiesigen Synagoge sich versammelnde Gemeinde eine erbauliche Ansprache zu
richten, in der er zwei Merkmale des laufenden Wochenabschnittes näher
beleuchtete. Es seien einige Kernpunkte dieser Ansprache wiedergegeben. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1904: "Jesberg, 21. Januar
(1904). Anlässlich der hiesigen Schul- und Schächterprüfungen durch
Seine Ehrwürden den Herrn Landrabbiner Dr. Prager – Kassel nahm
letzterer die Gelegenheit wahr, an die um 5 Uhr Nachmittags in der
hiesigen Synagoge sich versammelnde Gemeinde eine erbauliche Ansprache zu
richten, in der er zwei Merkmale des laufenden Wochenabschnittes näher
beleuchtete. Es seien einige Kernpunkte dieser Ansprache wiedergegeben.
‚Mit einem dankbaren Aufblick zu Gott begrüße ich die Gelegenheit, die
es mir vergönnt, an dieser heiligen Stätte zu Euch zu sprechen, und da
ist es ein Zweifaches des laufenden Wochenabschnittes, auf das ich Eure
Aufmerksamkeit hinlenken möchte. Als einst Gott dem Mosche den Auftrag
gab, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, da entgegnete Mosche: Wer
bin ich, dass ich das vollführen kann? Und Gott sprach zu ihm: Ich will
mit Dir sein und das sei dir ein Zeichen: Sprenge das Blut des
geschlachteten Lammes an die Türpfosten und es sei euch ein Zeichen an |
 den
Häusern, in denen ihr wohnet, und ich werde das Blut sehen und werde euch
überschreiten, und keine Plage wird euch treffen, wenn ich vernichtend über
Ägypten einher ziehe. Und dieser Tag soll euch zum Andenken sein. Und
Mosche erwiderte: Herr der Welt! Bedarf es für dich eines Zeichens,
kennst du nicht auch so die Häuser, die du überschreiten willst? Und
Gott sagte: Es soll nicht für mich, sondern nur für euch ein Zeichen
sein, wenn ihr es beobachtet, dann sollt ihr erkennen, dass ich euch nie
verlassen werde. – Dieses Zeichen, so fährt Redner fort, besitzt die
Kraft, Israel aufrecht zu halten, dass es nicht untergeht, es hat sich an
vier Jahrtausende bewährt, und mit ihm trotzt Israel allen Stürmen von
außen, allen Prüfungen und Versuchungen, mit der Beobachtung dieses
Zeichens kann Israel sorglos der Zukunft entgegen sehen, es wird an seine
Vergangenheit denken und sich erinnern, dass Gott es niemals verlassen
hat, wie er es errettet aus der Hand des mächtigen Pharao, und aus den
Sklavenketten befreite, so wird er ihm auch weiter beistehen. Durch dieses
Zeichen an den Häusern werden letztere zu geweihten Stätten, zur Stätte
der Wahrheit und des Friedens, jeder Familienvater zum Priester seiner
Familie, jede Mutter zur Lehrerin ihrer Kinder. Diese würden in Liebe zu
Gott und seiner Religion erzogen, und es würde dadurch das Fundament
geschaffen, auf dem unser ganzer Glaube aufgebaut sei. den
Häusern, in denen ihr wohnet, und ich werde das Blut sehen und werde euch
überschreiten, und keine Plage wird euch treffen, wenn ich vernichtend über
Ägypten einher ziehe. Und dieser Tag soll euch zum Andenken sein. Und
Mosche erwiderte: Herr der Welt! Bedarf es für dich eines Zeichens,
kennst du nicht auch so die Häuser, die du überschreiten willst? Und
Gott sagte: Es soll nicht für mich, sondern nur für euch ein Zeichen
sein, wenn ihr es beobachtet, dann sollt ihr erkennen, dass ich euch nie
verlassen werde. – Dieses Zeichen, so fährt Redner fort, besitzt die
Kraft, Israel aufrecht zu halten, dass es nicht untergeht, es hat sich an
vier Jahrtausende bewährt, und mit ihm trotzt Israel allen Stürmen von
außen, allen Prüfungen und Versuchungen, mit der Beobachtung dieses
Zeichens kann Israel sorglos der Zukunft entgegen sehen, es wird an seine
Vergangenheit denken und sich erinnern, dass Gott es niemals verlassen
hat, wie er es errettet aus der Hand des mächtigen Pharao, und aus den
Sklavenketten befreite, so wird er ihm auch weiter beistehen. Durch dieses
Zeichen an den Häusern werden letztere zu geweihten Stätten, zur Stätte
der Wahrheit und des Friedens, jeder Familienvater zum Priester seiner
Familie, jede Mutter zur Lehrerin ihrer Kinder. Diese würden in Liebe zu
Gott und seiner Religion erzogen, und es würde dadurch das Fundament
geschaffen, auf dem unser ganzer Glaube aufgebaut sei.
Und es soll sein zum Zeichen an deiner Hand und zur Erinnerung
zwischen deinen Augen, damit die Lehre Gottes in deinem Munde sei.
Es ist eine betrübende Tatsache, wenn man einen Blick auf die
Gegenwart wirft; nicht ohne Rührung und bitteres Weh im Herzen sieht man,
wie so viele vom rechten Weg abirren und gekrümmte Pfade wandeln. Sie
befolgen jeder das Gesetz, sie kennen das Zeichen, aber nicht den inneren
Wert, sie heften Mesusaus (Mesusot) und legen Tallis
(Gebetsschal) und Tefillin,
damit glauben sie ihrer Pflicht genügt zu haben, nun dürfen sie sündigen.
Doch nein, durch die Mesuso wird das Haus zu einer heiligen Stätte, und
nicht Unlauteres darf über die Schwelle kommen, wenn du hinausgehest, so
blicke auf die Mesuso, der Name des allmächtigen Gottes mahnt dich daran,
nichts Böses zu tun, den Versuchungen und Verlockungen, die da draußen
deiner warten, zu widerstehen, wenn du in dein Haus gehst, so schaue auf
die Mesuso, was du getan und vollbracht hast, stelle Gott anheim, wenn
Schicksalsschläge dich heimsuchen, wenn du verzweifeln willst im schweren
Kampf ums Dasein, so blicke auf die Mesuso, dein Gott ist neben dir, Er
wird dir helfen, blicke auf das Zeichen deiner Hand, so wirst du erinnert
werden, dass dein ganzes Sorgen und Schaffen, dass alles, was deine Hände
unternehmen, alles im Namen Gottes geschehen muss. So werden Mesuso und
Tefillin zur Waffe, mit der wir uns verteidigen können gegen alle Anstürmungen,
gegen alle Verlockungen und Versuchungen, darum sind sie auch die ersten
Vorschriften gewesen, die Israel erhalten hat, und der Monat wurde zum
ersten der Monate des Jahres bestimmt.
Und in der Tat, unser ganzes Leben ist auch diesen beiden Vorschriften über
Mesuso und Tefillin aufgebaut. Möget ihr euch das zu Herzen nehmen, wie
sie Schutz und Harnisch gewesen sind gegen alle Feinde, so werden sie es
weiter bleiben über alle Stürme, die heranbrausen, über alle Fluten,
die uns umtoben, bleibt
ewiglich fortbestehen der reine, wahre Gottesgedanke." |
| |
Die Predigt von
Landrabbiner
Dr. Prager wurde auch - in
teilweise ausführlicherer
Wiedergabe - abgedruckt im
"Frankfurter Israelitischen
Familienblatt" vom
11. März 1904 |
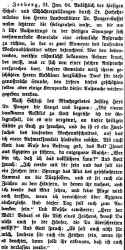 |
 |
 |
1932 konnte die Gemeinde das 100-jährige Bestehen des Synagoge feiern.
Zum Jubiläum wurde das Gebäude renoviert. Beim Festgottesdienst hielt Provinzial-Rabbiner Dr. Walter aus Kassel die
Ansprache. Lehrer Katz aus Borken wirkte als Kantor mit.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge verwüstet. Einige der
Täter standen nach 1945 vor Gericht, wie aus den im Staatsarchiv Marburg
aufbewahrten Prozessakten hervorgeht.
Nach 1945 wurde das Synagogengebäude kam das Gebäude 1946 an die
jüdische Vermögensverwaltung JRSO und wurde von dieser nach dem
Restitutionsverfahren an Privatpersonen verkauft. In der Folgezeit kam es zu
mehreren Besitzerwechseln. Nach einem 1965 erfolgten Verkauf wurde es
schließlich zu einem bis heute bestehenden Wohnhaus umgebaut. Nach dem
Umbau waren keine Spuren der ehemaligen Synagoge mehr zu erkennen.
Adresse/Standort der Synagoge: Densbergerstraße
38
Fotos
(Quelle: Altaras: Synagogen in Hessen Bd. I S. 54;
neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 8.4.2010)
| Historische Aufnahme |
 |
|
| |
Die Synagoge in Jesberg -
Aufnahme
vor dem Ersten Weltkrieg |
|
| |
|
|
Die ehemalige Synagoge
im
Juli 1985 |
 |
 |
| |
Straßenseite |
Traufseite zum Garten |
| |
|
|
Die ehemalige
Synagoge
im April 2010 |
 |
 |
| |
wie oben |
wie oben |
| |
|
|
| |
|
|
Die "Judenordnung"
in Jesberg
vom Februar 1935
(Quelle: Digitales Archiv
Marburg) |
 |
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
 | Website der
Gemeinde Jesberg |
 | 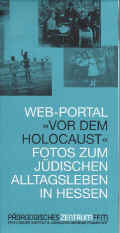 Webportal
"Vor dem Holocaust" - Fotos zum jüdischen Alltagsleben in
Hessen mit Fotos zur jüdischen Geschichte in Jesberg. Webportal
"Vor dem Holocaust" - Fotos zum jüdischen Alltagsleben in
Hessen mit Fotos zur jüdischen Geschichte in Jesberg.
|
 | Barbara Greve: Unter http://jinh.lima-city.de/index-gene.htm
finden sich Beiträge zu Stammbäumen und Familiengeschichten,
darunter:
Nachkommen der Familie GANNS (Gans) aus Densberg, Hessen
Nachkommen des DAVID STERN aus Densberg, Hessen
Nachkommen des RUBEN KATZ aus Jesberg, Hessen
Nachkommen des SCHOLUM KATZENSTEIN aus Jesberg, Hessen
Die rekonstruierten Personenstandsregister der jüdischen Gemeinde Jesberg
Die rekonstruierten Personenstandsregister der jüdischen Gemeinde Jesberg - Einführung
Geburtsregister der jüdischen Gemeinde Jesberg – Rekonstruktion
Heiratsregister der jüdischen Gemeinde Jesberg - Rekonstruktion
Sterberegister der jüdischen Gemeinde Jesberg - Rekonstruktion |
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 411-413. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 53-54. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 51 (keine neuen
Informationen) |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.
177. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 490-491. |
 | Barbara Greve: Gelles Kleider. Eine Studie zum Kleidungsbesitz jüdischer Frauen um 1800.
In: Hessische Heimat 3/2014, S. 13-19. |
 | dies.: Die Juden von Jesberg. In: Schwälmer Jahrbuch 2015, S. 51-63.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Jesberg Hesse-Nassau.
Established in the 18th century, the community dedicated a synagogue in 1832,
maintained an elementary school from 1838 bis 1922, and grew to 89 (11 % of the
total) in 1905. It dwindled to 58 in 1933. The synagogue was desecrated on Kristallnacht
(9-10 November 1938), and all the Jews left (50 emigrating) by 1939.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|