|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Schwalm-Eder-Kreis"
Gudensberg mit
Maden und Obervorschütz (Schwalm-Eder-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Gudensberg bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung
geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück. 1621 werden erstmals Juden in
Gudensberg, 1646 Juden in Maden erwähnt. 1664 lebten vier jüdische Familien in
Gudensberg (Veit, Männlein-Mendel, Isaak, einer mit dem Familiennamen Schütz),
1671 drei. Im 18. Jahrhundert stieg die Zahl auf sechs Familien (1737), acht
Familien (1744) beziehungsweise zehn Familien (1776). Gudensberg war im 18.
Jahrhundert bereits von regionaler Bedeutung für die jüdischen Gemeinden der
Region: 1788 bis 1797 fanden am Ort vier Judenlandtage statt, die jeweils 3 bis
5 Wochen dauerten und zu welchen alle jüdischen Steuerzahler erscheinen
mussten. Auch der letzte Judenlandtag in Hessen-Kassel 1807 fand in Gudensberg
statt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1835 122 jüdische Einwohner (6,2 % von insgesamt 1.963
Einwohnern), 1843 125, 1855 167, 1861 157 (7,8 % von 2.010), 1871 194 (10,4 %
von 1.875), 1885 187 (10,1 % von 1.859), 1895 154 (8,0 % von 1.026), 1905 147
(6,8 % von 2.152). Zur jüdischen Gemeinde in Gudensberg gehörten auch die in Obervorschütz
und Maden lebenden jüdischen Einwohner (In
Obervorschütz 1835 45 jüdische Einwohner, 1861 47, 1905 19, 1924 6, 1932 7, in
Maden 1835 34, 1861 37, 1905 9, 1924 4, 1932 keine mehr; vgl. unten Bericht zum
90. Geburtstag von Frau Mansbach in Maden).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische
Schule (Elementarschule von 1825 bis 1934 im jüdischen Schulhaus neben der
Synagoge), ein rituelles Bad und ein Friedhof in Obervorschütz.
Die Konfessionsschule wurde 1877 von 26 Kindern besucht, 1882 von 48 Kindern.
Als Lehrer waren u.a. tätig: in den 1840er-Jahren Israel Meier Japhet (geb.
1818 in Kassel, gest. 1892 in Frankfurt), um 1865 M. Isaac (Quelle),
nach 1876 Joseph Bloch, von 1894 bis 1928 Bernhard Perlstein (gest. 1932, vgl. Bericht),
von 1928 bis 1934 Hermann Stern.
Die Gemeinde war im 19. Jahrhundert zeitweise Sitz des Kreisrabbinates. Rabbiner
Mordechai (Marcus Gerson) Wetzlar, der 1830 als Kreisrabbiner von Fritzlar
gewählt worden war, verlegte den Sitz des Rabbinates nach Gudensberg, da ihm
die jüdische Gemeinde in Fritzlar zu liberal geprägt war. 46 Jahre blieb
Rabbiner Wetzlar in Gudensberg. Für die orthodox gesinnten jüdischen Kreise
galt er als "Oberlandesrabbiner" in Hessen und genoss höchste
Anerkennung. Nach dem grausamen Mord an der Familie des Kaufmanns Elias im
Dezember 1875 (siehe Artikel unten) regte sich Wetzlar so sehr auf, dass er
Gudensberg verließ und zu seinen Kindern nach Frankfurt zog (vgl. Artikel zu
seinem Tod 1878 in Frankfurt unten).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Max Plaut (geb.
8.10.1893 in Niedenstein, gef. 9.9.1914), Siegfried Hahn (geb. 1.1.1884 in
Gudensberg, gest. 13.4.1919 in Gefangenschaft) und Willy Plaut (geb. 18.4.1893
in Gudensberg, vor 1914 in Obervorschütz wohnhaft, gef. 27.5.1918).
Um 1924, als noch 118 jüdische Einwohner gezählt wurden (5,1 % von
insgesamt 2.329 Einwohnern), waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde
Joseph Wallach und Julius Sauer. Als Lehrer und Kantor war weiterhin - obwohl
bereits seit 1909 pensioniert - Bernhard Perlstein tätig. 1925 verzog er
mit Frau und Tochter nach Berlin. An jüdischen Vereinen gab es: den Männerverein
(1924 unter Leitung von Lehrer Perlstein mit 14 Mitgliedern), den Israelitischen
Jünglingsverein (1924 unter Leitung von Julius Weiler mit 21
Mitgliedern), den Israelitischen Frauenverein (1924 unter Leitung
von Lehrer Perlstein), den Verein Hachnosath Orchim (1924 unter Leitung
von Joseph Wallach). 1932 waren die Vorsteher Meier Löwenstein (1.
Vorsitzender und Schriftführer; war letzter Gemeindevorsteher bis 1938) sowie
Hugo Oppenheimer (2. Vorsitzender). Als Lehrer und Kantor war inzwischen Hermann
Stern tätig. Er unterrichtete an der Jüdischen Volksschule noch 14 Kinder in 3
Klassen.
1932 lebten noch 103 jüdische Personen in Gudensberg (4,8 % von 2.422).
In den Jahren nach 1933 sind alle jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der
zunehmenden Entrechtung, der Repressalien und des nationalsozialistischen
Terrors aus der Stadt weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Gudensberg galt
als eine "Hochburg der NSDAP". Bereits 1933 gingen die
Nationalsozialisten mit gezieltem Terror gegen jüdische Kaufleute vor, um sie
zur Aufgabe ihrer Geschäfte zu zwingen. Julius Naschelsky, der seit 1902 eine
Fahrradhandlung in der Hintergasse 1 betrieb (siehe Bericht unten), wurde am 30.
Juni 1933 mit anderen jüdischen Männern nach Wabern gebracht und schwer
misshandelt. Nach weiteren Verhaftungen gab er 1934 sein Geschäft auf und
emigrierte mit seiner Familie in die USA. Am 1. Januar 1934 wurde die jüdische
Elementarschule von den Nationalsozialisten geschlossen; damals wurde sie noch
von 14 Kindern besucht. Bis die letzten jüdischen Personen die Stadt
verlassen hatten, kam es regelmäßig zu Überfällen und Misshandlungen durch
SA-Männer. Bis Anfang Mai 1938 sind alle jüdischen Einwohner aus Gudensberg
verzogen, insbesondere nach Kassel (48 Personen), Frankfurt (14), Hamburg (8).
Etwa 20 Personen konnten emigrieren. Am 5. Mai 1938 berichtete die
"Kurhessische Landeszeitung" davon, dass Gudensberg nun
"judenfrei" sei - ein anschauliches Beispiel für die damalige Hetz-
und Verleumdungskampagne der NSDAP gegen die jüdischen Einwohner der Stadt:
"Kurhessische Landeszeitung" vom 5. Mai
1938 (S. 4; zitiert nach der Abbildung 65 in der Publikation
"Gudensberg - Gesichter einer Stadt" 1990 S. 126; Hinweis von
Alexander Kaste): "GUDENSBERG IST JUDENFREI.
Gudensberg. Ein fünfjähriger, zäher Kampf gegen das Judentum in der Stadt Gudensberg ist nun endlich von Erfolg gekrönt.
Wer früher durch das alte Chattenstädtchen wanderte, begegnete auf Schritt und Tritt dem artfremden Element, das sich hier ganz besonders wohl fühlte und breit gemacht hatte. Die Judengemeinde zählte bei der Machtübernahme 124 Mitglieder, sie stellte einen eigenen Vertreter im Stadtparlament, der sehr oft das Zünglein an der Waage war und die Abstimmung maßgeblich
beeinflusste.
In der Hand eines Juden lag ferner das Amt eines Schiedsmannes. Deutsche Volksgenossen
mussten sich vom Talmudjuden richten lassen.
In den bürgerlichen Vereinen waren die Juden als Vorstands- und Ehrenratsmitglieder tonangebend. Überall machten sie ihren
Einfluss geltend, nur nicht bei der Arbeit. Wie eine Landplage überschwemmten sie als Güterschlächter,
Hausierer und Viehhändler die umliegenden Dörfer des Chattengaues, um den deutschen Volksgenossen den
Ertrag ihrer Arbeit abzugaunern. Wie viele Tränen mögen geflossen sein, wenn die
Elias, Hofmann, Katz, Plaut und Mansbach deutsche Bauern um Haus und Hof gebracht hatten. Diese Zeiten sind nun endgültig
vorbei. Heute haben wir die Gewissheit, das sich in den Mauern der Stadt kein Jude mehr aufhält und auch in Zukunft nie mehr ein Jude
sesshaft werden wird. Die Judenplage ist wie ein Alpdruck von der Bevölkerung Gudensbergs gewichen. Die gesamte Einwohnerschaft
dankt der Ortsgruppe der NSDAP, insbesondere dem Ortsgruppenleiter, für den unermüdlichen Kampf und die Befreiung des schönen Chattenstädtchens Gudensberg von den jüdischen
Schmarotzern" . |
Von den in Gudensberg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma Abt geb. Nagel
(1877), Alfred Abraham Engelbert (1886), Siegfried Engelberg (1888), Berta Ert
geb. Perlstein (1895), Elise (Else) Fürst geb. Jacoby (1884), Charli
Goldschmidt (1883), Martha Goldschmidt (1880), Meier Hermann Goldschmidt (1882),
Süsskind Goldschmidt (1884), Ludwig Gutheim (1907), Alfred Hahn (1911), Josef
Hahn (1878), Mirjam Hammerschlag geb. Lilienfeld (1889), Biene Heidt geb.
Levisohn (1864), Rosalie Heinemann geb. Nagel (1874), Helene Israel geb.
Mansbach (1865), Jenny Jacob geb. Hammerschlag (1886), Bertha Joseph geb.
Löwenstein (1875), Salomon (Sally) Katz (1883), Albert Lilienfeld (1814),
Blümchen Lilienfeld (1882), Ina Lilienfeld (1909), Julchen (Julie) Lilienfeld
(1868), Kurt Lilienfeld (1912), Naphtalie Lilienfeld (1872), Regina Lilienfeld
(1907), Regina Lilienfeld (1977), Tea Lilienfeld (1909), Leopold Löwenstein
(1873), Berta Mahler geb. Adler (1864), Rosa Mannheimer (1896), Leopold (Louis)
Mansbach (1877), Beate Hildegard Mansbach-Leviticus (1916), Selig Nagel (1860),
Helene Ney geb. Boley (1865), Dagobert Plaut (1887), Siegfried Plaut (1892),
Esther Posen (1874), Hilde (Hildegard) Rosenthal (1912), Meier Meinhardt
Rosenthal (1905), Anna Simon geb. Markheim (1876), Auguste Simon geb.
Löwenstein (1877), Gustav Sitzmann (1922), Jenny Sitzmann geb. Heydt (1895),
Julius Sitzmann (1924), Kurt Sitzmann (1930), Gertrud Weiler (1914), Siegfried
Weiler (1907), Charlotte Wertheim geb. Nagel (1881), Julie Zehden geb. Markheim
(1873).
Von den in Obervorschütz geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna Kahn geb.
Plaut (1913), Josef Katz (1873).
Von den in Maden geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Tetzchen Bamberg geb.
Mansbach (1866), Bela Fried (1903), Bella Mansbach (1868), Recha Mansbach
(1870).
Nach 1945: Gudensberg war von 2001 bis 2010 Vereinssitz und Zentrum der
Aktivitäten der "Jüdisch-Liberalen Gemeinde Emet
weSchalom e.V.", die im Herbst 1995 in Kassel gegründet
wurde. Im November 2010 wurde der Sitz der Gemeinde nach Felsberg
verlegt. Die Gemeinde hatte in Gudensberg einen Gemeinderaum in der
Gerhart-Hauptmann-Straße 4, doch wurde - vor allem an jüdischen Feiertagen -
auch die ehemalige Synagoge in Gudensberg für Gottesdienste verwendet (zuletzt
zu den hohen Feiertagen im Herbst 2010).
Siehe die Website der Jüdisch Liberalen
Gemeinde Emet weSchalom sowie den Wikipedia-Artikel
"Jüdische Liberale Gemeinde Emet weSchalom Nordhessen".
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte
des Rabbinates
Verfügung von Kreisrabbiner Mordechai Wetzlar zur
Gottesdienstreform (1839)
| Anmerkung:
Rabbiner Mordechai (= Marcus Gerson) Wetzlar ist 1801 in Wetzlar als
einziger Sohn sehr armer Eltern geboren, besuchte von 1815 bis 1824 Jahre
die Jeschiwa in Hanau bei Rabbiner Sontheim und studierte 1824 bis 1829 in
Würzburg und Marburg. Seit April 1830 Kreisrabbiner in Gudensberg; war
als orthodoxer Rabbiner Leiter einer der letzten westdeutschen Jeschiwot;
war mit drei Töchtern des Frankfurter Klausrabbiners Jakob Posen
verheiratet (seit 1830 mit Hindele-Henriette, 1845 mit Lipet-Elisabeth,
seit 1860 mit Jette). |
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1894: "Geehrter Herr Redakteur. Bezugnehmend auf die der Verbesserung unseres
Gottesdienstes gewidmeten Artikel Ihrer geschätzten Zeitung sende ich
Ihnen eine interessante Verfügung zu, die der als hochorthodox weit
bekannte Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg (Regierungsbezirk Kassel) im
Jahre 1839 an sämtliche Gemeinden seines Rabbinats – aus lauter kleinen
Landgemeinden bestehend – erlassen hat. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1894: "Geehrter Herr Redakteur. Bezugnehmend auf die der Verbesserung unseres
Gottesdienstes gewidmeten Artikel Ihrer geschätzten Zeitung sende ich
Ihnen eine interessante Verfügung zu, die der als hochorthodox weit
bekannte Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg (Regierungsbezirk Kassel) im
Jahre 1839 an sämtliche Gemeinden seines Rabbinats – aus lauter kleinen
Landgemeinden bestehend – erlassen hat.
Die Verfügung lautet:
‚Folgende Anordnung werden Sie in dasiger Gemeinde für Tischebeaf (Tischa
beAw, 9. Aw) treffen: (1 und 2 belanglos). 3. Der dasige Lehrer hat beim
Morgengottesdienst die Haftora, nachdem dieselbe vom Vorsänger hebräisch
vorgetragen ist, in deutscher Sprache vorzutragen. 4. Nachdem die Tora
eingehoben ist, hat der Lehrer ganz Echa in deutscher Sprache vorzutragen,
wobei derselbe vor dem Aron hakodesch (Toraschrein) sitzen soll. 5.
Hingegen sollen von den Kinoth, welche die Jechidim singen, folgende ausgesetzt werden. (Hier werden 18 solcher angeführt.). Gudensberg, am
Vorabend des Monats Ab 5599. Der Kreisrabbiner gez. Wetzlar. An den
Gemeindeältesten Herrn N. zu N.’
Ähnliche Anordnungen hat Herr
Rabbiner Wetzlar auch bezüglich der Hebung des Gottesdienstes an den
Feiertagen getroffen, wonach man sich doch fragen muss, was unsere
heutigen Orthodoxen eigentlich wollen, dass sie sich noch immer gegen jede
Reform des Gottesdienstes wehren. A." |
Zwei Briefe des Kreisrabbiners Wetzlar von 1838 (Artikel von
1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 14. Januar 1927:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 14. Januar 1927: |
Zeugnis für Kreisrabbiner Wetzlar (1849)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 19. Februar
1849: "Durch die neue Einteilung Kurhessens in neun Bezirke haben die
Regierungen aufgehört, wie auch die Kreisämter, und an deren Stelle sind
Verwaltungsämter und obere Verwaltungsämter getreten, letztere mit Namen
Bezirksvorstand. Der Rabbiner Wetzlar hat von der Regierung zu
Kassel, welche am 1. Februar aufgehört hat, noch zuvor folgende
anerkennende Zuschrift erhalten: Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 19. Februar
1849: "Durch die neue Einteilung Kurhessens in neun Bezirke haben die
Regierungen aufgehört, wie auch die Kreisämter, und an deren Stelle sind
Verwaltungsämter und obere Verwaltungsämter getreten, letztere mit Namen
Bezirksvorstand. Der Rabbiner Wetzlar hat von der Regierung zu
Kassel, welche am 1. Februar aufgehört hat, noch zuvor folgende
anerkennende Zuschrift erhalten:
'Dem Kreisrabbiner Markus Gerson Wetzlar zu Gudensberg wird
hiedurch das Zeugnis erteilt, dass derselbe während seiner ganzen
Dienstzeit regen Eifer in Erfüllung seiner Dienstpflichten und in dem
Bestreben im Kreise seiner Wirksamkeit allseitig nach Überzeugung und Kräften
nützlich zu sein, bewiesen, auch persönlich stets das Beispiel eine
untadelhaften Lebenswandels gegeben hat.
Kassel, den 27. Januar 1849. Kurf. Reg. der Prov. Niederhessen. Giesler.
L.S.'" |
Über die jüdische Gemeinde und Rabbiner Mordechai
Wetzlar (1852)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. November 1852: "Meine
Reise führte mich nach Gudensberg. Von der Gemeinde und ihren
Institutionen wüsste ich weiter Nichts zu berichten, als dass sie eine
sehr schöne Synagoge besitzt, die in vielen Beziehungen, jedoch in sehr
verjüngtem Maßstabe, der Kasseler nachgebildet ist. Sehr treffend sind
die Inschriften zu den beiden Seiten der heiligen Lade gewählt, rechts: 'Dauer
der Tage ist in ihrer Rechten, links: in ihrer Linken Reichtum und
Ehre' (Sprüche 3,16).
Desto mehr lässt sich aber von dem dortigen Kreisrabbinen Herrn
Wetzlar sagen: strenge Religiosität, unermüdliche Tätigkeit,
unbegrenzte Menschenliebe, das sind die Grundzüge seines Charakters. Ich
kenne diesen ehrenwerten Mann schon seit vielen Jahren und gründet sich
also mein Urteil nicht auf den augenblicklichen günstigen Eindruck, den
jemand auf uns beim ersten Besuche machte. Die ihm untergebenen Lehrer
hegen die tiefste Hochachtung gegen ihn, denn er ist stets für ihr Wohl
bedacht und dabei zeigt er das größte Interesse für die Schulen. So
sollen auch die israelitischen Lehrer der Provinz Niederhessen seinen Bemühungen
die ihnen dieses Jahr gewordene Teuerungszulage zu verdanken haben. Zu
jeder Zeit hat er eine kleine Schar fremder und einheimischer Knaben und Jünglinge
um sich versammelt, denen er Unterricht im Talmud und den verwandten
Schriften erteilt, so erfüllt er auch hierin die schönste Aufgabe eines
jüdischen geistlichen. – Dich ich beabsichtige hier durchaus nicht den
Panegyristen (sc. Lobredner) dieses Mannes zu machen und wird mir seine
Bescheidenheit sogar für diese kleine Skizze wenig Dank wissen." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. November 1852: "Meine
Reise führte mich nach Gudensberg. Von der Gemeinde und ihren
Institutionen wüsste ich weiter Nichts zu berichten, als dass sie eine
sehr schöne Synagoge besitzt, die in vielen Beziehungen, jedoch in sehr
verjüngtem Maßstabe, der Kasseler nachgebildet ist. Sehr treffend sind
die Inschriften zu den beiden Seiten der heiligen Lade gewählt, rechts: 'Dauer
der Tage ist in ihrer Rechten, links: in ihrer Linken Reichtum und
Ehre' (Sprüche 3,16).
Desto mehr lässt sich aber von dem dortigen Kreisrabbinen Herrn
Wetzlar sagen: strenge Religiosität, unermüdliche Tätigkeit,
unbegrenzte Menschenliebe, das sind die Grundzüge seines Charakters. Ich
kenne diesen ehrenwerten Mann schon seit vielen Jahren und gründet sich
also mein Urteil nicht auf den augenblicklichen günstigen Eindruck, den
jemand auf uns beim ersten Besuche machte. Die ihm untergebenen Lehrer
hegen die tiefste Hochachtung gegen ihn, denn er ist stets für ihr Wohl
bedacht und dabei zeigt er das größte Interesse für die Schulen. So
sollen auch die israelitischen Lehrer der Provinz Niederhessen seinen Bemühungen
die ihnen dieses Jahr gewordene Teuerungszulage zu verdanken haben. Zu
jeder Zeit hat er eine kleine Schar fremder und einheimischer Knaben und Jünglinge
um sich versammelt, denen er Unterricht im Talmud und den verwandten
Schriften erteilt, so erfüllt er auch hierin die schönste Aufgabe eines
jüdischen geistlichen. – Dich ich beabsichtige hier durchaus nicht den
Panegyristen (sc. Lobredner) dieses Mannes zu machen und wird mir seine
Bescheidenheit sogar für diese kleine Skizze wenig Dank wissen." |
25-jähriges Dienstjubiläum von Kreisrabbiner Mordechai
Wetzlar (1855)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Mai 1855: "Aus
Kurhessen, im Mai (1855). Am 18. vorigen Monats wurde zu Gudensberg das fünfundzwanzigjährige
Amtsjubiläum des dasigen Rabbinen Herrn M. Wetzlar gefeiert. Nicht bloß
von seiner Gemeinde und von seinen kreisen, i welchen er die ganzen 25
Jahre gewirkt, nein, aus nahen und fernen Kreisen – Hessens? Nein, auch
Deutschlands, und sogar aus fernen Weltteilen sind dem würdigen Jubilar
Zeichen der Liebe und Verehrung geworden. Man weiß seine echte Religiosität,
die weder in großer Beschaulichkeit, noch in eitlem Wortgepränge,
vielmehr in der eifrigsten und aufopferndsten Tätigkeit, und das nicht
nur für seine Pflegbefohlenen, sondern auch für Alle, die aus der Nähe
und Ferne seinen Rat und seine Hilfe suchen, sich kund gibt, - wohl zu schätzen,
und der Wunsch, dass er noch recht lange, lange leben und fürs Judentum
wirksam sein möge, findet weit und breit ein lautes Echo. – B.W." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Mai 1855: "Aus
Kurhessen, im Mai (1855). Am 18. vorigen Monats wurde zu Gudensberg das fünfundzwanzigjährige
Amtsjubiläum des dasigen Rabbinen Herrn M. Wetzlar gefeiert. Nicht bloß
von seiner Gemeinde und von seinen kreisen, i welchen er die ganzen 25
Jahre gewirkt, nein, aus nahen und fernen Kreisen – Hessens? Nein, auch
Deutschlands, und sogar aus fernen Weltteilen sind dem würdigen Jubilar
Zeichen der Liebe und Verehrung geworden. Man weiß seine echte Religiosität,
die weder in großer Beschaulichkeit, noch in eitlem Wortgepränge,
vielmehr in der eifrigsten und aufopferndsten Tätigkeit, und das nicht
nur für seine Pflegbefohlenen, sondern auch für Alle, die aus der Nähe
und Ferne seinen Rat und seine Hilfe suchen, sich kund gibt, - wohl zu schätzen,
und der Wunsch, dass er noch recht lange, lange leben und fürs Judentum
wirksam sein möge, findet weit und breit ein lautes Echo. – B.W." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juni 1855:
"Aus Kurhessen, im Mai (1855). Die patriarchalische Eintracht, die in
früheren Zeiten zwischen Gemeinde und Rabbiner geherrscht, ist jetzt
leider so häufig gewichen und an deren Stelle sind nicht selten
Misshelligkeiten und Streitigkeiten aller Art getreten, ... dass es jeden
Freund des Judentums hoch erfreuen muss, auch einmal von beweisen der
Anhänglichkeit und der innigsten Verehrung seitens der Gemeinde gegen
ihren Rabbiner zu vernehmen. - Aus diesem Grunde erlauben wir uns über
ein schönes, erhebendes Fest, das am 18. vorigen Monats in Gudensberg
bei Kassel gefeiert ward, in diesen viel gelesenen Blättern zu
berichten. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juni 1855:
"Aus Kurhessen, im Mai (1855). Die patriarchalische Eintracht, die in
früheren Zeiten zwischen Gemeinde und Rabbiner geherrscht, ist jetzt
leider so häufig gewichen und an deren Stelle sind nicht selten
Misshelligkeiten und Streitigkeiten aller Art getreten, ... dass es jeden
Freund des Judentums hoch erfreuen muss, auch einmal von beweisen der
Anhänglichkeit und der innigsten Verehrung seitens der Gemeinde gegen
ihren Rabbiner zu vernehmen. - Aus diesem Grunde erlauben wir uns über
ein schönes, erhebendes Fest, das am 18. vorigen Monats in Gudensberg
bei Kassel gefeiert ward, in diesen viel gelesenen Blättern zu
berichten.
Am genannten Tage waren es gerade 25 Jahre, seitdem der Kreisrabbiner Herr
Wetzlar dortselbst sein Amt angetreten hat. Es waren daher zu diesem Tage
Schüler, Freunde und Verehrer des Herrn Wetzlar von allen Seiten, von Nah
und Fern, herbeigeströmt; Gratulationsbriefe, Gedichte und Geschenke
langten aus den verschiedensten, mitunter sehr fernen Orten an. Auch vom
Landrabbinate, sowie vom Vorsteheramte zu Kassel erfolgten amtliche
Anerkennungsschreiben. Die Reihe der Festlichkeiten am 18. eröffneten
mehrere gut geleitete Gesänge, durch welche der Jubilar in früher
Morgenstunde überrascht ward. Darauf füllten Deputationen,
Glückwünsche und Geschenke darbringend, vom Morgen bis Mittag das Haus.
Nachmittags vereinigte ein Festessen im Rathaussaale den Jubilar und seine
Freunde. Beim Eintritt in den festlich dekorierten Saal ward der Gefeierte
abermals durch Gesänge und den Vortrag eines Festgedichtes begrüßt;
hierauf hielt der Herr Kreisvorsteher eine Anrede, in welcher er im Namen
des Kreises, der Gemeinde und der zahlreichen Anwesenden seine Gefühle
und Glückwünsche ausdrückte. Zugleich überreichte derselbe als
Angebinde ein Wertpapier im Betrage von 200 Talern nebst einem silbernen
Kandelaber; die Lehrer des Kreises überreichten eine goldene Kette, die
Schulkinder einen prachtvollen Sessel. Die Chawera (Wohltätigkeitsverein),
sowie noch einige Gemeinden des Kreises übergaben ebenfalls wertvolle
Geschenke. Die verschiedensten Toaste in gebundener und freier Rede, von
welchen der erste dem Landesherrn galt, würzten das Mahl. Alles hatte sch
beeifert, dem Feste so viel Glanz als möglich zu verleihen; die ganze
Stadt hatte ein festliches Gewand angelegt." |
Rabbiner Wetzlar muss sich mit einer Beschwerde gegen
den antisemitisch eingestellten Pfarrer von Winne beschäftigen
(1863)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. August 1863:
"Aus Kurhessen, 7. August (1863). Am 31. vorigen Monats wurde
dem kurhessischen Landrabbinate (bestehend aus den 4 Provinzialrabbinern,
dem Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg und noch einigen
wissenschaftlich-gebildeten Israeliten) eine Beschwerde mitgeteilt, nach
welcher der Pfarrer Solden zu Winne (Kreis Marburg) am 5. Juli dieses
Jahres in seiner Predigt vor versammelter Gemeinde sprach: 'Kein Jude
würde sich ein Gewissen daraus machen, wenn er alle Christen vergiften
könnte, denn sie stehen nicht mit uns auf gleichem Boden'. Zum Text
seiner Predigt soll er Petri 2,1 gehabt haben. 'So legt nun ab alle
Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden' -
gerade ein Vers, nach welchem er solches hätte unterlassen müssen. Vom
Landrabbinate, als Vertreterin der beleidigten Juden und des Judentums in
Kurhessen, wird nun erwartet, dass solchem Treiben energisch
entgegengetreten und der Vorfall der Justizbehörde zur Untersuchung
übergeben werde. - Nach dem Kirchenrechte vom 12. Juli 1657 und Kap. 2,
§ 11 ist alles Schmähen und Lästern auf den Kanzeln untersagt und nach
§ 9 des Gesetzes vom 29. Oktober 1848 sind Schmähungen Andersgläubiger
zur Bestrafung vor die ordentlichen Gerichte zu bringen.
Z." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. August 1863:
"Aus Kurhessen, 7. August (1863). Am 31. vorigen Monats wurde
dem kurhessischen Landrabbinate (bestehend aus den 4 Provinzialrabbinern,
dem Kreisrabbiner Wetzlar zu Gudensberg und noch einigen
wissenschaftlich-gebildeten Israeliten) eine Beschwerde mitgeteilt, nach
welcher der Pfarrer Solden zu Winne (Kreis Marburg) am 5. Juli dieses
Jahres in seiner Predigt vor versammelter Gemeinde sprach: 'Kein Jude
würde sich ein Gewissen daraus machen, wenn er alle Christen vergiften
könnte, denn sie stehen nicht mit uns auf gleichem Boden'. Zum Text
seiner Predigt soll er Petri 2,1 gehabt haben. 'So legt nun ab alle
Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden' -
gerade ein Vers, nach welchem er solches hätte unterlassen müssen. Vom
Landrabbinate, als Vertreterin der beleidigten Juden und des Judentums in
Kurhessen, wird nun erwartet, dass solchem Treiben energisch
entgegengetreten und der Vorfall der Justizbehörde zur Untersuchung
übergeben werde. - Nach dem Kirchenrechte vom 12. Juli 1657 und Kap. 2,
§ 11 ist alles Schmähen und Lästern auf den Kanzeln untersagt und nach
§ 9 des Gesetzes vom 29. Oktober 1848 sind Schmähungen Andersgläubiger
zur Bestrafung vor die ordentlichen Gerichte zu bringen.
Z." |
Über das fromme Gudensberg unter Kreisrabbiner Wetzlar
(1865)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus
Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres
geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,
während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich
erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen
Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein
sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur
durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht
aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man
bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der
Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern
die Neuerungssucht begünstigt wird. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus
Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres
geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,
während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich
erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen
Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein
sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur
durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht
aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man
bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der
Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern
die Neuerungssucht begünstigt wird.
Wenden wir unseren Blick hingegen nach den Kreisen Fritzlar und Melsungen,
so sehen wir ein schon erfreulicheres Gemälde sich vor unseren Augen
aufrollen, denn diese beiden Kreise stehen unter der Führung eines
wahrhaft frommen und gottesfürchtigen Mannes, unter der des Kreisrabbinen
Wetzlar zu Gudensberg, welcher nun schon seit ca. 35 Jahren mit
seltener Berufstätigkeit und Aufopferung dahin strebt, in seinem
Wirkungskreise wahres Judentum und aufrichtige Gottesfurcht zu fördern.
So hat er schon seit vielen Jahren eine ziemlich beträchtliche Anzahl
Schüler um sich versammelt, welche er in die Gefilde der Tora einführt,
und sie mit liebenswürdiger Freundlichkeit, oft mit Hintansetzung seiner
eigenen Interessen, in ihrem Streben unterstützt.
Besonders erfreut sich Gudensberg in Folge seines frommen Eifers
eines sehr regen gottesfürchtigen Sinnes. Während z.B. in sehr vielen
anderen Gemeinden nur am Sabbat das Gotteshaus geöffnet wird, wir hier
täglich morgens und abends durch ordnungsvollen Gottesdienst Gott
verherrlicht, trotzdem die Gemeinde nur aus ca. 34 Familien besteht. Neben
diesen beiden Grundpfeilern des Judentums - Tora und Gottesdienst -
ist auch der dritte nicht ohne Pflege geblieben. So bestehen hier unter
der Leitung des Rabbiners drei Chebrot (Vereine), welche Wohltätigkeit
sich zur Aufgabe gemacht haben, und die ihrem Zwecke durchaus
entsprechen.
Als Gegenstück hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra,
im Kreise Rotenburg anführen. Hier hält man es für Bildung und
Aufklärung, wenn man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge
wurden bei der im vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die
der Frauengalerie umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft
empörend zu sehen, wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause
korrespondieren und kokettieren. Hoffen wir, dass bei dem demnächstigen
Besetzung des Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen
werde, der nicht einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." |
Zum Tod von Rabbiner Mordechai Wetzlar (1878)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1879:
"Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1879:
"Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden.
Mainz, 30. Dezember 1878. Es ist eine herbe Trauerkunde, welche die
Überschrift unseren geehrten Lesern verkündet. Einer der Edelsten,
Besten, Vorzüglichsten ist von dem Schauplatze seiner irdischen
Tätigkeit abberufen worden! Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in
Frieden - war am Anfange dieses Jahrhunderts zu Fulda, der Hauptstadt
des gleichnamigen Fürstentums, welches später dem Kurfürstentum Hessen
zugeteilt wurde, geboren. Schon als kleines Kind war er von einem
wunderbaren Eifer für das Torastudium beseelt, und dieser Eifer war von
den glänzendsten Geistesanlagen unterstützt. Der siebenjährige Knabe
erhob sich in der größten Winterkälte nachts um zwei Uhr von seinem
Lager, um seinen Lehrer zu wecken, damit dieser mit ihm 'lerne'. Da seine
Eltern in nicht sehr guten Vermögensumständen sich befanden, so musste
der Knabe oftmals die Küche besorgen, während die Eltern ihren
Geschäften nachgingen; aber auch am Kochherde ließ er die geliebte Gemara
nicht aus der Hand. Kaum 14 Jahre alt, ging er nach Hanau, um bei dem
dortigen Rabbiner, dem berühmten Rabbi Moscheh Tobiah Sondheimer - das
Andenken an den Gerechten und Heiligen ist zum Segen, seine Studien
fortzusetzen. Der kleine Knabe besaß bereits ein so ausgebreitetes
Wissen, dass man ihm nicht glauben wollte, dass er erst 14 Jahre zähle.
Er wurde bald der Lieblingsschüler seines großen Lehrers, den er sich
auch in Bezug auf dessen Betragen zum Muster nahm. So fastete er 40
Fasten-Tage vor dem Versöhnungstage, abends zum Imbiss
nichts als Kartoffeln mit Salz zu sich nehmend. Jahraus, jahrein ging er
tagtäglich in die Mikwe, selbst dann, wenn eine Eiskruste das Wasser
bedeckte. Aber nicht diese asketische Lebensweise war ihm Hauptsache,
sondern das fleißige Lernen, und so kam es, dass er von seinem großen
Lehrer das Rabbiner-Diplom erhielt, als er kaum 19 Jahre zählte.
Nun erst fing er an, auch in den profanen Wissenschaften sich gediegene
Kenntnisse zu erwerben. Unterdes war eine Zeit herangebrochen, die dem
Judentume nicht günstig war. Überall erhob die sogenannte Reform das
Haupt, und die vieltausendjährige Lehre unseres Gottes sollte
umgestaltet, verfälscht, vernichtet werden.
Um diese Zeit wurde Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden -
zum Rabbinen des Kreises Fritzlar ernannt; da aber die
israelitischen Bewohner der Kreishauptstadt in ihrer Lebensweise sich dem
echten Judentume entfremdet hatten, so zog es der junge Rabbiner vor,
seinen Wohnsitz in einem Dorfe, Gudensberg aufzuschlagen, weil in
diesem Dorfe eine fromme jüdische Gemeinde sich befand und Gott sei Dank,
noch heute sich befindet.
Die Wirksamkeit, die Rabbi Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden -
an diesem kleinen Orte entfaltete, zu schildern, ist unsere Feder zu
schwach. Nicht allein, dass er unablässig Schüler um sich sammelte, die
er für die Tora und für das echte, jüdische Leben begeisterte, nicht allein, dass er der Freund, der Berater, der liebevolle Vater seiner
Glaubensgenossen in dem von ihm verwaltete Kreisrabbinat wurde, er wurde,
wenn auch nicht dem Namen nach, so doch tatsächlich der
Oberlandesrabbiner des Kurfürstentums Hessen, da sein Einfluss der
weitgehendste war und Alle, die ihn kannten, Reich und Arm, Vornehm und
Gering, Alt und Jung, Jude und Nichtjude, mit unbeschreiblicher Liebe und
Verehrung an ihm hingen. Niemand konnte sich dem Zauber seiner
Persönlichkeit entziehen; war er doch die personifizierte Güte und
Sanftmut! Wenn es aber die heilige Religion Israels betrag, so entwickelte
der ehrwürdige, liebevolle, sanfte, gutherzige Mann, einen Eifer, eine
Energie, die alle Hindernisse überwand und alle bösen Regungen, die sich
seinem Blicke zeigten, im Keime erstickten.
Nachdem er 46 Jahre lang auf seinem Posten ausgeharrt hatte, entschloss er
sich, zu seinen Kindern nach Frankfurt am Main zu übersiedeln, wo sich
ihm, nachdem ihm auch viel Leid widerfahren war, der Abend seines Lebens
recht sonnig gestaltete. Er starb, wie er gelebt hatte: sanft, gottergeben
- bis zum letzten Augenblicke im vollen Besitze seiner Geisteskräfte.
Nach Eingang des zweiten Sabbat Chanukah wurde er in einem Alter von 78 Jahren
und 3 Monaten von hinnen gerufen. Wiewohl erst nach Ausgang des Sabbats
der Telegraph die Trauerkunde verbreiten konnte, |
 waren
doch Freunde und Schüler selbst aus weiter Ferne herbeigeeilt. waren
doch Freunde und Schüler selbst aus weiter Ferne herbeigeeilt.
Die Beerdigung fand gestern Nachmittag statt. Im Trauerhause sprach der
Schwiegersohn des Heimgegangenen, Herr Rabbinatsassessor Lange aus
Halberstadt, tief ergreifende Worte der Trauer und des Schmerzes; beweinte
er doch in ihm den Vater, Freund und Lehrer. Der Bahre folgte eine
unübersehbare Menge, namentlich waren aus dem ehemaligen Kurfürstentume
Hessen alle Glaubensgenossen herbeigeströmt, zu denen die Kunde gedrungen
war. Wir nennen Herrn Provinzialrabbiner Dr. Munk aus Marburg und Herrn
Rabbiner Dr. Ehrmann aus Kassel.
Aus dem Friedhofe sprach zuerst Herr Direktor Dr. M. Hirsch im Auftrage
und in Vertretung seines ehrwürdigen Vaters - er ruhe in Frieden -, der
Unwohlseins halber nur eine kurze Strecke der Bahre hatte folgen können.
Der Redner knüpfte an die Erzählung der Weisen von dem Tode des Rabbi Jehuda
ha Kadosch an, dem Gefühle des größten Schmerzes und der innigsten
Trauer würdigen Ausdruck gebend. Darauf sprach der Herausgeber dieser
Blätter, anlehnend an die Worte der Sidrah (1. Buch Mose Kap. 43,11-14),
die Größe des Verlustes schildernd, welchen die Judenheit erfahren. Als
dritter Redner sprach Herr Provinzialrabbiner Dr. Cahn aus Fulda, an den
Chanukkaleuchter anknüpfend und die Art und Weise der Lichtspendung
desselben auf den Verewigten anwendend. Darauf hob Herr Rabbiner Dr. Marx
aus Darmstadt hervor, dass der seiner Friedensliebe halber berühmte,
teure Tote nichtsdestoweniger rücksichtslos seinen Prinzipien treu
geblieben, aus der Gemeinde ausgeschieden und deshalb auf dem von der
israelitischen Religionsgesellschaft angelegten Separat-Friedhofe begraben
werde. - Mit wenigen, aber gediegenen Worten rühmte zum Schlusse Herr
Emanuel Schwarzschild, Vorsteher der israelitischen Religionsgesellschaft
zu Frankfurt am Main, die große Bescheidenheit des Verewigten, die
derselbe namentlich dadurch bewährt hatte, dass er, nachdem er 46 Jahre
lang an der Spitze eines Kreisrabbinates gestanden, in Frankfurt nichts
Anderes hat sein, als nichts Anderes hat gelten wollen als ein einfaches
Mitglied der israelitischen Religionsgesellschaft.
So ist denn wieder Einer dahingegangen von den Männern, auf die unser
Geschlecht mit stolzer Freude blicken durfte. Diese Freude ist in Trauer
umgewandelt worden. Möge der allgütige Gott das heranwachsende
Geschlecht begnadigen, dass wieder Männer erstehen, welche die große
Lücke auszufüllen imstande seien. Dazu wird auch das Gedenken an Rabbi
Mordechai Wetzlar - er ruhe in Frieden - beitragen. Das Gedenken
an den Gerechten ist zum Segen." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Januar 1879: "Aus
Hessen. Auf Ersuchen einiger Gemeindemitglieder aus Gudensberg
erklärte sich Herr Rabbiner Dr. Ehrmann aus Kassel anfangs Januar bereit,
zu Ehren des verstorbenen Rabbiners Wetzlar - das Gedenken an den
Gerechten und Heiligen ist zum Segen - eine Trauerrede am 12.
Januar in der Gudensberger Synagoge abzuhalten. Die Leute gingen von der
Idee aus, dass nur ein solcher Mann diem Trauerrede würdig halten
könnte, welcher in dem Sinne spricht, in welchem der Verblichene - seligen
Andenkens - gelebt hat. Es wurde dies den Gemeinden der Kreise Fritzlar
und Melsungen, welche zum Rabbinat
desselben gehörten, mitgeteilt, mit dem Ersuchen, dass sie sich in der
Gudensberger Synagoge einfinden sollten. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Januar 1879: "Aus
Hessen. Auf Ersuchen einiger Gemeindemitglieder aus Gudensberg
erklärte sich Herr Rabbiner Dr. Ehrmann aus Kassel anfangs Januar bereit,
zu Ehren des verstorbenen Rabbiners Wetzlar - das Gedenken an den
Gerechten und Heiligen ist zum Segen - eine Trauerrede am 12.
Januar in der Gudensberger Synagoge abzuhalten. Die Leute gingen von der
Idee aus, dass nur ein solcher Mann diem Trauerrede würdig halten
könnte, welcher in dem Sinne spricht, in welchem der Verblichene - seligen
Andenkens - gelebt hat. Es wurde dies den Gemeinden der Kreise Fritzlar
und Melsungen, welche zum Rabbinat
desselben gehörten, mitgeteilt, mit dem Ersuchen, dass sie sich in der
Gudensberger Synagoge einfinden sollten.
Am 11. Januar erhielt einer der Gudensberger Gemeindeältesten vom
Vorsteheramt der Israeliten in Kassel folgendes Schreiben:
Nr. 30. I.V.A.Pr. Herr Landrabbiner Dr. Adler wird zum Andenken an
den verstorbenen Kreisrabbiner Wetzlar nächsten Sonntag den 12. dieses
Monats nachmittags einen Trauergottesdienst abhalten und das
unterzeichnete Vorsteheramt bei dieser Feier wo tunlich sich vertreten
lassen. Wir setzen Sie zur schleunigen Benachrichtigung sämtlicher
Gemeindemitglieder mit dem Anfügen hiervon in Kenntnis, dass zur
Abhaltung einer Trauerrede in der dortigen Synagoge nur Herr Landrabbiner
Dr. Adler berechtigt ist. Kassel, den 10. Januar 1879. Vorsteheramt der
Israeliten: Budwig. vdt. Berger. An den Gemeindeältesten Herrn Najel in
Gudensberg." |
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer und der jüdischen Schule
Beiträge von Lehrer J. Rülf über "Ein Wort über die israelitische Lehre
der Neuzeit" und über "Sonst und jetzt" (1852)
Die Beiträge erschienen in der Zeitschrift "Der treue
Zionswächter" (1852) - zum Lesen bitte Textabbildungen
anklicken
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Artikel in der
Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 17. August und 10.
September 1852
über "Ein Wort über die israelitische Lehre der Neuzeit" |
Artikel
in der Zeitschrift "Der treue
Zionswächter" vom 29. Oktober
1852
über "Sonst und jetzt" |
| |
100 Jahre Israelitische Volksschule in Gudensberg
(1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. Dezember 1927:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. Dezember 1927: |
Erinnerung von Lehrer Perlstein an die Mitglieder der Israelitischen
Lehrerkonferenz Hessens (1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 20. April 1928:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 20. April 1928: |
Lehrer Hermann Stern kommt an Stelle von Bernhard Perlstein nach Gudensberg
(1928)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1928: "Niedenstein, 10.
Juni (1928). Die hiesige Israelitische Volksschule, welche nur noch von 6
Kindern besucht wird, wurde von der Regierung aufgelöst und der Lehrer
Stern anstelle des in den Ruhestand versetzten Lehrers B. Perlstein nach
Gudensberg versetzt." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1928: "Niedenstein, 10.
Juni (1928). Die hiesige Israelitische Volksschule, welche nur noch von 6
Kindern besucht wird, wurde von der Regierung aufgelöst und der Lehrer
Stern anstelle des in den Ruhestand versetzten Lehrers B. Perlstein nach
Gudensberg versetzt." |
Lehrer Bernhard Perlstein tritt in den Ruhestand (1928)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 2. März 1928: "Gudensberg (Hessen).
(Persönliches). Lehrer Perlstein, der mehr als drei Jahrzehnte in unserer
Gemeinde als Lehrer und Kantor wirkte, hat infolge Erreichung der
Altersgrenze die erbetene Versetzung in den Ruhestand
erhalten."
Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 2. März 1928: "Gudensberg (Hessen).
(Persönliches). Lehrer Perlstein, der mehr als drei Jahrzehnte in unserer
Gemeinde als Lehrer und Kantor wirkte, hat infolge Erreichung der
Altersgrenze die erbetene Versetzung in den Ruhestand
erhalten."
Anmerkung: ob sich die nachfolgende Zusammenstellung der Vorträge auf
Gudensberg bezieht, ist unklar. |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 24. Februar 1928: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 24. Februar 1928: |
| |
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Juli 1928:
Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Juli 1928: |
Zum Tod von Lehrer Bernhard Perlstein
(1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1928: "Gudensberg,
4. November (1928). Ein tragisches Geschick wollte es, dass kurz nach
seiner Pensionierung Lehrer Bernhard Perlstein in Berlin, wohin er vor
kurzem übergesiedelt war, verschied. Der Verstorbene war 34 Jahre hier am
Orte tätig und genoss Wertschützung nicht allein in jüdischen Kreisen,
sondern auch bei den anderen Konfessionen. Das bewiesen die Ämter, die er
jahrelang bekleidete, die Ämter als Schiedsmann und Stadtverordneter. Im
Vereinsleben war er führend. Die Hilfskasse 'Esra' verdankt ihm ihre
derzeitige Blüte. Auch in der Schule und im Kultusdienst stand er seinen
Mann. Er war ein Vorbild an Pflichttreue. Sein hilfsbereites Wesen
eroberte ihm die Herzen aller, die ihn kannten. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1928: "Gudensberg,
4. November (1928). Ein tragisches Geschick wollte es, dass kurz nach
seiner Pensionierung Lehrer Bernhard Perlstein in Berlin, wohin er vor
kurzem übergesiedelt war, verschied. Der Verstorbene war 34 Jahre hier am
Orte tätig und genoss Wertschützung nicht allein in jüdischen Kreisen,
sondern auch bei den anderen Konfessionen. Das bewiesen die Ämter, die er
jahrelang bekleidete, die Ämter als Schiedsmann und Stadtverordneter. Im
Vereinsleben war er führend. Die Hilfskasse 'Esra' verdankt ihm ihre
derzeitige Blüte. Auch in der Schule und im Kultusdienst stand er seinen
Mann. Er war ein Vorbild an Pflichttreue. Sein hilfsbereites Wesen
eroberte ihm die Herzen aller, die ihn kannten. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. November 1928:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. November 1928: |
| |
 Anzeigen in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. November 1928: Anzeigen in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. November 1928: |
Lehrer Bernhard Perlstein wird in Berlin beigesetzt
(1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 9. November 1928: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 9. November 1928: |
Chanukkafeier der jüdischen Schule
(1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. Dezember 1931: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. Dezember 1931: |
Aus dem jüdischen Gemeinde- und
Vereinsleben
Dreifacher Raubmord in Gudensberg (1875)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1875:
"Gudensberg, 9. Dezember (1875). Gestern wurde dahier ein
grässliches Verbrechen begangen; es wurde nämlich ein dreifacher
Raubmord an dem hochbetagten Kaufmann Elias, dessen Frau und
Dienstmädchen verübt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1875:
"Gudensberg, 9. Dezember (1875). Gestern wurde dahier ein
grässliches Verbrechen begangen; es wurde nämlich ein dreifacher
Raubmord an dem hochbetagten Kaufmann Elias, dessen Frau und
Dienstmädchen verübt."
Gudensberg, 12. Dezember 1875: Heute fand unter allseitiger Beteiligung die Beerdigung der drei Ermordeten
statt. Der Mörder, ein Knecht auf einem Bauernhofe, ist ergriffen.
Merkwürdigerweise brach der Kassenschlüssel, dessen er sich ermächtigt
hatte, ab, sodass der ganze Raub in vier Talern bestand. Der selige Elias
zählte 88 Jahre; seine Frau war jünger. Ihre Seelen seien eingebunden
in den Bund des Lebens." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Dezember 1875:
"Gudensberg. Über die Ermordung des Herrn Elias und dessen Ehefrau
sowie deren Dienstmädchen gehen uns noch nachfolgende Einzelheiten zu.
Die Tat ist jedenfalls noch vor Abends 10 Uhr vollbracht worden, da die
ganze Nacht über die Haustür unverschlossen, und die Stubenlampe
umgelöscht geblieben. Der Mann wurde erschlagen im Bett, die Frau
erstochen im Lehnstuhl vorgefunden. Das Dienstmädchen war mit einer
Näharbeit beschäftigt, als der Tod aus Mörderhand sie erreichte. Der
Mörder hat als ganze Ausbeute der entsetzlichen Tat 4 Taler mitgenommen,
die sich im Zimmer in einem Pulte befanden, das von ihm erbrochen wurde.
Er ist bereits in der Person des Knechtes Vinzon aus Waldensberg (Kolonie)
bei Hanau ermittelt und verhaftet worden. Blutspuren an seinen
Kleidungsstücken und in dem Bette desselben führten zur Entdeckung.
Vinzon trug die Hosenträger des Ermordeten. Er ist ein robuster Mensch
und von hünenhafter Erscheinung. Es liegt gegründete Vermutung vor, es
habe der Mörder den Abend der Tat bei Frau Elias und dem Dienstmädchen
rauchend in dem Zimmer zugebracht. Diese beiden Opfer sollen, wie man
nachträglich konstatiert, nicht erstocken, sondern gleich Kaufmann Elias,
welcher eine Treppe hoch zu Bette lag, mit einem Küferhammer erschlagen
worden sein. Die Auffindung jenes Hammers, welcher genau in die drei
Wunden passte, soll die Entdeckung beschleunigt haben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Dezember 1875:
"Gudensberg. Über die Ermordung des Herrn Elias und dessen Ehefrau
sowie deren Dienstmädchen gehen uns noch nachfolgende Einzelheiten zu.
Die Tat ist jedenfalls noch vor Abends 10 Uhr vollbracht worden, da die
ganze Nacht über die Haustür unverschlossen, und die Stubenlampe
umgelöscht geblieben. Der Mann wurde erschlagen im Bett, die Frau
erstochen im Lehnstuhl vorgefunden. Das Dienstmädchen war mit einer
Näharbeit beschäftigt, als der Tod aus Mörderhand sie erreichte. Der
Mörder hat als ganze Ausbeute der entsetzlichen Tat 4 Taler mitgenommen,
die sich im Zimmer in einem Pulte befanden, das von ihm erbrochen wurde.
Er ist bereits in der Person des Knechtes Vinzon aus Waldensberg (Kolonie)
bei Hanau ermittelt und verhaftet worden. Blutspuren an seinen
Kleidungsstücken und in dem Bette desselben führten zur Entdeckung.
Vinzon trug die Hosenträger des Ermordeten. Er ist ein robuster Mensch
und von hünenhafter Erscheinung. Es liegt gegründete Vermutung vor, es
habe der Mörder den Abend der Tat bei Frau Elias und dem Dienstmädchen
rauchend in dem Zimmer zugebracht. Diese beiden Opfer sollen, wie man
nachträglich konstatiert, nicht erstocken, sondern gleich Kaufmann Elias,
welcher eine Treppe hoch zu Bette lag, mit einem Küferhammer erschlagen
worden sein. Die Auffindung jenes Hammers, welcher genau in die drei
Wunden passte, soll die Entdeckung beschleunigt haben." |
Erinnerungen an jüdisches Leben und Bräuche in
Gudensberg und Orten der Umgebung von Dr. Samuel Blach (1924)
Anmerkung: im Abschnitt wird über jüdische Bräuche bei Geburt und
Beschneidung (Bris), Verlobung, Hochzeit und Tod berichtet. Auch auf
Synagogengebräuche und Hausgebräuche wie Ess-Sitten wird eingegangen. Neben
Gudensberg wird auch von Bräuchen aus Reichensachsen,
Rhina, Meimbressen
und Braunfels berichtet.
Artikel in der
Zeitschrift "Menorah"
Jahrgang 1926 Heft 10 Seiten 583-590
(zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken) |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Artikel in der
"Jüdischen Wochenzeitung
für Kassel, Kurhessen und Waldeck"
vom 6. und 13. Juli 1928
(zum Lesen bitte
Textabbildungen anklicken) |
 |
 |

|
 |
Jahresversammlung des Israelitischen Frauenvereins
(1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. März 1927: "Gudensberg. Die
Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins fand am
Stiftungstag, Rosch Chodesch Adar II, statt. Der Verein wurde vor 88
Jahren von dem damaligen Kreisrabbiner Wetzlar gegründet. Nach dem
von dem Rechnungsführer des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein,
mitgeteilten Jahresbericht zählt der Verein 41 Mitglieder. Derselbe
konnte trotz der Ungunst der Zeiten im vergangenen Jahre zirka 500 Mark
für die verschiedensten humanitären Zwecke zur Verteilung bringen.
P." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. März 1927: "Gudensberg. Die
Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins fand am
Stiftungstag, Rosch Chodesch Adar II, statt. Der Verein wurde vor 88
Jahren von dem damaligen Kreisrabbiner Wetzlar gegründet. Nach dem
von dem Rechnungsführer des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein,
mitgeteilten Jahresbericht zählt der Verein 41 Mitglieder. Derselbe
konnte trotz der Ungunst der Zeiten im vergangenen Jahre zirka 500 Mark
für die verschiedensten humanitären Zwecke zur Verteilung bringen.
P." |
Ein Gerichtsverfahren wird eingestellt
(1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. März 1927: "Gudensberg. Das
Verfahren eingestellt. Eine Angelegenheit, die weit über die Grenzen
unserer Stadt durch törichte und unwahre Ausstreuungen verbreitet wurde,
hat vorläufig ihr Ende gefunden. Frühere Gemeindeälteste der
israelitischen Gemeinden hatten den Verwalter einer Spende, die zur
Erneuerung und Ausschmückung der hiesigen Synagoge bestimmt war, bei der
Staatsanwaltschaft wegen Unterschlagung angezeigt. Nach Mitteilung der
Staatsanwaltschaft ist das Verfahren eingestellt. Ert." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. März 1927: "Gudensberg. Das
Verfahren eingestellt. Eine Angelegenheit, die weit über die Grenzen
unserer Stadt durch törichte und unwahre Ausstreuungen verbreitet wurde,
hat vorläufig ihr Ende gefunden. Frühere Gemeindeälteste der
israelitischen Gemeinden hatten den Verwalter einer Spende, die zur
Erneuerung und Ausschmückung der hiesigen Synagoge bestimmt war, bei der
Staatsanwaltschaft wegen Unterschlagung angezeigt. Nach Mitteilung der
Staatsanwaltschaft ist das Verfahren eingestellt. Ert." |
Die finanzielle Notlage der jüdischen Landgemeinden wird immer schwieriger (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. Juli 1927: "Gudensberg. Man schreibt
uns: Die finanzielle Notlage unserer meisten jüdischen Landgemeinden wird
eine immer größere. Im schreienden Gegensatz zu derselben steht die
immer höher werdende Belastung durch Kultussteuern. Während in den
Großstädten zur Aufbringung der Kultussteuern in der Regel 10 bis 15
Prozent der Einkommenssteuer erhoben werden, beträgt in vielen
Landgemeinden der Prozentsatz 70 bis 100 Prozent; in einigen Gemeinden sogar
weit über 100 Prozent, trotz Subventionen des Vorsteheramtes und des
Landesverbandes für besonders notleidende Gemeinden. Dieser Zustand ist
für die Zukunft unhaltbar und erfordert ein sofortiges tatkräftiges
Eingreifen der in Betracht kommenden Instanzen, wenn die Kleingemeinden
überhaupt noch weiterbestehen sollen. Eine traurige Folge der hohen
Kultussteuern sind die sich mehrenden Austritte aus der Synagogengemeinde.
Um diesen Austritten einen Damm entgegenzusetzen, sah sich unsere
Gemeinde zu folgendem einstimmig gefassten Beschluss gezwungen:
'Stirbt ein Mitglied einer aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde
ausgetretenen Familie, so hat dasselbe nur dann Anspruch auf ein
Begräbnis auf dem hiesigen jüdischen Friedhof, wenn für dasselbe die
seit dem Tage des erfolgten Austritts unbezahlten Kultussteuern, laufend
bis zum Begräbnistag, von dem gesetzlichen Vertreter der ausgetretenen
Familie in die Kasse der hiesigen israelitischen Gemeinde nachgezahlt
werden. Die Berechnung der Rückzahlung erfolgt nach der von dem
jeweiligen Gemeinderechnungsführer aufgestellten Heberolle, in
welcher die aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde Ausgetretenen
namentlich und nach ihrer Einkommenssteuer alljährlich aufzuführen sind.
Mindestens aber muss für den Verstorbenen einer ausgetretenen Familie ein
Begräbnisgeld von 500 Mark in die hiesige jüdische Gemeindekasse
gezahlt werden. Ein anderer Nachtrag, der gleichfalls das Ziel
verfolgt, die Steuerflucht durch den Austritt zu erschweren, liegt der
nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vor. Der Antrag lautet:
'Auf die Pachtung eines Platzes in hiesiger Synagoge hat nur derjenige
Anspruch, der sich vor der Verpachtung schriftlich verpflicht, die
während der betreffenden Pachtperiode auf ihn entfallenden Kultussteuern
zu zahlen.'"
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. Juli 1927: "Gudensberg. Man schreibt
uns: Die finanzielle Notlage unserer meisten jüdischen Landgemeinden wird
eine immer größere. Im schreienden Gegensatz zu derselben steht die
immer höher werdende Belastung durch Kultussteuern. Während in den
Großstädten zur Aufbringung der Kultussteuern in der Regel 10 bis 15
Prozent der Einkommenssteuer erhoben werden, beträgt in vielen
Landgemeinden der Prozentsatz 70 bis 100 Prozent; in einigen Gemeinden sogar
weit über 100 Prozent, trotz Subventionen des Vorsteheramtes und des
Landesverbandes für besonders notleidende Gemeinden. Dieser Zustand ist
für die Zukunft unhaltbar und erfordert ein sofortiges tatkräftiges
Eingreifen der in Betracht kommenden Instanzen, wenn die Kleingemeinden
überhaupt noch weiterbestehen sollen. Eine traurige Folge der hohen
Kultussteuern sind die sich mehrenden Austritte aus der Synagogengemeinde.
Um diesen Austritten einen Damm entgegenzusetzen, sah sich unsere
Gemeinde zu folgendem einstimmig gefassten Beschluss gezwungen:
'Stirbt ein Mitglied einer aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde
ausgetretenen Familie, so hat dasselbe nur dann Anspruch auf ein
Begräbnis auf dem hiesigen jüdischen Friedhof, wenn für dasselbe die
seit dem Tage des erfolgten Austritts unbezahlten Kultussteuern, laufend
bis zum Begräbnistag, von dem gesetzlichen Vertreter der ausgetretenen
Familie in die Kasse der hiesigen israelitischen Gemeinde nachgezahlt
werden. Die Berechnung der Rückzahlung erfolgt nach der von dem
jeweiligen Gemeinderechnungsführer aufgestellten Heberolle, in
welcher die aus der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde Ausgetretenen
namentlich und nach ihrer Einkommenssteuer alljährlich aufzuführen sind.
Mindestens aber muss für den Verstorbenen einer ausgetretenen Familie ein
Begräbnisgeld von 500 Mark in die hiesige jüdische Gemeindekasse
gezahlt werden. Ein anderer Nachtrag, der gleichfalls das Ziel
verfolgt, die Steuerflucht durch den Austritt zu erschweren, liegt der
nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vor. Der Antrag lautet:
'Auf die Pachtung eines Platzes in hiesiger Synagoge hat nur derjenige
Anspruch, der sich vor der Verpachtung schriftlich verpflicht, die
während der betreffenden Pachtperiode auf ihn entfallenden Kultussteuern
zu zahlen.'" |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. Juli 1927: "Gudensberg. Zu dem Bericht in
voriger Nummer unserer Zeitung wird uns noch mitgeteilt, dass die in
Gudensberg ausgetretenen Mitglieder der Gemeinde nicht aus steuerlichen
Gründen ausgetreten sind, wie in dem Bericht der Anschein erweckt werden
konnte." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. Juli 1927: "Gudensberg. Zu dem Bericht in
voriger Nummer unserer Zeitung wird uns noch mitgeteilt, dass die in
Gudensberg ausgetretenen Mitglieder der Gemeinde nicht aus steuerlichen
Gründen ausgetreten sind, wie in dem Bericht der Anschein erweckt werden
konnte." |
Jahresversammlung des Israelitischen Frauenvereins
(1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 24. Februar 1928: "Gudensberg. Am
ersten Abend Rausch Chaudesch Adar fand im 'Hessischen Hof' dahier die
Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins statt.
Derselbe tritt in sein 90. Stiftungsjahr und dürfte wohl in seiner Art
mit der älteste des Bezirks sein. Er bezweckt an erster Stelle die
Unterstützung der Armen und Hilfsbedürftigen hiesiger Gemeinde,
Verpflegung der Kranken, Wachen bei denselben, sowie die Erfüllung aller
Pflichten, welche die Mitglieder bei Sterbefällen zu betätigen haben.
Die Statuten atmen ganz den frommen Sinn des talmudkundigen, und ehrwürdigen
Verfassers, des bekannten Kreisrabbiners Rebbe Mordechai Wetzlar.
Unser heutiges Judentum, besonders das in der Großstadt, glaubt voll und
ganz seine jüdische Gemillus-chesed-Pflicht (Pflicht zur Wohltätigkeit)
erfüllt zu haben, wenn es in die für diese Zwecke vorgesehenen
Vereinskassen seine vorgeschriebenen Beiträge zahlt. Man hat angeblich
meistens keine Zeit, sich persönlich in den Dienst dieser Mizwoh
(religiöse Pflicht) zu stellen. Dazu hat man ja 'seine Leute', die dafür
bezahlt werden. Anders auf dem Lande. Da stellt sich jedes Mitglied mit
seiner ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Gemillus-chesed-Pflicht.
Jeder greift mit seiner persönlichen Hilfeleistung da ein, wo es eben
erforderlich ist, und wohin man ihn beruft. Dieses persönliche Zugreifen
und Betätigen ist etwas Selbstverständliches. Es ist vielleicht in
mancher jüdischen Kleingemeinde die einzige fromme Tradition, an der man
noch mit alter jüdischer Pietät zäh festhält, eine Mizwoh, die man
gern und willig nach ältestem Väterbrauch ausübt, und die man, trotz
des herrschenden religiösen Indifferentismus, in religiöser Innigkeit
hochhält. Dieser jüdische Chesedgeist hat sich traditionell auch im
hiesigen jüdischen Frauenverein erhalten. Nach dem vom Rechnungsführer
des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein, erstatteten Jahresbericht
zählt der Verein 40 Mitglieder. Drei Mitglieder sind im Vereinsjahr durch
Tod entrissen, während ein Mitglied neu hinzugetreten ist. Die
Unterstützungen für Einzelpersonen und jüdische Anstalten betrugen im
vergangenen Vereinsjahr zirka 850 Mark. Der bisherige Vorstand, Frau
Amalie Adler, Frau Berta Katz und Frau Isabella Mansbach wurden
einstimmig wiedergewählt. Möge der Verein weiter blühen und gedeihen
und getreulich all die heiligen Aufgaben erfüllen, die ihm sein frommer
Gründer vor fast 90 Jahren gestellt hat. P." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 24. Februar 1928: "Gudensberg. Am
ersten Abend Rausch Chaudesch Adar fand im 'Hessischen Hof' dahier die
Jahresversammlung des hiesigen israelitischen Frauenvereins statt.
Derselbe tritt in sein 90. Stiftungsjahr und dürfte wohl in seiner Art
mit der älteste des Bezirks sein. Er bezweckt an erster Stelle die
Unterstützung der Armen und Hilfsbedürftigen hiesiger Gemeinde,
Verpflegung der Kranken, Wachen bei denselben, sowie die Erfüllung aller
Pflichten, welche die Mitglieder bei Sterbefällen zu betätigen haben.
Die Statuten atmen ganz den frommen Sinn des talmudkundigen, und ehrwürdigen
Verfassers, des bekannten Kreisrabbiners Rebbe Mordechai Wetzlar.
Unser heutiges Judentum, besonders das in der Großstadt, glaubt voll und
ganz seine jüdische Gemillus-chesed-Pflicht (Pflicht zur Wohltätigkeit)
erfüllt zu haben, wenn es in die für diese Zwecke vorgesehenen
Vereinskassen seine vorgeschriebenen Beiträge zahlt. Man hat angeblich
meistens keine Zeit, sich persönlich in den Dienst dieser Mizwoh
(religiöse Pflicht) zu stellen. Dazu hat man ja 'seine Leute', die dafür
bezahlt werden. Anders auf dem Lande. Da stellt sich jedes Mitglied mit
seiner ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Gemillus-chesed-Pflicht.
Jeder greift mit seiner persönlichen Hilfeleistung da ein, wo es eben
erforderlich ist, und wohin man ihn beruft. Dieses persönliche Zugreifen
und Betätigen ist etwas Selbstverständliches. Es ist vielleicht in
mancher jüdischen Kleingemeinde die einzige fromme Tradition, an der man
noch mit alter jüdischer Pietät zäh festhält, eine Mizwoh, die man
gern und willig nach ältestem Väterbrauch ausübt, und die man, trotz
des herrschenden religiösen Indifferentismus, in religiöser Innigkeit
hochhält. Dieser jüdische Chesedgeist hat sich traditionell auch im
hiesigen jüdischen Frauenverein erhalten. Nach dem vom Rechnungsführer
des Vereins, Herrn Lehrer Perlstein, erstatteten Jahresbericht
zählt der Verein 40 Mitglieder. Drei Mitglieder sind im Vereinsjahr durch
Tod entrissen, während ein Mitglied neu hinzugetreten ist. Die
Unterstützungen für Einzelpersonen und jüdische Anstalten betrugen im
vergangenen Vereinsjahr zirka 850 Mark. Der bisherige Vorstand, Frau
Amalie Adler, Frau Berta Katz und Frau Isabella Mansbach wurden
einstimmig wiedergewählt. Möge der Verein weiter blühen und gedeihen
und getreulich all die heiligen Aufgaben erfüllen, die ihm sein frommer
Gründer vor fast 90 Jahren gestellt hat. P." |
Veranstaltung der Sinai-Loge Kassel in Gudensberg
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. März 1929: "Gudensberg. Am Sonnabend,
23. Februar, abends, fand ein selten genussreicher Abend in Gudensberg
statt. Als Veranstalter galt, wie Herr Dessauer - Kassel eingangs
erwähnte, die Sinai-Loge. Ihr Bestreben, das geistig-jüdische
Leben auf dem Lande zu fördern, fand vollste Anerkennung. Herr Lehrer
Bacher aus Kassel sprach über synagogale Musik. Seine
Ausführungen, die sehr treffend und interessant waren, fanden bei den
Zuhörern die größte Aufmerksamkeit. Im Anschluss daran sang Frau Dr.
Gotthilf einige jüdische Lieder und musste nachher auf Verlangen noch
einige Zugaben spenden, so ausgezeichnet gefiel sie. Der allgemeine
Beifall, den die Veranstaltung fand, hat gezeigt, welches Interesse
solchen Abenden entgegengebracht wird. Unser aller Dank gilt den Damen und
Herren, die ihre freie Zeit in den Dienst dieser Sache stellen. Nicht
zuletzt auch Herrn Lehrer Stern hier, dem wir wohl diesen schönen
Abend zu verdanken hatten. Mögen die Damen und Herren bald wieder einmal
kommen. Herzlichsten Empfangs können sie versichert sein."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. März 1929: "Gudensberg. Am Sonnabend,
23. Februar, abends, fand ein selten genussreicher Abend in Gudensberg
statt. Als Veranstalter galt, wie Herr Dessauer - Kassel eingangs
erwähnte, die Sinai-Loge. Ihr Bestreben, das geistig-jüdische
Leben auf dem Lande zu fördern, fand vollste Anerkennung. Herr Lehrer
Bacher aus Kassel sprach über synagogale Musik. Seine
Ausführungen, die sehr treffend und interessant waren, fanden bei den
Zuhörern die größte Aufmerksamkeit. Im Anschluss daran sang Frau Dr.
Gotthilf einige jüdische Lieder und musste nachher auf Verlangen noch
einige Zugaben spenden, so ausgezeichnet gefiel sie. Der allgemeine
Beifall, den die Veranstaltung fand, hat gezeigt, welches Interesse
solchen Abenden entgegengebracht wird. Unser aller Dank gilt den Damen und
Herren, die ihre freie Zeit in den Dienst dieser Sache stellen. Nicht
zuletzt auch Herrn Lehrer Stern hier, dem wir wohl diesen schönen
Abend zu verdanken hatten. Mögen die Damen und Herren bald wieder einmal
kommen. Herzlichsten Empfangs können sie versichert sein." |
Feier zum 90-jährigen Bestehen des Israelitischen Frauenvereins
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 22. März 1929: "Gudensberg. Am
16. März (4. Adar) beging der hiesige Israelitische Frauenverein
die Feier seines 90-jährigen Bestehens. Wie alljährlich, so wurde
zunächst der Rechenschaftsbericht erstattet. Nach erfolgter Abrechnung
setzte der offizielle Teil der Feier ein, eingeleitet durch einen Prolog.
Alsdann hielt Lehrer Stern die Festrede. Im Geiste ließ er die
Mitglieder eine Wanderung durch die Entwicklungsgeschichte des Vereins
antreten und gedachte zunächst der Gründer und Gründerinnen,
insbesondere des verstorbenen Herrn Kreisrabbiners Wetzlar seligen
Andenkens, der die Oberaufsicht über den Verein führte. Desgleichen
wurden die Verdienste der verewigten Kollegen Blach und Perlstein
gebührend gewürdigt, wie auch aller Damen, die im Laufe der Jahre die
Geschicke des Vereins geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine
Jubiläumsspende gegründet, die Armen und Bedrängten zukommen soll. In
großen Umrissen wies Redner auf die großzügigen Hilfeleistungen des
Vereins hin, der stets getreu seinem Ziele Armen und Notleidenden zur
Seite stand. In dem Gelöbnis, im Geiste der Gründer zu wirken und so
deren Andenken zu ehren, schloss der Referent mit den besten
Segenswünschen für den Verein, ausklingend in den Worten: 'Edel sei der
Mensch, hilfreich und gut'."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 22. März 1929: "Gudensberg. Am
16. März (4. Adar) beging der hiesige Israelitische Frauenverein
die Feier seines 90-jährigen Bestehens. Wie alljährlich, so wurde
zunächst der Rechenschaftsbericht erstattet. Nach erfolgter Abrechnung
setzte der offizielle Teil der Feier ein, eingeleitet durch einen Prolog.
Alsdann hielt Lehrer Stern die Festrede. Im Geiste ließ er die
Mitglieder eine Wanderung durch die Entwicklungsgeschichte des Vereins
antreten und gedachte zunächst der Gründer und Gründerinnen,
insbesondere des verstorbenen Herrn Kreisrabbiners Wetzlar seligen
Andenkens, der die Oberaufsicht über den Verein führte. Desgleichen
wurden die Verdienste der verewigten Kollegen Blach und Perlstein
gebührend gewürdigt, wie auch aller Damen, die im Laufe der Jahre die
Geschicke des Vereins geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine
Jubiläumsspende gegründet, die Armen und Bedrängten zukommen soll. In
großen Umrissen wies Redner auf die großzügigen Hilfeleistungen des
Vereins hin, der stets getreu seinem Ziele Armen und Notleidenden zur
Seite stand. In dem Gelöbnis, im Geiste der Gründer zu wirken und so
deren Andenken zu ehren, schloss der Referent mit den besten
Segenswünschen für den Verein, ausklingend in den Worten: 'Edel sei der
Mensch, hilfreich und gut'." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. April 1929: "Gudensberg,
1. April (1929). Der hiesige Frauenverein beging die Feier seines
90-jährigen Bestehens. Der offizielle Teil der Feier wurde eingeleitet
durch einen Prolog. In seiner Festrede ging Herr Lehrer Stern auf die
Entwicklungsgeschichte des Vereins ein. Er gedachte zunächst des
verstorbenen Kreisrabbiners Wetzlar, dann der Verdienste der Lehrer Bloch
und Perlstein, wie auch aller Damen, die die Geschicke des Vereins
geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine Jubiläumsspende gegründet, die
Armen und Bedrängten zukommen soll." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. April 1929: "Gudensberg,
1. April (1929). Der hiesige Frauenverein beging die Feier seines
90-jährigen Bestehens. Der offizielle Teil der Feier wurde eingeleitet
durch einen Prolog. In seiner Festrede ging Herr Lehrer Stern auf die
Entwicklungsgeschichte des Vereins ein. Er gedachte zunächst des
verstorbenen Kreisrabbiners Wetzlar, dann der Verdienste der Lehrer Bloch
und Perlstein, wie auch aller Damen, die die Geschicke des Vereins
geleitet haben. Gleichzeitig wurde eine Jubiläumsspende gegründet, die
Armen und Bedrängten zukommen soll." |
Vortragsabend über Gudensberger Familiennamen
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Gudensberg. Am
Samstagabend, den 8. Dezember, hielt Lehrer Horwitz (Kassel) hier
einen Vortrag über alte Gudensberger Familienamen. Zunächst sprach er
über Familiennamen im allgemeinen, um dann auf die Gudensberger
Familiennamen zu kommen. Wie stets stellte Herr Horwitz auch dieses Mal
seinen Mann. In fesselnder Weise verstand er es, die zahlreichen Zuhörer
bis zum letzten Augenblicke mitzureißen. Das bewiesen auch die vielen
Fragen, die im Anschluss an den Vortrag an H. gerichtet wurden. Wir
hoffen, Herrn H. recht bald wieder in unserer Mitte begrüßen zu können.
St." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Gudensberg. Am
Samstagabend, den 8. Dezember, hielt Lehrer Horwitz (Kassel) hier
einen Vortrag über alte Gudensberger Familienamen. Zunächst sprach er
über Familiennamen im allgemeinen, um dann auf die Gudensberger
Familiennamen zu kommen. Wie stets stellte Herr Horwitz auch dieses Mal
seinen Mann. In fesselnder Weise verstand er es, die zahlreichen Zuhörer
bis zum letzten Augenblicke mitzureißen. Das bewiesen auch die vielen
Fragen, die im Anschluss an den Vortrag an H. gerichtet wurden. Wir
hoffen, Herrn H. recht bald wieder in unserer Mitte begrüßen zu können.
St." |
Vortragsabend der Sinai-Loge Kassel in Gudensberg
(1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 5. März 1930:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 5. März 1930: |
Purimball des Israelitischen Frauenvereins (1930)
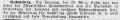 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. März 1930: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. März 1930: |
Chanukkafeier des Israelitischen Frauenvereins
(1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Gudensberg. Am
Schabbos Chanukah fand von Seiten des Frauenvereins die allmonatliche
Zusammenkunft in Verbindung mit einer Chanukahfeier statt. Nach einem
Prolog hieß Lehrer Stern alle Anwesenden in seiner
Begrüßungsansprache herzlich willkommen, wies insbesondere die Kinder
auf die Bedeutung des Chanukahfestes hin und betonte dabei, dass in dieser
schweren Zeit uns diese Feier über die Sorgen und den Ernst des Lebens
für kurze Zeit hinweghelfen solle. Von den Kindern wurde alsdann ein
Singspiel aufgeführt, das Chanukahmännchen, das allgemeinen Beifall
fand. Das Chanukahmännchen teilte den Kindern reiche Gaben aus. Ein Reim,
eingeübt von Fräulein Bachmann zu Kassel, bildete den Abschluss
des offiziellen Teiles. In recht froher Stimmung blieben alt und jung noch
einige Stunden beisammen."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Gudensberg. Am
Schabbos Chanukah fand von Seiten des Frauenvereins die allmonatliche
Zusammenkunft in Verbindung mit einer Chanukahfeier statt. Nach einem
Prolog hieß Lehrer Stern alle Anwesenden in seiner
Begrüßungsansprache herzlich willkommen, wies insbesondere die Kinder
auf die Bedeutung des Chanukahfestes hin und betonte dabei, dass in dieser
schweren Zeit uns diese Feier über die Sorgen und den Ernst des Lebens
für kurze Zeit hinweghelfen solle. Von den Kindern wurde alsdann ein
Singspiel aufgeführt, das Chanukahmännchen, das allgemeinen Beifall
fand. Das Chanukahmännchen teilte den Kindern reiche Gaben aus. Ein Reim,
eingeübt von Fräulein Bachmann zu Kassel, bildete den Abschluss
des offiziellen Teiles. In recht froher Stimmung blieben alt und jung noch
einige Stunden beisammen." |
Jahresversammlung des Frauenvereins - Gedenkfeier für
die Gefallenen des Weltkrieges (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 6. März 1931: "Gudensberg. Am 11. Adar fand
die Jahresversammlung des Frauenvereins statt. Lehrer Stern
erstattete den Jahresbericht. Der Verein zählt 39 Mitglieder. Der
bisherige Vorstand, der bisher dem Verein stets großes Interesse
entgegenbrachte, wurde wiedergewählt. - Am vergangenen Schabbos fand hier
eine Gedenkfeier für die Gefallenen statt. Ins einer Rede wies Lehrer
Stern darauf hin, dass wir am besten das Andenken dieser Teuren ehren
könnten, wenn wir bestrebt seien, alle Gegensätze unter uns zu
überbrücken."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 6. März 1931: "Gudensberg. Am 11. Adar fand
die Jahresversammlung des Frauenvereins statt. Lehrer Stern
erstattete den Jahresbericht. Der Verein zählt 39 Mitglieder. Der
bisherige Vorstand, der bisher dem Verein stets großes Interesse
entgegenbrachte, wurde wiedergewählt. - Am vergangenen Schabbos fand hier
eine Gedenkfeier für die Gefallenen statt. Ins einer Rede wies Lehrer
Stern darauf hin, dass wir am besten das Andenken dieser Teuren ehren
könnten, wenn wir bestrebt seien, alle Gegensätze unter uns zu
überbrücken." |
Berichte über
einzelne Personen aus der Gemeinde
Zum 75. Geburtstag von Kaufmann L. Hahn (1925)
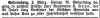 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1925:
"Gudensberg, 3. März (1925). Seinen 75. Geburtstag beging in
größter Frische Herr Kaufmann L. Hahn, der 30 Jahre lang Vorsteher der
jüdischer Gemeinde war und dieses Amt zu aller Zufriedenheit versehen
hatte." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1925:
"Gudensberg, 3. März (1925). Seinen 75. Geburtstag beging in
größter Frische Herr Kaufmann L. Hahn, der 30 Jahre lang Vorsteher der
jüdischer Gemeinde war und dieses Amt zu aller Zufriedenheit versehen
hatte." |
84. Geburtstag von Jakob Mansbach I
(1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. Februar 1927:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. Februar 1927: |
Zum Tod von Jonas Kander (1927 in Gudensberg; bis um
1910 Gemeindeältester in Riede)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. Februar 1927: "Gudensberg. Am 3. Februar
dieses Jahres starb dahier im 83. Lebensjahre nach dreiwöchiger schwerer
Krankheit der Privatier Jonas Kander. Die Heimat desselben war das
anderthalb Stunden von her gelegene, zum Kreis Wolfhagen gehörige Dorf Riede.
Hier versah der Verstorbene jahrzehntelang die Geschäfte eines
Gemeindeältesten und war bestrebt, alle jüdischen Pflichten aufs
peinlichste zu erfüllen. So hatte derselbe unter anderem für Sabbat und
Feiertage jahrelang einen Gottesdienst mit Minjan in seinem Hause
eingerichtet. Religiöse Gründen waren es besonders, die den Verstorbenen
veranlassten, vor etwa siebzehn Jahren nach hier zu ziehen. Kander
zeichnete sich besonders durch sein friedfertiges, einfach-bescheidenes
Wesen aus, und wegen seiner großen Reellität in allen geschäftlichen
Angelegenheiten erfreute sich derselbe in den weitesten Kreisen größter
Achtung und Beliebtheit. Wohl selten sah unser Ort bei einer Beerdigung
ein solch großes Trauergefolge. An der Bahre des Verstorbenen hielt Herr
Lehrer Perlstein einen tiefempfundenen, würdigen
Nachruf." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. Februar 1927: "Gudensberg. Am 3. Februar
dieses Jahres starb dahier im 83. Lebensjahre nach dreiwöchiger schwerer
Krankheit der Privatier Jonas Kander. Die Heimat desselben war das
anderthalb Stunden von her gelegene, zum Kreis Wolfhagen gehörige Dorf Riede.
Hier versah der Verstorbene jahrzehntelang die Geschäfte eines
Gemeindeältesten und war bestrebt, alle jüdischen Pflichten aufs
peinlichste zu erfüllen. So hatte derselbe unter anderem für Sabbat und
Feiertage jahrelang einen Gottesdienst mit Minjan in seinem Hause
eingerichtet. Religiöse Gründen waren es besonders, die den Verstorbenen
veranlassten, vor etwa siebzehn Jahren nach hier zu ziehen. Kander
zeichnete sich besonders durch sein friedfertiges, einfach-bescheidenes
Wesen aus, und wegen seiner großen Reellität in allen geschäftlichen
Angelegenheiten erfreute sich derselbe in den weitesten Kreisen größter
Achtung und Beliebtheit. Wohl selten sah unser Ort bei einer Beerdigung
ein solch großes Trauergefolge. An der Bahre des Verstorbenen hielt Herr
Lehrer Perlstein einen tiefempfundenen, würdigen
Nachruf." |
80. Geburtstag des Kriegsveteranen Levi Hahn (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. Juli 1927: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. Juli 1927: |
Auszeichnungen des Roten Kreuzes und Firmenjubiläum
(1927)
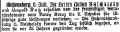 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juli 1927:
"Gudensberg, 6. Juli (1927). Die Herren Julius Naschelsky und Leopold
Katz erhielten von der freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz die
2. Schnüre für 15-jährige gute Leistungen verliehen. - Die
Fahrradhandlung J. Naschelsky konnte den Tag festlich begehen, an dem sie
vor 25 Jahren gegründet wurde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juli 1927:
"Gudensberg, 6. Juli (1927). Die Herren Julius Naschelsky und Leopold
Katz erhielten von der freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz die
2. Schnüre für 15-jährige gute Leistungen verliehen. - Die
Fahrradhandlung J. Naschelsky konnte den Tag festlich begehen, an dem sie
vor 25 Jahren gegründet wurde." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. Juli 1927: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. Juli 1927: |
| |
 links:
Anzeige von J. Naschelsky (Ausstellung in der ehemaligen Synagoge) links:
Anzeige von J. Naschelsky (Ausstellung in der ehemaligen Synagoge) |
89. / 90. Geburtstag von Mathilde Mansbach in Maden
(1927 / 1928)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 30. Dezember 1927:
Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 30. Dezember 1927: |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. Dezember 1928: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. Dezember 1928: |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1929: "Gudensberg,
23. Dezember (1928). Ihren 90. Geburtstag begeht heute in seltener
körperlicher Rüstigkeit und Geistesfrische Frau Mansbach im nahen Maden.
Die Greisin erfreut sich allgemeiner Beliebtheit und hat noch ein
vorzügliches Gedächtnis. Sie erinnert sich noch gut der Vorgänge aus
alten kurhessischen Zeiten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1929: "Gudensberg,
23. Dezember (1928). Ihren 90. Geburtstag begeht heute in seltener
körperlicher Rüstigkeit und Geistesfrische Frau Mansbach im nahen Maden.
Die Greisin erfreut sich allgemeiner Beliebtheit und hat noch ein
vorzügliches Gedächtnis. Sie erinnert sich noch gut der Vorgänge aus
alten kurhessischen Zeiten." |
Suizid der Witwe N. (1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Februar 1928:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Februar 1928: |
Zum Tod von Jakob Mambach I und zum 77. Geburtstag von Michel Lilienfeld (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1928: "Gudensberg,
6. September (1928). Im vollendeten 86. Lebensjahr verschied hier
Handelsmann Jakob Mambach I, Kriegsveteran von 1866 und 1870/71. Der
Kriegerverein, dessen ältestes Mitglied der Verstorbene war, gab ihm das
Geleit. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1928: "Gudensberg,
6. September (1928). Im vollendeten 86. Lebensjahr verschied hier
Handelsmann Jakob Mambach I, Kriegsveteran von 1866 und 1870/71. Der
Kriegerverein, dessen ältestes Mitglied der Verstorbene war, gab ihm das
Geleit.
Gudensberg, 5. September (1928). Seinen 77. Geburtstag beging in größter
Rüstigkeit und Geistesfrische Herr Michel Lilienfeld
dahier." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. September 1928: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. September 1928: |
82. Geburtstag des Kriegsveteranen Levi Hahn
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 5. Juli 1929:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 5. Juli 1929: |
Die letzte jüdische Familie Madens ist nach Gudensberg
verzogen (1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 19. September 1930: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 19. September 1930: |
80. Geburtstag von Michael Lilienfeld (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. August 1931:
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. August 1931: |
Persönlichkeiten
Rabbiner Dr. Hermann Engelberg (1830-1900)
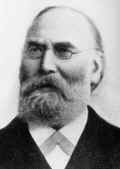 Anmerkung:
Dr.
Hermann Engelbert ist am 29.7.1830 in Gudensberg geboren. Er studierte
zunächst bei Rabbiner Wetzlar in seiner Heimatstadt, später in
Würzburg; ab 1852 Studium in Berlin, 1856 in Marburg. 1857 war er
Prediger und Religionslehrer in Elberfeld, ab Sommer 1861 Prediger und
Religionslehrer in München. Seit dem 1. August 1866 war er als
Rabbiner in St. Gallen tätig, wo er
1900 verstorben ist. Anmerkung:
Dr.
Hermann Engelbert ist am 29.7.1830 in Gudensberg geboren. Er studierte
zunächst bei Rabbiner Wetzlar in seiner Heimatstadt, später in
Würzburg; ab 1852 Studium in Berlin, 1856 in Marburg. 1857 war er
Prediger und Religionslehrer in Elberfeld, ab Sommer 1861 Prediger und
Religionslehrer in München. Seit dem 1. August 1866 war er als
Rabbiner in St. Gallen tätig, wo er
1900 verstorben ist. |
 Artikel zum Tod von Rabbiner Dr. Engelberg in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Februar 1900: "St.
Gallen, 10. Februar (1900). Die hiesige israelitische Religionsgesellschaft hat
einen schweren Verlust durch den Tod ihres Seelsorgers, Rabbiner Dr. Engelbert,
erlitten, der nah ganz kurzer Krankheit am 5. einer heftigen Lungenentzündung
erlag. Im Jahre 1830 geboren, machte der Verewigte seine Studien in Würzburg,
Marburg und Berlin, und wurde nach Beendigung derselben als Rabbiner nach
Elberfeld gewählt. Im Jahre 1866, als die hiesige israelitische Gemeinde gegründet
wurde und man das Bedürfnis nach einem Seelsorger fühlte, der der neuen
aufgeklärten Richtung huldigte, wurde derselbe nach St. Gallen berufen und hat
bis zu seinem Tode mit seltener Hingebung seinem Berufe obgelegen und durch
seinen Einfluss und seine Liebenswürdigkeit, sowie durch die schöne Tugend,
jede religiöse Überzeugung zu achten, den Frieden der Gemeinde gefördert und
sich allgemeiner Achtung und Ehrerbietung erfreut. Durch seine Anregung gab es
Anlass zur Schaffung verschiedener Wohltätigkeitsvereine in der Gemeinde und
war stets auf seinem Posten, wenn es galt, Armen und Bedrängten beizustehen.
Aber nicht nur in seiner Not zu lindern suchen, sondern auch in unserer Stadt beteiligte er sich an ähnlichen
Bestrebungen und war ein tätiges Kommissionsmitglied der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Hilfsvereins und des Kinderhorts, an deren Gedeihen er regen
Anteil nahm. Sein liebenswürdiges und bescheidenes Auftreten verschaffte ihm
die Achtung aller, die ihn kannten, und viele Freunde und Bekannte werden ihn
noch lange vermissen und sein Andenken in Ehren halten. – Engelbert hat in früheren
Jahren vielfach literarisch sich betätigt. Von ihm erschienen: ‚Das negative
Verdienst des Alten Testaments um die Unsterblichkeitslehre’, ‚Ist das Schächten
der Tiere nach jüdischem Ritus wirklich Tierquälerei?’, ‚Statistik des
Judentums im Deutschen Reiche’ usw. Er war in seiner Gemeinde sehr beliebt und
gehörte der freisinnigen Richtung innerhalb des Judentums an. Er ruhe in
Frieden." Artikel zum Tod von Rabbiner Dr. Engelberg in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Februar 1900: "St.
Gallen, 10. Februar (1900). Die hiesige israelitische Religionsgesellschaft hat
einen schweren Verlust durch den Tod ihres Seelsorgers, Rabbiner Dr. Engelbert,
erlitten, der nah ganz kurzer Krankheit am 5. einer heftigen Lungenentzündung
erlag. Im Jahre 1830 geboren, machte der Verewigte seine Studien in Würzburg,
Marburg und Berlin, und wurde nach Beendigung derselben als Rabbiner nach
Elberfeld gewählt. Im Jahre 1866, als die hiesige israelitische Gemeinde gegründet
wurde und man das Bedürfnis nach einem Seelsorger fühlte, der der neuen
aufgeklärten Richtung huldigte, wurde derselbe nach St. Gallen berufen und hat
bis zu seinem Tode mit seltener Hingebung seinem Berufe obgelegen und durch
seinen Einfluss und seine Liebenswürdigkeit, sowie durch die schöne Tugend,
jede religiöse Überzeugung zu achten, den Frieden der Gemeinde gefördert und
sich allgemeiner Achtung und Ehrerbietung erfreut. Durch seine Anregung gab es
Anlass zur Schaffung verschiedener Wohltätigkeitsvereine in der Gemeinde und
war stets auf seinem Posten, wenn es galt, Armen und Bedrängten beizustehen.
Aber nicht nur in seiner Not zu lindern suchen, sondern auch in unserer Stadt beteiligte er sich an ähnlichen
Bestrebungen und war ein tätiges Kommissionsmitglied der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Hilfsvereins und des Kinderhorts, an deren Gedeihen er regen
Anteil nahm. Sein liebenswürdiges und bescheidenes Auftreten verschaffte ihm
die Achtung aller, die ihn kannten, und viele Freunde und Bekannte werden ihn
noch lange vermissen und sein Andenken in Ehren halten. – Engelbert hat in früheren
Jahren vielfach literarisch sich betätigt. Von ihm erschienen: ‚Das negative
Verdienst des Alten Testaments um die Unsterblichkeitslehre’, ‚Ist das Schächten
der Tiere nach jüdischem Ritus wirklich Tierquälerei?’, ‚Statistik des
Judentums im Deutschen Reiche’ usw. Er war in seiner Gemeinde sehr beliebt und
gehörte der freisinnigen Richtung innerhalb des Judentums an. Er ruhe in
Frieden." |
Rabbiner Dr. Moses Engelbert (1830-1891)
| Rabbiner Dr. Moses Engelbert ist am
18.6.1830 als Sohn des Kaufmanns Hermann Engelbert in Gudensberg geboren.
Er studierte - wie der gleichaltrige Hermann Engelbert s.o. - zunächst
bei Rabbiner Wetzlar in seiner Heimatstadt, später in Würzburg, dann in
Frankfurt/Main; ab 1852 Studium in Göttingen, 1855 in Jena. 1855
Religionslehrer und Prediger in Waren (Mecklenburg-Schwerin), 1857
Prediger und Lehrer in Toruń (Thorn, Westpreußen), 1860 Rabbiner in
Kołobrzeg (Kolberg, Pommern); seit 1862 Bezirksrabbiner in Lehrensteinsfeld
- Verlegung des Rabbinatssitzes 1864 nach Heilbronn, 1889 krankheitshalber
Ruhestand, gest. 1891 in Heilbronn. |
 Artikel zum Tod von Rabbiner Dr. Moses Engelbert in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar 1891: "Heilbronn,
18. Januar (1891). Gestern Abend verschied nach schweren leiden der
hochgeachtete Rabbiner Dr. Moses Engelbert im Alter von 60 Jahren. Er ist
geboren in Gudensberg (statt Gutenberg) bei Kassel und war vorher
Rabbiner in Kolberg, Waren und seit 1863 in hiesigem Rabbinatsbezirk.
Schon seit mehreren Jahren leidend, wurde ihm als Hilfsgeistlicher Dr. B.
Einstein aus Ulm beigegeben. Das Andenken des Dahingeschiedenen wird hier
in in weiteren Kreisen ein gesegnetes
bleiben". Artikel zum Tod von Rabbiner Dr. Moses Engelbert in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar 1891: "Heilbronn,
18. Januar (1891). Gestern Abend verschied nach schweren leiden der
hochgeachtete Rabbiner Dr. Moses Engelbert im Alter von 60 Jahren. Er ist
geboren in Gudensberg (statt Gutenberg) bei Kassel und war vorher
Rabbiner in Kolberg, Waren und seit 1863 in hiesigem Rabbinatsbezirk.
Schon seit mehreren Jahren leidend, wurde ihm als Hilfsgeistlicher Dr. B.
Einstein aus Ulm beigegeben. Das Andenken des Dahingeschiedenen wird hier
in in weiteren Kreisen ein gesegnetes
bleiben". |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1891: "Heilbronn,
17. Januar (1891). Allgemeine Teilnahme findet die Kunde von dem gestern
Abend halb 8 Uhr erfolgten Tode des Herrn Rabbiners Dr. Moses Engelbert.
Die hiesige israelitische Gemeinde verliert an ihm einen begabten,
hochgeachteten Prediger und Religionslehrer, der auch in den weiteren
Kreisen der Einwohnerschaft wegen seiner Herzensgüte und seines
ausgezeichneten Charakters, verbunden mit liebenswürdigen Umgangsformen,
allgemein geschätzt und verehrt wurde. Der Verstorbene erreichte ein
Alter von 60 Jahren; er war geboren in Gudensberg (statt Gutenberg)
bei Kassel, wurde nach beendetem Studium Rabbiner in Kolberg, dann in
Waren (Mecklenburg-Schwerin), hierauf in Lehrensteinsfeld und zuletzt,
1863 nach Selbständigmachung der israelitischen Kirchengemeinde, hier in
Heilbronn. Schon seit mehreren Jahren leidend, musste er noch den Schmerz
erfahren, dass ein hoffnungsvoller Sohn und eine verheiratete Tochter vor
ihm aus dem Leben schieden. Dies trug mit dazu bei, dass sich sein
körperliches Leiden verschlimmerte, bis endlich gestern die Auflösung
eintrat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1891: "Heilbronn,
17. Januar (1891). Allgemeine Teilnahme findet die Kunde von dem gestern
Abend halb 8 Uhr erfolgten Tode des Herrn Rabbiners Dr. Moses Engelbert.
Die hiesige israelitische Gemeinde verliert an ihm einen begabten,
hochgeachteten Prediger und Religionslehrer, der auch in den weiteren
Kreisen der Einwohnerschaft wegen seiner Herzensgüte und seines
ausgezeichneten Charakters, verbunden mit liebenswürdigen Umgangsformen,
allgemein geschätzt und verehrt wurde. Der Verstorbene erreichte ein
Alter von 60 Jahren; er war geboren in Gudensberg (statt Gutenberg)
bei Kassel, wurde nach beendetem Studium Rabbiner in Kolberg, dann in
Waren (Mecklenburg-Schwerin), hierauf in Lehrensteinsfeld und zuletzt,
1863 nach Selbständigmachung der israelitischen Kirchengemeinde, hier in
Heilbronn. Schon seit mehreren Jahren leidend, musste er noch den Schmerz
erfahren, dass ein hoffnungsvoller Sohn und eine verheiratete Tochter vor
ihm aus dem Leben schieden. Dies trug mit dazu bei, dass sich sein
körperliches Leiden verschlimmerte, bis endlich gestern die Auflösung
eintrat." |
Lehrer Leopold Löwenstein (1873-1944; war
45 Jahre jüdischer Lehrer in Osterholz-Scharmbeck)
| Übernommen aus einer Website zur
Geschichte von Osterholz-Scharmeck (http://www.teufelsmoor.eu/menschen/lowenstein-leopold/)
|
Leopold "Leo" Löwenstein (geb.
14. November 1873 in Gudensberg als Sohn von Nathan Löwenstein und Lina
geb. Spangenthal, umgekommen am 6. Januar 1944 im Ghetto Theresienstadt) war von 1894 bis 1915 Vorbeter und hauptamtlicher Lehrer der jüdischen
Gemeinde Osterholz-Scharmbeck. Er führte von 1894 bis 1938 in Sütterlinschrift eine ausführliche Schulchronik, die auf Mikrofilm im Gesamtarchiv der deutschen Juden im Berliner Centrum Judaicum in Berlin archiviert ist. Löwenstein gehörte 1910 zu den Gründungs- und Vorstandsmitgliedern des Vereins der Fortschrittlichen Volkspartei Osterholz-Scharmbeck. 1915 wurde er im
Ersten Weltkrieg zum Militärdienst eingezogen; nach dem Krieg wurde die Schule nicht wieder eröffnet, der auf die neue Verfassung vereidigte Löwenstein erteilte nur noch den jüdischen Religionsunterricht. 1924 versetzte man ihn nach der preußischen Personalabbauverordnung in den einstweiligen Ruhestand. Die Gemeinde schloss aber einen neuen Vertrag mit ihm, nach dem er für jährlich 400 Mark und freie Wohnung weiterhin Religionsunterricht erteilte und Gottesdienst- sowie Kultushandlungen verrichtete. Löwenstein war in diesen Jahren nicht nur Vorsteher der Jüdischen Gemeinde, sondern auch eine anerkannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Er war u. a. Schriftführer im einflussreichen Scharmbecker Bürgerverein und schrieb als Autor des Heimatboten, einer Beilage zum Osterholzer Kreisblatt, Berichte über
"Hermann Allmers Beziehungen zu unserer engeren Heimat" oder die
"Entwicklung von Handel, Industrie und Verkehr im Kreis Osterholz".
Die Löwenstein'sche Schulchronik endet 1938 mit dem Vermerk, dass die Gemeinde noch aus 31 Personen besteht und die Synagoge wegen Ausfalls steuerkräftiger Mitglieder und zusätzlicher Belastungen nicht halten kann. Löwenstein verlor durch den notwendigen Verkauf der Synagoge seine Wohnung und sah sich nach 45-jähriger Tätigkeit gezwungen, zu Verwandten nach Paderborn zu ziehen.
Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er in das KZ Buchenwald verschleppt und
dort einige Wochen festgehalten. Am 31. Juli 1942 wurde er ab Münster und
Bielefeld in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 6. Januar 1944
umgekommen ist.
In Osterholz-Scharmbeck erinnert auf dem Mahnmal Bahnhofstraße sein Name
an sein Schicksal (Link
zu einer Seite über das Denkmal). |
| Zur Genealogie siehe: https://www.geni.com/people/Leopold-Löwenstein/6000000015616253183. |
Anzeigen
jüdische Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Lehrlingssuche des Manufaktur- und Modewarengeschäfts A.
Hahn Söhne (1890)
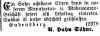 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1890: "Ein
Sohn achtbarer Eltern kann in unserem Manufaktur- und Modewaren-Geschäft
sofort als Lehrling eintreten. Sabbat ist unser Geschäft geschlossen.
Gudensberg. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1890: "Ein
Sohn achtbarer Eltern kann in unserem Manufaktur- und Modewaren-Geschäft
sofort als Lehrling eintreten. Sabbat ist unser Geschäft geschlossen.
Gudensberg.
A. Hahn Söhne." |
Anzeige von N. Löwenstein (1895)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. September
1895: "Für ein junges Mädchen aus guter Familie, welches in
häuslichen Arbeiten und im Kleidermachen erfahren ist, wird eine Stelle
in einem besseren Haushalt gesucht. Familienanschluss Bedingung. Offerten
vermittelt N. Löwenstein, Gudensberg,
Hessen." Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. September
1895: "Für ein junges Mädchen aus guter Familie, welches in
häuslichen Arbeiten und im Kleidermachen erfahren ist, wird eine Stelle
in einem besseren Haushalt gesucht. Familienanschluss Bedingung. Offerten
vermittelt N. Löwenstein, Gudensberg,
Hessen." |
Hochzeitsanzeige von Leopold Plaut und Bertl geb.
Wißmann (1922)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April
1922: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April
1922:
"Leopold Plaut - Bertl Plaut geb. Wißmann.
Vermählte. Gudensberg.
Trauung - so Gott will: Dienstag 25. April / 27. Nissan.
Restauration Pfeiffer, Schwäbisch Hall."
|
Verlobungsanzeige von Flora Blumenthal und Adolf
Katz (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Centralvereins")
vom 10. Januar 1924:
Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Centralvereins")
vom 10. Januar 1924:
"Flora Blumenthal - Adolf Katz. Verlobte.
Krefeld, Griessendorfer Str. 27-29 - Gudensberg (Bez. Kassel) / Krefeld,
Hochstr. 83". |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betraum in einem der jüdischen Häuser
vorhanden. Von regelmäßigen Gottesdienstes der jüdischen Familien erfährt
man erstmals 1714. 1744 wird als Vorbeter Enoch Abraham genannt. Nach ein
Betraum nicht mehr ausreichte, wurden in zwei Häusern Gottesdienste abgehalten
(noch 1825).
1840 konnte mit dem Bau einer Synagoge begonnen werden. Sie wurde am 14. September 1843
eingeweiht. Architekt der Synagoge war Albrecht Rosengarten, der u.a. auch die
Synagoge in Kassel erbaut hatte. Manche
Ähnlichkeiten in der Architektur der beiden Synagogen sind daher nicht
zufällig. Die Gemeinde hatte für den Bau 5.453 Reichstaler zu bezahlen. Die
Synagoge bot Platz für etwa 250 Personen. Das Gebäude umfasste einen
Synagogensaal von 111 Quadratmetern, einen Vorraum mit Treppenhaus und eine
dreiseitige Empore.
1925 konnte die Synagoge auf Grund der Spende des aus Gudensberg
stammenden Isaak Mansbach renoviert werden. Er starb jedoch bereits am 18. April
1925. Zur Erinnerung an ihn wurde eine Marmortafel im Vorraum der Synagoge
angebracht.
Texte aus der Geschichte der Synagoge:
Spende von Isaak Mansbach für die
Renovierung der Synagoge (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1925:
"Gudensberg, 24. Januar (1925). Der Deutsch-Amerikaner Isaak Mansbach,
gebürtig aus dem nahen Maden, der vor vielen Jahren nach dem Dollarlande
ausgewandert ist und vor 25 Jahren hier zu Besuch war, sandte der
jüdischen Gemeinde hier zur Renovierung der Synagoge den Betrag von 5.000
Dollar." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1925:
"Gudensberg, 24. Januar (1925). Der Deutsch-Amerikaner Isaak Mansbach,
gebürtig aus dem nahen Maden, der vor vielen Jahren nach dem Dollarlande
ausgewandert ist und vor 25 Jahren hier zu Besuch war, sandte der
jüdischen Gemeinde hier zur Renovierung der Synagoge den Betrag von 5.000
Dollar." |
Wiedereinweihung der Synagoge (1925)
 Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 25. September 1925:
"Gudensberg (Wiederherstellung der Synagoge). Die hiesige Gemeinde
konnte an einem der letzten Sabbate ihr vollständig renoviertes
Gotteshaus erstmalig wieder in Gebrauch nehmen. Die Kosten der
Wiederherstellung der Synagoge waren von einem nach Amerika ausgewanderten
und dort zu Reichtum gelangten Sohn der Gemeinde, Isaak Mansbach aus
Philadelphia bewilligt worden. Leider sollte er die Vollendung des Werkes
nicht erleben. Lehrer Perlstein, der beim Abend- und Morgengottesdienst
Ansprachen hielt, die der Bedeutung des Tages Rechnung trugen, hielt zu
seinem Gedächtnis auch eine Seelenfeier ab, die auf alle Teilnehmer
tiefen Eindruck machte. Außerdem hat die ihrem Wohltäter dankbare
Gemeinde im Vorraum des Gotteshauses eine Marmortafel mit entsprechender
Widmung anbringen lassen. Die Leitung der Renovierungsarbeiten, die in
ihrer Gesamtheit ein schlichtes, aber eindrucksvolles Bild gewähren,
lagen in den bewährten Händen des Kasseler Architekten und
Regierungsbaumeisters a.D. K.H. Sichel, der auch den Entwurf zum Umbau
lieferte." Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 25. September 1925:
"Gudensberg (Wiederherstellung der Synagoge). Die hiesige Gemeinde
konnte an einem der letzten Sabbate ihr vollständig renoviertes
Gotteshaus erstmalig wieder in Gebrauch nehmen. Die Kosten der
Wiederherstellung der Synagoge waren von einem nach Amerika ausgewanderten
und dort zu Reichtum gelangten Sohn der Gemeinde, Isaak Mansbach aus
Philadelphia bewilligt worden. Leider sollte er die Vollendung des Werkes
nicht erleben. Lehrer Perlstein, der beim Abend- und Morgengottesdienst
Ansprachen hielt, die der Bedeutung des Tages Rechnung trugen, hielt zu
seinem Gedächtnis auch eine Seelenfeier ab, die auf alle Teilnehmer
tiefen Eindruck machte. Außerdem hat die ihrem Wohltäter dankbare
Gemeinde im Vorraum des Gotteshauses eine Marmortafel mit entsprechender
Widmung anbringen lassen. Die Leitung der Renovierungsarbeiten, die in
ihrer Gesamtheit ein schlichtes, aber eindrucksvolles Bild gewähren,
lagen in den bewährten Händen des Kasseler Architekten und
Regierungsbaumeisters a.D. K.H. Sichel, der auch den Entwurf zum Umbau
lieferte." |
| In der "Gudensberger Zeitung" war
am 16. September 1925 zu lesen: |
| "Einweihung. Für die hiesige israelitische Gemeinde war der
vergangenen Samstag ein Tag besonderer Bedeutung. An demselben wurde in der vollständig erneuerten Synagoge, die im Jahre 1843 erbaut wurde, nach fünfmonatlicher Pause zum ersten Male wieder Gottesdienst abgehalten werden, der durch eine auf die Feier des Tages Bezug nehmende Ansprache des Lehrers Perlstein eine besondere Weihe erhielt. Die gründlichere Erneuerung ihres Gotteshauses verdankt die
Gemeinde der hochherzigen Spende eines edlen Wohltäters, des Herrn Isaac Mansbach in Philadelphia, eines früheren Mitgliedes der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde. Der edle Spender sollte leider die Erneuerung des Gotteshauses nicht mehr erleben. Er starb am 18. April d.J. eines
plötzlichen Todes. Sein Andenken wird in der hiesigen israelitischen Gemeinde für alle
Zeiten ein gesegnetes sein. Die Bauleitung lag in Händen des Regierungsbaumeisters a.D. Eichel in
Kassel. Für sämtliche Erneuerungsarbeiten war nur das hiesige Handwerk herangezogen worden und es hat die ihm gestellte Aufgabe zur größten Zufriedenheit aller in Betracht kommenden Instanzen ausgeführt." |
Die Synagoge wurde nach Wegzug der meisten
Gemeindemitglieder bereits 1937 geschlossen und kam im Juli 1938 in
Privatbesitz eines Gudensberger Bäckers,
sodass sie beim Novemberpogrom 1938 einer Zerstörung entgangen ist. Der
letzte jüdische Gemeindevorsteher Meier Löwenstein hatte die Ritualien an die
jüdische Gemeinde in Kassel übergeben. Am 18. Juli 1938 wurde das
Synagogengebäude für 3.000 RM verkauft. In der Folgezeit wurde das Gebäude
umgebaut (Empore abgebrochen, zwei Zwischendecken auf geänderter
Holzkonstruktion eingezogen, Einbau eines Lastenaufzuges, Durchbruch eines
Garagentores auf der Rückseite) und als Lagerhalle/Garage verwendet und geriet
in immer schlechteren Zustand. In den 1960er-Jahren erfolgt allerdings eine erste
Renovierung (neue Fenster, neuer Verputz).
1985 wurde die ehemalige Synagoge unter Denkmalschutz gestellt. 1986
bildete sich in Gudensberg der "Arbeitskreis Synagoge Gudensberg"
(Initiator und Vorsitzender: Hans-Peter-Klein) mit dem Ziel, die ehemalige Synagoge für die Zukunft zu erhalten. Nach
längeren Auseinandersetzungen erwarb die Stadt Anfang 1990 das Gebäude. 1991
konnte mit Unterstützung des Landes Hessen und des Schwalm-Eder-Kreises
zunächst eine Außenrenovierung vorgenommen werden, die 1992 abgeschlossen war.
Die Innenrenovierung wurde 1995 abgeschlossen (feierliche Eröffnung
am 7. November 1995). Seitdem wird die ehemalige
Synagoge für kulturelle Zwecke verwendet. Die Musikschule Schwalm-Eder-Nord hat
im Haus Übungsräume. Eine ständige Ausstellung dokumentiert die jüdische
Geschichte von Gudensberg und die Geschichte der Renovierung des Gebäudes. Im
Untergeschoss hat der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes seit 1994 Räume
eingerichtet.
Im Vorhof zur ehemaligen Synagoge erinnert ein von der Bildhauerin Dina Kunze
geschaffenes "Denk-Mal" an die Geschichte des Gebäudes mit dem
Text:
Vorderseite deutsch: "Zur Erinnerung an die ehemaligen jüdischen
Bürgerinnen und Bürger. Diese Synagoge wurde von 1840 bis 1843 nach den
Plänen des bedeutenden jüdischen Architekten Albrecht Rosengarten erbaut. Sie
war der Mittelpunkt im Leben der jüdischen Gemeinde, die 1871 fast 200
Mitglieder zählte. Hier feierten die Juden ihre regelmäßigen Gottesdienste
und Festtage. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden die
jüdischen Bürgerinnen und Bürger verfolgt, misshandelt und schließlich
systematisch vertrieben. Damit endete 1938 die mehr als 300jährige Geschichte
der Juden in Gudensberg. Viele von ihnen sind von den Nationalsozialisten in
Konzentrationslagern ermordet worden. Die Geschichte der Juden in Gudensberg ist
Teil unserer Geschichte. Die Stadt hat das seit 1938 in Privatbesitz befindliche
Gebäude 1991 erworben. Die Restaurierungsarbeiten wurden 1995 abgeschlossen.
Stadt Gudensberg."
Rückseite hebräisch - aus dem Totengebet für die als Märtyrer Verstorbenen:
"Gedenke der Seelen. Gedenke, Gott, der Seelen all meiner Verwandten
seitens meines Vaters, seitens meiner Mutter, die getötet, erschossen,
geschlachtet, verbrannt, ertrunken und erwürgt auf den Namen des Herrn. Erhöre
und verherrliche sie, Gott, in Deinem Himmelreiche und lass auch mein Bitten und
Beten erhört sein, um der kindlichen Liebe willen, mit der ich meines Herzens
Opfer Dir gelobe und bringe. Amen."
Adresse/Standort der Synagoge: Hintergasse 23
Fotos
(Quelle: sw-Foto obere Fotozeile aus Arnsberg Bilder S. 80;
sw-Fotos zweite Foto-Zeile aus Altaras 1988 s. Lit. S. 51-52; neuere
Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 15.6.2008)
Die ehemalige Synagoge
vor
der Restaurierung |
 |
|
| |
Blick zum westlichen
Eingangsbereich
und das ehemalige Schulhaus (links) |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Das Gebäude der
ehemaligen Synagoge im Juli 1985 (links Schauseite mit Eingang und
Vorplatz, Mitte Ostseite, rechts Nordgiebel) |
| |
|
|
| |
|
|
Die ehemalige
Synagoge nach der 1995 abgeschlossenen Restaurierung
- Fotos vom Juni 2008: |
|
 |
 |
 |
| Die ehemalige
Synagoge von der östlichen Seite bzw. von der nördlichen Seite (rechts) |
| |
 |
 |
 |
| Das Gebäude von Süden |
Das Eingangsportal
von Westen |
| |
|
 |
 |
 |
Hinweistafel zur
Geschichte |
Die
Portalinschrift aus Psalm 100,4: "Kommt in seine Tore mit Dank,
in
seine Höfe mit Lobgesang" |
| |
|
 |
 |
 |
 |
| Das "Denk-Mal" vor
der Synagoge in deutscher und hebräischer Beschriftung |
|
| |
|
 |
 |
 |
Dauerausstellung
auf der Empore: links zur Geschichte der Restaurierung;
rechts
Erinnerungen an die jüdische Geschichte in Gudensberg |
Gebetsmantel (Tallit)
und Kippa |
| |
|
 |
 |
 |
"Erkenne, vor
wem du
stehst" |
Rundfenster über dem
Eingangsportal
vom Treppenhaus gesehen |
Eingang
zum
Betsaal |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Die ehemalige
Synagoge wird u.a. für Veranstaltungen der Musikschule genutzt: am 16. Juni 2008
war es ein Schülerkonzert |
| |
 |
 |
 |
| Fotos von der
ehemaligen Frauenempore in den Betsaal beim Schülerkonzert |
| |
| |
 |
|
| |
Plakat der "Jüdischen
Liberalen Gemeinde
Emet weSchalom in Gudensberg", die
von 2001 bis Juni 2010 ihren Sitz in
Gudensberg hatte |
|
| |
|
|
| |
|
|
| Das ehemalige Schulhaus |
|
|
 |
 |
 |
Das ehemalige
jüdische
Schulhaus (links) |
Blick von der Straße auf das
ehemalige jüdische Schulhaus |
Informationstafel
zur Geschichte
der jüdischen Schule |
Erinnerungsarbeit
vor Ort und besondere Veranstaltungen im Kulturhaus Synagoge - einzelne
Berichte
| März 2009 - Die ersten
Stolpersteine werden in Gudensberg und Obervorschütz verlegt |
Artikel vom 25. Februar 2009 in der
"Hessischen Allgemeinen" (HNA-Online, Artikel)
Erinnerung an die Opfer - Initiative Stolpersteine: Gedenksteine werden verlegt - Vortragsabend am 10. März
Premiere in Gudensberg: Am 11. März werden vor zwei Häusern die ersten Stolpersteine von Gunter Demnig verlegt.
Gudensberg. Nach einem Jahr der Vorbereitung werden am Mittwoch, 11. März, die ersten Stolpersteine in Gudensberg verlegt. Diese Gedenksteine sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die von Nationalsozialisten verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden. Sie werden in das Pflaster des Gehweges vor ehemaligen Wohnorten eingelassen..."
|
| |
| März 2009: Über die
Verlegung der Stolpersteine in Obervorschütz |
Artikel von Rosemarie Först vom 13. März
2009 in der "Hessischen" (HNA-Online, Artikel)
Adlers von gegenüber
- Stolpersteine erinnern an Schicksal von Obervorschützer Familie
OBERVORSCHÜTZ. Elisabeth Lock aus Obervorschütz erinnert sich noch gut an die freundliche Familie Adler von gegenüber: "Siegbert war der Älteste, dann kam Amalia, dann der Edmond, der Willy, die Ilse und der Jacob."
"Die Familie floh 1939 vor den Nazis in die USA. Mit Stolpersteinen vor ihrem früheren Wohnhaus wird jetzt an das Schicksal der Adlers erinnert. "Der Hintergrund des Projektes ist kein Grund zur Freude, aber ich freue mich trotzdem, dass wieder ein Ort dazu gekommen ist", sagte der Kölner Bildhauer und Vater des Projekts, Gunter
Demnig..." |
| |
| April 2010:
Weitere Stolpersteine werden am 12. Mai 2010 verlegt |
Artikel vom 15. April 2010 in der
"Hessischen Allgemeinen" (HNA-Online, Artikel):
"Bürgermeister Frank Börner unterstützt die Stolperstein-Initiative.
Neue Steine am 12. Mai.
Gudensberg. Die Aktivitäten der Initiative 'Stolpersteine für
Gudensberg' gehen weiter und werden vom neuen Bürgermeister Frank Börner unterstützt. Börner und die Sprecher der Initiative, Jens Haupt und Frank
Skischus, freuten sich über die erfolgreiche Benefiz-Veranstaltung des Kasseler Kabaretts
'Organtheater' im Löwensteinkeller in Gudensberg. Mehr als 700 Euro kamen dabei zusammen, die für die Verlegung weiterer Stolpersteine in der Stadt verwendet werden
sollen..." |
| |
| Mai 2010:
Erfolgreiche Erinnerungsarbeit mit den
"Stolpersteinen" |
Artikel vom 14. Mai 2010 in der "Hessischen Allgemeinen" (HNA-Online;
Artikel):
"Als 12-Jähriger wurde Karlmann Plaut vertrieben - Ein Stein für Carlos.
Gudensberg/JERUSALEM. Die Arbeit der Frauen und Männer der Initiative Stolpersteine hat sich gelohnt: Es gibt immer noch Überlebende, ob in San Francisco oder in Jerusalem, die Anteil nehmen an der Aktion.
Zum Beispiel Carlos Plaut. Jens Haupt, einer der Sprecher der Stolperstein-Initiative, besuchte ihn kürzlich in Jerusalem.
'Ich habe immer von Gudensberg geträumt', sagt Plaut (87), 'von jeder Straße und von jedem
Haus'. Auch Jahrzehnte nach der Flucht vor den Nazis verfolgten ihn die Bilder im Schlaf. Die Familie hatte sich 1935 in Sicherheit gebracht. Carlos hieß damals noch Karlmann und war erst zwölf Jahre alt, als sich für ihn zum letzten Mal die Tür seines Elternhauses in der Fritzlarer Straße 2 schloss. Seit Mittwoch erinnern vier Stolpersteine vor dem Gebäude an das Schicksal der
Plauts..." |
| |
| Mai
2010: Zur Verlegung der
"Stolpersteine" in Gudensberg am 12. Mai 2010 |
Artikel in der "Hessischen
Allgemeinen" vom 10. Mai 2010 (HNA-Online; Artikel):
"Gudensberger Initiative lädt ein zur Verlegung mit dem Kölner Künstler Gunter Demnig
- Acht neue Stolpersteine sollen erinnern.
Gudensberg. Seit zwei Jahren gibt es in Gudensberg die 'Initiative
Stolpersteine', die mit Unterstützung der örtlichen Schulen ins Leben gerufen wurde, um an die von 1933 bis 1945 verfolgten, vertriebenen und ermordeten Menschen aus der Stadt zu erinnern.
Der Kölner Künstler Gunter Demnig wird am Mittwoch, 12. Mai, wieder nach Gudensberg kommen und die nächsten Steine verlegen. Um 11.30 Uhr ist Treffpunkt für alle im Familien- und Kommunikationszentrum Quartier im Grabenweg 7..." |
| |
| August
2010: Zum Tod von Carlos
Plaut |
Artikel in der "Hessischen Allgemeinen"
vom 11. August 2010 (Artikel): "Kistenweise Erinnerungen.
Gudensberg. Die Initiative Stolpersteine in Gudensberg trauert mit den Angehörigen um Carlos Plaut. Der frühere Gudensberger starb kürzlich im Alter von 87 Jahren in einem Jerusalemer Krankenhaus. Mit ihm verliert Gudensberg einen der letzten Überlebenden der jüdischen Gemeinde vor 1938.
Carlos Plaut, der 1935 mit seiner Familie aus Gudensberg geflüchtet war, lebte viele Jahre in Brasilien. 1984 kam er mit seiner Familie nach Israel, wo seine Schwester bereits seit 1949 wohnte. In einem religiösen Altersheim in Jerusalem hütete er seine Erinnerungen: Fotos, Briefe, Artikel, einen selbst erstellten Plan von Gudensberg, in dem er die jüdischen Häuser eingezeichnet hatte, sowie eine Liste mit den Namen deportierter Juden..." |
| |
| Januar
2012: Weitere
"Stolpersteine" sollen Ende Mai 2012 verlegt werden
|
Artikel in der "Hessischen
Allgemeinen" vom 11. Januar 2012 (Artikel):
"Neue Stolpersteine - Aktion erinnert an frühere jüdische
Bürger.
Gudensberg. Die Initiative Stolpersteine in Gudensberg will nach zwei
erfolgreichen Aktionen am 30. Mai weitere 20 der so genannten
Stolpersteine des Künsttlers Gunter Demnig
verlegen..." |
| |
| März
2012: Ehemalige jüdische
Gudensbergerin zu Gast in der früheren Heimat |
Artikel min der "Hessischen
Allgemeinen" (Lokalausgabe) vom 22. März 2012: "Lisa Eyck
war zu Gast in Gudensberg, aus der ihre Familie einst vertrieben wurde.
Reise in die Vergangenheit.
Gudensberg. In der Hornungsgasse in Gudensberg steht das Haus, das
einst den Großeltern von Lisa Eyck gehörte. Die jüdische Familie lebte
und arbeitete bis 1935 dort. Großvater Markus Elias war Schuhmacher und
hatte in dem Haus seine Werkstatt. Er verkaufte die Schuhe und Stiefel,
die er fertigte, in Gudensberg und in der Umgebung..."
Link
zum Artikel |
| |
| Mai 2012:
Nächste Verlegung von "Stolpersteinen"
am 30. Mai 2012 |
Artikel bei nh24.de vom 24. Mai
2012: "Verfolgte erhalten ihren Namen zurück...."
Link
zum Artikel |
| |
Aktueller
Hinweis: Wer die Initiative 'Stolpersteine für Gudensberg' unterstützen möchte, kann dies durch eine Spende tun. Der Verein Gudensberger Heimatfreunde e.V. hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet:
Konto Nr. 100 607 770 BLZ 520 622 00 VR-Bank Chattengau
Stichwort 'Stolpersteine' (Spendenquittung möglich)
Die Kosten für einen Stein betragen jetzt 120.- Euro. Jeder finanzielle Beitrag zur Unterstützung des Projekts Stolpersteine ist hilfreich und willkommen. Die beiden Sprecher der Initiative, Frank Skischus und Jens Haupt, stehen unter der Rufnummer 05603-2995 gern zur Verfügung. |
| |
Links und Literatur
Links:
 | Website der
Stadt Gudensberg mit Seite
zur Synagoge |
 | Website
der Jüdischen Liberalen Gemeinde Emet weSchalom in Gudensberg /seit
2010 Felsberg) |
 | Wikipedia-Artikel
zur "Jüdisch Liberalen Gemeinde Emet weSchalom Nordhessen" |
 | Website http://www.juden-in-nordhessen.co.de:
Informationen zur jüdischen Geschichte in Gudensberg; unter " Genealogien jüdischer Familien in Nordhessen"
finden sich hier
Stammbäume der Familien Adler, Engelbert, Flörsheim, Hahn, Lilienfeld,
Löwenstein, Mansbach, Markheim, Plaut (auch zu Obervorschütz, auch bei der
Forschung Christoph Kuehn), Katz (Forschung Christoph Kuehn) sowie Familie
Mansbach (in Maden) |
 | 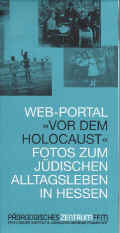 Webportal
"Vor dem Holocaust" - Fotos zum jüdischen Alltagsleben in
Hessen mit Fotos zur jüdischen Geschichte in Gudensberg und
Obervorschütz Webportal
"Vor dem Holocaust" - Fotos zum jüdischen Alltagsleben in
Hessen mit Fotos zur jüdischen Geschichte in Gudensberg und
Obervorschütz
|
Quellen:
| Hinweis
auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde Gudensberg
mit Maden und Obervorschütz |
In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs
(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus
hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:
Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41
Zu Gudensberg sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
HHStAW 365,388 Gräberverzeichnis des jüdischen
Friedhofs der Kultusgemeinde Gudensberg in Obervorschütz, aufgenommen
im August 1937 durch Baruch Wormser aus Grebenstein, Laufzeit 1736 -
1935
Überwiegend hebräische, zum Teil deutsche Grabinschriften mit Angaben
zur Lage der Gräber auf dem Friedhofsgelände; enthält auch Angaben zu
Verstorbenen Juden aus Cappel, Dorla, Elben, Felsberg (mit Altenburg und
Gensungen), Kirchberg, Lohne, Maden, Neuenbrunslar, Niedenstein,
Obermöllrich, Obervorschütz, Riede, Züschen; darin auch: Abriss
zur Geschichte des Friedhofs mit Hinweis auf dessen Anlegung um 1730 und
die Nutzung als Sammelfriedhof u.a. durch die Synagogengemeinden
Gudensberg, Felsberg, Niedenstein und Fritzlar; enthält auch je eine
Skizze zur Lage und Belegung des Friedhofs in Obervorschütz; auch: Fotos
von verschiedenen Gräberfeldern des Friedhofs, aufgenommen durch Herrn
Regierungsrat Dr. Grünbaum. https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5135970
HHStAW 365,384 Geburtsregister der Juden von Gudensberg
1824 - 1874; enthält auch Angaben zu Dorla, Maden und Obervorschütz
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v1230098
HHStAW 365,387 Sterberegister der Juden von
Gudensberg 1824 - 1900; enthält auch Angaben zu Dorla, Maden
und Obervorschütz https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v2126650
HHStAW 365,386 Trauregister der Juden von Gudensberg
1825 - 1900; enthält auch Angaben zu Dorla, Maden und Obervorschütz
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v825436
HHStAW 365, 385 Geburtsregister der Juden von Gudensberg 1875
- 1901; enthält auch Angaben zu Maden und Obervorschütz
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v289874
|
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 300-304. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 80. |
 | Gudensberg - Gesichter einer Stadt. Hrsg. vom
Magistrat der Stadt Gudensberg 1990. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 51-52. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 50-51. |
 | dies.: Neuausgabe der beiden genannten Werke. 2007. S.
153-157. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 172-173. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 404-405. |
 |
 Beitrag
über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing
the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut Beitrag
über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing
the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut
When Elizabeth S. Plaut began tracing her husband’s family roots forty
years ago, she had no idea how this undertaking would change her life and
turn her into a serious genealogist. A trained researcher, she corresponded
with hundreds of people around the world to glean information about the
various branches of the family; scoured cemetery files, archives, and other
available sources; and maintained copious files brimming over with her notes
and charts. Beginning with her quest to find the roots of her husband’s
branch of the family from Willingshausen, Germany -many years before
genealogy became popular - Elizabeth Plaut discovered families in dozens of
small villages in Germany. She tracked the relationships between more than
11,000 people and separated the branches according to the many cities where
the families originated. Impressive in its scope and in Elizabeth Plaut’s
meticulous commitment to detail, The Plaut Family: Tracing the Legacy will
be of immense value to all those interested in knowing more about their
roots. 7" x 10" 420 pp. softcover $45.00. Vgl.
http://www.avotaynu.com/books/Plaut.htm.
Family Trees Organized by German Town of Ancestry: Bodenteich, Bovenden,
Falkenberg, Frankershausen, Frielendorf, Geisa, Gudensberg, Guxhagen,
Melsungen, Obervorschuetz, Ottrau, Rauschenberg, Reichensachsen,
Rotenburg, Schmalkalden, Wehrda, Willingshausen.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Gudensberg,
Hesse-Nassau. Established in the 18th century, the community built a synagogue
in 1843, maintained an elementary school from 1825 to 1934 and grew to 194 (10 %
of the total) in 1871. Many Jews raised cattle or poultry and owned farms.
Israel Mayer Japhet (1818-92) taught there prior to becoming in 1853 musical
director of the Orthodox Adass Jeshurun congregation in Frankfurt, Mordecai
Wetzlar, who served as district rabbi (1830-75), founded a yeshiva attended by
Yitzhak Ruelf (1831-1902), the rabbi of Memel and pioneer German Zionist.
Affiliated with Kassel's rabbinate, the community numbered 118 in 1925. By May
1938, however, all the Jews had left and Gudensberg was proclaimed 'free of Jews'
(judenrein).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|