|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Efringen-Kirchen (Ortsteil Kirchen,
Kreis Lörrach)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Kirchen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938.
Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück; 1736 waren fünf jüdische
Familien ansässig. Sie stammten aus dem schweizerischen Dornach (Dorneck-Dorf,
Kanton Solothurn), wo sie in diesem Jahr ausgewiesen worden waren. Möglicherweise
wohnten bereits eine oder zwei jüdische Familien zuvor in Kirchen. Bis
1790 war die Zahl der jüdischen Familien am Ort auf elf
angestiegen.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1810 60 jüdische Einwohner, 1825 73 (9,6 % von insgesamt 764
Einwohnern), 1858 160, höchste
Zahl um 1871 mit 192 Personen, 1875 174 (15,2 % von 1.142), 1895 145
(14,9 % von 975), 1900 102 (10,4 % von 980.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule (Religionsschule), ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der
zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe unten die Ausschreibungen
der Stelle). Bis 1834 unterrichtete in Kirchen als Hauslehrer der spätere
Rabbiner von Hegenheim, Moses Nordmann.
Als jüdische Religionslehrer werden genannt: 1809 bis 1820: Samuel Ruf
aus Blotzheim im Elsass, 1822 bis zu seinem Tod 1833: Elias Lieberles aus Rust,
1833 bis 1841 Moses Ellenboden aus Altdorf (Ettenheim), 1841 bis 1845 Lazarus Bodenheimer, 1845 bis 1859 Leopold Straßburger aus Binau,
1859 bis zu seinem Tod 1864 Lazarus Mannheimer aus Friesenheim,
1864 bis 1870 Jakob Schorsch aus Adelsheim,
später in Merchingen, 1871 bis 1878 Jakob
Brandeis (gest. in Konstanz), 1879 bis
1881 Salomon Weikersheimer aus Massbach,
1881 bis 1885 Isak Ziwi (später in Großbockenheim),
1886 bis 1889 Philipp Pollack (später in die USA ausgewandert), 1889 bis
1893 Albert Weil aus Kippenheim (später
in Eichstetten), 1893 bis 1894 Karl
Grumbach (gest. in Gailingen), 1894 bis
1897 Berthold Rosenthal aus Liedolsheim
(später in Mannheim), 1897 bis 1900 Salomon Steinberger aus Hünfeld
(später in Frankfurt), 1901 bis 1903 Adolf Lederer (ab 1903 Hausverwalter in
Israelitischen Landesasyl in Lengnau),
1904 bis zu seinem Tod 1913 Moritz Moses aus Lobsens/Posen, 1913 bis 1923 Jakob
Alperowitz aus der Schweiz (später in Müllheim,
von wo aus er weiterhin Kirchen mitbetreute), 1923 bis 1930 Leopold Braunschweig
aus Kirchen, zuletzt bis 1935 Ludwig Alfred Rosenberg aus Breisach
(emigriert in die USA).
1827 wurde
die jüdische Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Sulzburg,
nach dessen Verlegung 1886 dem Rabbinatsbezirk Freiburg
zugewiesen.
Als auch im benachbarten Efringen die Zahl der jüdischen Einwohner
zunahm (1925: 11, 1932 10 Personen), gehörten diese zur jüdischen Gemeinde in Kirchen.
Die jüdischen Familien lebten in der Mehrzahl zunächst
vom Viehhandel. Später gab es auch einen jüdischen Metzger (noch 1912 der
einzige Metzger in Kirchen), eine jüdische Gastwirtschaft sowie einen jüdischen
Arzt. Bis nach 1933 bestanden an jüdischen Gewerbebetrieben u.a.: (Auswahl, weitere Gebäude kriegszerstört): Viehhandlung Isaak und Salomon Bloch (Basler
Straße 38), Viehhandlung Veist Bloch (Bergrain 1), Viehhandlung Isaak Braunschweig (Bergrain 4), Handelsmann Samuel Moses I (Basler
Straße 21), Fellhandlung Gebr. Moses, Inh. Alfred Weil (Neusetze 20).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Simon
Braunschweig (geb. 29.3.1871 in Kirchen, gef. 16.1.1918) und David Moses (geb.
16.8.1876 in Kirchen, gef. 1.7.1916).
1925 gehörten der jüdischen Gemeinde noch 71 Personen an
(7,1 % der Gesamteinwohnerschaft von ca. 1.000 Personen). Dem Vorstand der
jüdischen Gemeinde gehörten damals an: Leopold Braunschweig, Alfred Weil,
Samuel Moses II. Synagogendiener war Theodor Sieberles. Den Religionsunterricht
für die jüdischen Kinder an der Volksschule erteilte um 1925 der bereits
genannte Lehrer Jakob Alperowitz
aus Müllheim, den Unterricht für die
Kinder an den höheren Schulen hielt Lehrer Siegfried Simon aus Lörrach.
An jüdischen Vereinen war eine Chewroh Kadischa vorhanden (Wohltätigkeits- und
Beerdigungsverein) sowie ein Waisenverein. 1932 waren die
Gemeindevorsteher Leopold Braunschweig, Julius Bloch-Wachenheimer und Julius
Bloch-Geismar. Als Kantor wirkte der bereits genannte Leopold Braunschweig. Im Schuljahr 1932/33 gab
es noch sieben schulpflichtige jüdische Kinder.
1933 lebten noch 68 jüdische Personen am Ort. Auf Grund der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien ist
ein größerer Teil von ihnen in der folgenden Jahren emigriert beziehungsweise
in andere Orte verzogen. Unter den in die USA Ausgewanderten war der Arzt Dr.
Baum, der seine Praxis hatte schließen müssen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde
die Synagoge zerstört (s.u.). Die jüdischen Einwohner wurden aus ihren
Wohnungen getrieben, die meisten der jüdischen Männer wurden wenig später in
das KZ Dachau deportiert. Bei Kriegsausbruch wurde der Ort evakuiert. Die
jüdischen Einwohner wurden zum größten Teil nach Konstanz eingewiesen. Im
Oktober 1940 wurden 23 der 1933 in Efringen und Kirchen wohnhaften jüdischen
Personen in das KZ Gurs deportiert. Von diesen starben vier im Lager Gurs, fünf
erlebten das Kriegsende, sieben wurden 1942 nach Auschwitz deportiert und
ermordet. Weitere sieben Personen sind verschollen. Weitere aus Efringen und
Kirchen stammende jüdische Personen wurden von anderen Orten aus deportiert und
wurden später in Vernichtungslagern ermordet.
Von den in Efringen-Kirchen geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie
Huettner s.Lit., bei Yad
Vashem, Jerusalem ist die Suche allerdings erschwert, da bei der basic
search zu "Efringen" nur wenige, "Kirchen" aber zu viele
Ergebnisse erscheinen): Regina Biedermann geb. Moses (1884), Anna (Annie) Bloch
(1898), Babette Bloch geb. Rieser (1873), Berta Bloch geb. Bloch (1865), Ernst
Bloch (1886), Salomon Bloch (1868), Selma Bloch (1896), Sophie Bloch geb. Geismar
(1891), Ida Bräunlin geb. Olesheimer (1895), Friederike Braunschweig geb. Moses
(1882), Margot Braunschweig (1920), Samuel Braunschweig (1876), Amalie David
geb. Brandeis (1876), Kaufmann Freund
(1865), Emma Freund geb. Geismar (1868), Adolf Geismar (1872), Alice Harburger
(1903), Bertha Moses geb. Bloch (1866), Elsa Moses (1894), Frieda N. Moses
(1893), Jules Moses (1892),
Robertine Moses geb. Rothschild (1877), Rosa Moses geb. Braunschweig (1878),
Samuel Moses I (1875), Samuel Moses II (1885), Emma Olesheimer geb. Weil (1857),
Jonas Olesheimer (1888), Mina Roos geb. Moses (1891), Alfred Weil (1887), Arthur
Weil (1880), Lina Weil (1867), Rosa Weil geb. Moses (1885).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1840 /
1845 / 1870 /
1878 / 1885 / 1892 / 1893 / 1900 / 1903
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1840 S. 182 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Bei der israelitischen Gemeinde Kirchen ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 200 Gulden, sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen
verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunden und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirks-Synagoge Sulzburg zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch
Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach
erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden.." Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1840 S. 182 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Bei der israelitischen Gemeinde Kirchen ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 200 Gulden, sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen
verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunden und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirks-Synagoge Sulzburg zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch
Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach
erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden.." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 23. April 1845 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Vakante Sulzburg. [Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde
Kirchen ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 200 fl., nebst freier Wohnung, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 23. April 1845 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Vakante Sulzburg. [Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde
Kirchen ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 200 fl., nebst freier Wohnung, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Sulzburg zu melden.
Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden.
Sulzburg, den 9. April 1845. Großherzogliche Bezirkssynagoge" |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1870:
"Bei der israelitischen Gemeinde Kirchen ist die Stelle eines
Religionsschullehrers, Vorsängers und Schächters zu besetzen. Gehalt 300
Gulden jährlich nebst freier Wohnung, 1 Gulden 12 Kreuzer Schulgeld von
jedem Schulkinde und die Gebühren, welche die Schächterfunktion
abwirft. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1870:
"Bei der israelitischen Gemeinde Kirchen ist die Stelle eines
Religionsschullehrers, Vorsängers und Schächters zu besetzen. Gehalt 300
Gulden jährlich nebst freier Wohnung, 1 Gulden 12 Kreuzer Schulgeld von
jedem Schulkinde und die Gebühren, welche die Schächterfunktion
abwirft.
Bewerber haben sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse über Befähigung und
Aufführung, bei unterzeichneter Stelle innerhalb 4 Wochen zu
melden. Sulzburg im Badischen, den 24. August 1870.
Die Bezirks-Synagoge. Dreyfuss,
Bezirksrabbiner." |
| |
 Anzeige
in der "Karlsruher Zeitung" vom 10. November 1870: "Kirchen.
Offene Lehrerstelle! Anzeige
in der "Karlsruher Zeitung" vom 10. November 1870: "Kirchen.
Offene Lehrerstelle!
In der israelitischen Gemeinde Kirchen, Amt Lörrach, ist die
Religionslehrerstelle, welche mit Vorbeter- und Schächterdienst
verbunden ist, mit einem jährlich fixen Gehalt von 350 fl. nebst freier
Wohnung, Schulgeld und noch sonstigen Gefällen wieder zu besetzen. Bewerber
wollen sich binnen 14 Tagen unter Vorlage ihrer Zeugnisse beim
Synagogenrate dahier anmelden.
Kirchen, den 6. November 1870. Der Synagogenrat. Bloch." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1870:
"Offene Lehrerstelle. In der israelitischen Gemeinde Kirchen,
Amt Lörrach ist die Religionslehrerstelle, welche mit Vorbeter- und
Schächterdienst verbunden ist, mit einem jährlich fixen Gehalt von 350
Gulden nebst freier Wohnung, Schulgeld und noch anderen Gefällen wieder
zu besetzen. Bewerber wollen sich binnen 14 Tagen unter Vorlage ihrer
Zeugnisse beim Synagogenrate dahier anmelden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1870:
"Offene Lehrerstelle. In der israelitischen Gemeinde Kirchen,
Amt Lörrach ist die Religionslehrerstelle, welche mit Vorbeter- und
Schächterdienst verbunden ist, mit einem jährlich fixen Gehalt von 350
Gulden nebst freier Wohnung, Schulgeld und noch anderen Gefällen wieder
zu besetzen. Bewerber wollen sich binnen 14 Tagen unter Vorlage ihrer
Zeugnisse beim Synagogenrate dahier anmelden.
Kirchen, den 6. November 1870. Der Synagogenrat, Bloch." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. April 1878:
"Die hiesige israelitische Religionsschulstelle, verbunden mit
Vorsänger- und Schächterdienst, mit einem jährlich fixen Gehalt von 700
Mark nebst freier Wohnung und der von diesem Dienste abfließenden
Gefällen ist vakant. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. April 1878:
"Die hiesige israelitische Religionsschulstelle, verbunden mit
Vorsänger- und Schächterdienst, mit einem jährlich fixen Gehalt von 700
Mark nebst freier Wohnung und der von diesem Dienste abfließenden
Gefällen ist vakant.
Etwaige Bewerber wollen sich unter Vorlage der ihnen zu Gebote stehenden
Zeugnisse an den Synagogenrat von hier wenden.
Kirchen (Amt Lörrach, Großherzogtum Baden), den 24. März 1878.
Der Synagogenrat: Daniel Harburger, Vorsteher. Veist Bloch. Benjamin
Bloch." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. August 1885:
"Bei der israelitischen Gemeinde Kirchen, badischen Oberlands, ist
die Stelle eines Religionsschullehrers zu besetzen. Fixer jährlicher
Gehalt 700 Mark, Schächterfunktion ungefähr 250 Mark, Schulgeld
ungefähr 70 Mark. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. August 1885:
"Bei der israelitischen Gemeinde Kirchen, badischen Oberlands, ist
die Stelle eines Religionsschullehrers zu besetzen. Fixer jährlicher
Gehalt 700 Mark, Schächterfunktion ungefähr 250 Mark, Schulgeld
ungefähr 70 Mark.
Befähigte Personen wollen mit Beifügung ihrer Zeugnisse, innerhalb 6
Wochen, bei der Bezirks-Synagoge Sulzburg, badischen Oberlands, sich
melden." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1892:
"Die Religionsschulstelle Kirchen, verbunden mit dem Vorsänger- und
Schächterdienst, ist zum 1. Februar 1892 zu besetzen. Außer einem Fixum
von 700 Mark wird ein Nebeneinkommen von 430 Mark und Dienstwohnung von 4
Zimmern gewährt. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1892:
"Die Religionsschulstelle Kirchen, verbunden mit dem Vorsänger- und
Schächterdienst, ist zum 1. Februar 1892 zu besetzen. Außer einem Fixum
von 700 Mark wird ein Nebeneinkommen von 430 Mark und Dienstwohnung von 4
Zimmern gewährt.
Geeignete Bewerber wollen ihre Zeugnisse einsenden an
Die Bezirkssynagoge Freiburg i.B." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1893:
"Die mit dem Kantorate und dem Schächterdienst verbundene
Religionsschulstelle Kirchen ist zu besetzen. Neben einem Fixum von
Mark 700 wird ein Nebeneinkommen von ca. Mark 450 nebst freier, aus 4
Zimmern bestehenden Wohnung gewährt. Geeignete Bewerber wollen sich bald
melden an die Bezirks-Synagoge Freiburg i.Br." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1893:
"Die mit dem Kantorate und dem Schächterdienst verbundene
Religionsschulstelle Kirchen ist zu besetzen. Neben einem Fixum von
Mark 700 wird ein Nebeneinkommen von ca. Mark 450 nebst freier, aus 4
Zimmern bestehenden Wohnung gewährt. Geeignete Bewerber wollen sich bald
melden an die Bezirks-Synagoge Freiburg i.Br." |
| |
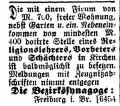 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1900:
"Die mit einem Fixum von Mark 700, freier Wohnung, nebst Garten und
einem Nebeneinkommen von mindestens Mark 400 dotierte Stelle eines Religionslehrers,
Vorbeters und Schächters in Kirchen ist baldmöglichst zu besetzen.
Meldungen mit Zeugnisabschriften nimmt entgegen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1900:
"Die mit einem Fixum von Mark 700, freier Wohnung, nebst Garten und
einem Nebeneinkommen von mindestens Mark 400 dotierte Stelle eines Religionslehrers,
Vorbeters und Schächters in Kirchen ist baldmöglichst zu besetzen.
Meldungen mit Zeugnisabschriften nimmt entgegen.
Die Bezirkssynagoge: Freiburg i.Br." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1900:
"Israelitische Gemeinde Kirchen. Die mit einem Fixum von 700
Mark, freier Wohnung nebst Gärtchen und einem Nebeneinkommen von
mindestens Mark 400.- dotierte Stelle des Religionslehrers, Vorbeters
& Schächters in unserer Gemeinde ist per sofort zu besetzen.
Meldungen mit Zeugnisabschriften nimmt entgegen Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1900:
"Israelitische Gemeinde Kirchen. Die mit einem Fixum von 700
Mark, freier Wohnung nebst Gärtchen und einem Nebeneinkommen von
mindestens Mark 400.- dotierte Stelle des Religionslehrers, Vorbeters
& Schächters in unserer Gemeinde ist per sofort zu besetzen.
Meldungen mit Zeugnisabschriften nimmt entgegen
Die Bezirkssynagoge Sulzburg in Freiburg im Breisgau". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1903:
"Die Religionslehrer-, Schächter- und Vorbeterstelle, Kirchen,
mit einem Fixum von Mark 700, freier Wohnung und Nebeneinnahmen von ca.
400 Mark ist zum 1. November zu besetzen. Meldungen mit Zeugnisabschriften
erbittet Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1903:
"Die Religionslehrer-, Schächter- und Vorbeterstelle, Kirchen,
mit einem Fixum von Mark 700, freier Wohnung und Nebeneinnahmen von ca.
400 Mark ist zum 1. November zu besetzen. Meldungen mit Zeugnisabschriften
erbittet
Die Bezirkssynagoge Freiburg i.B." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israeltischen Familienblatt" vom 2. Oktober
1903: "Kirchen. Lehrer, Vorbeter und Schächter per 1.
November, 1.100 Mark Einkommen und freie Wohnung. Meldungen an
Bezirkssynagoge, Freiburg in Baden." Anzeige
im "Frankfurter Israeltischen Familienblatt" vom 2. Oktober
1903: "Kirchen. Lehrer, Vorbeter und Schächter per 1.
November, 1.100 Mark Einkommen und freie Wohnung. Meldungen an
Bezirkssynagoge, Freiburg in Baden." |
Aus dem jüdischen
Gemeinde- und Vereinsleben
Streit um das Schächten (1920)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1920: "Kirchen,
12. April (1920). Ein gemeindepolitischer Kampf, auf dessen Ausgang man
gespannt sein darf, hat sich hier entsponnen. Auf Antrag der hiesigen
Landwirte, die sich weigerten, Vieh abzugeben, wenn es geschächtet wird,
hat der hiesige Gemeinderat beim Bezirksamt Lörrach die Aufhebung der
Schächtung beantragt. Als Begründung führt er an, dass dasselbe eine
unnötige Tierquälerei sei, und dass in unserer jetzigen
lebensmittelarmen Zeit alles verwendet werden müsse, auch das Blut, das
beim Schächten verloren geht. Die Entscheidung darüber, ob die
Schächtung aufgehoben wird oder nicht, liegt zur Zeit beim
Landeskommissar in Freiburg. Es dürfte der Behörde in Freiburg nicht
schwer fallen, Stadtrat und Landwirte von der Unsinnigkeit der Annahme,
dass gegen das Schächten ethische oder hygienische Bedenken sprechen, zu
überzeugen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1920: "Kirchen,
12. April (1920). Ein gemeindepolitischer Kampf, auf dessen Ausgang man
gespannt sein darf, hat sich hier entsponnen. Auf Antrag der hiesigen
Landwirte, die sich weigerten, Vieh abzugeben, wenn es geschächtet wird,
hat der hiesige Gemeinderat beim Bezirksamt Lörrach die Aufhebung der
Schächtung beantragt. Als Begründung führt er an, dass dasselbe eine
unnötige Tierquälerei sei, und dass in unserer jetzigen
lebensmittelarmen Zeit alles verwendet werden müsse, auch das Blut, das
beim Schächten verloren geht. Die Entscheidung darüber, ob die
Schächtung aufgehoben wird oder nicht, liegt zur Zeit beim
Landeskommissar in Freiburg. Es dürfte der Behörde in Freiburg nicht
schwer fallen, Stadtrat und Landwirte von der Unsinnigkeit der Annahme,
dass gegen das Schächten ethische oder hygienische Bedenken sprechen, zu
überzeugen." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Abraham Hirsch von Grünstadt soll sich wegen
Geldunterschlagung bei seinem Dienstherrn Mayer Levy in Kirchen beim Gericht
melden (1825)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 1. Oktober 1825 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Ediktalladung.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 1. Oktober 1825 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Ediktalladung.
Abraham Hirsch von Grünstadt, im
niederrheinischen Departement, welcher im November vorigen Jahres eine
bedeutende Summe von den Ausständen seines damaligen Dienstherrn des Mayer
Levy, von Kirchen, eingezogen und sich flüchtig gemacht hat, wird
andurch aufgefordert, binnen 6 Wochen vor dem unterzeichneten Gerichte
sich zu stellen, und über den ihm zur Last liegenden unbefugten
Geldeinzug und die nachherige Entweichung zu verantworten, da er sonst des
ihm angeschuldigten Verbrechens der Geldunterschlagung für überwiesen
angesehen, und die Strafe auf Betreten gegen ihn vorbehalten würde.
Zugleich werden alle resp. obrigkeitlichen Behörden ersucht, auf diesen
Menschen, dessen Signalement unter steht, fahnden, im Betretungsfalle ihn
arretieren, und wohlverwahrt anher einliefern zu lassen.
Signalement. Abraham Hirsch misst ungefähr 5' 7", hat ein
längliches, hageres, braunes Gesicht, schwarzen Bart und Backenbart,
graue Augen, breite Nase, großen Mund, und hängt den Kopf etwas
vorwärts. Seine Kleidung bestand in einem grün manchesternen, schon
abgetragenen, halblangen Rocke mit metallenen Knöpfen, dergleichen lange
Hosen, einem Gilet von gestreiftem Wollenzeug, einer Kosaken-Kappe mit
Schild, und lange Stiefel.
Lörrach, den 7. November 1825. Großherzoglich badisches
Bezirksamt. Deurer." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom Januar 1826 S. 20 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Straferkenntnis.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom Januar 1826 S. 20 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Straferkenntnis.
In Untersuchungssachen gegen Abraham Hirsch, von Grünstadt,
im königlich französischen niederrheinischen Departement, wegen
Geldunterschlagung - hat das Großherzogliche Hochpreisliche Hofgericht
des Oberrheins auf ungehorsames Ausbleiben nach geschehener öffentlicher
Vorladung durch Urteil vom 9. dieses Monats. Crim. H.R. No. 3270. II. Sen.
zu Recht erkannt:
'Inculpat seye des Verbrechens, der an seinem Dienstherrn Mayer Levy zu
Kirchen, verübten Geldunterschlagung für überwiesen zu erklären,
und die gesetzliche Strafe auf dessen Betreten vorzubehalten.'
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Lörrach, den 16. Dezember 1825. Großherzoglich badisches
Bezirksamt." |
Die Untersuchung gegen Marx Bloch von Emmendingen
wegen Diebstahl an Salomon Bloch von Kirchen endet "klagfrei" (1847)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 8. Januar 1848 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Lörrach [Urteil] In Untersuchungssachen gegen Marx Bloch
von Emmendingen, wegen Diebstahls, wird auf amtspflichtiges Verhör zu
Recht erkannt: 'Marx Bloch sei der angeschuldigten Entwendung von 27 fl.
baren Geldes zum Nachteil des Salomon Bloch von Kirchen für
klagfrei zu erklären und mit den Untersuchungskosten zu
verschonen.' V.R.W.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 8. Januar 1848 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Lörrach [Urteil] In Untersuchungssachen gegen Marx Bloch
von Emmendingen, wegen Diebstahls, wird auf amtspflichtiges Verhör zu
Recht erkannt: 'Marx Bloch sei der angeschuldigten Entwendung von 27 fl.
baren Geldes zum Nachteil des Salomon Bloch von Kirchen für
klagfrei zu erklären und mit den Untersuchungskosten zu
verschonen.' V.R.W.
Dessen zur Urkunde ist gegenwärtiges Urteil nach der Verordnung des
großherzoglichen badischen Hofgerichts des Oberrheinkreises ausgefertigt
und mit dem größeren Gerichtsinsiegel versehen worden.
So geschehen Freiburg, den 22. Oktober 1847 Woll. (L.S.) Buisson.
Kohlhagen." |
Hinweis auf den in Kirchen geborenen Rabbiner Moses
Elieser Liberles (1824-1872)
| Rabbiner
Moses Elieser Liberles (geb. 1824 in Kirchen, gest. 1872 in Bretten):
studierte seit 1848 in Würzburg; war seit 1855 Bezirksrabbiner in
Bretten. |
| Weitere Angaben: Moses Elieser Liberles
ist als "Süßmann Lieberles" am 22. Mai 1824 in Kirchen
geboren. Er war ein Sohn von Elias Lieberles (Lieberleß, Liberles,
geb. 1765 als Sohn von Tias Lieberles und der Esther geb. Weil, gest.
1833), der bis 1822 als Vorsänger und Lehrer in
Rust, danach bis 1833 in
derselben Stellung in Kirchen tätig war. Elias Lieberles war in erster
Ehe verheiratet mit Sara geb. Günzburger (geb. um 1783 als Tochter
des Rabbiners Günzburger in Schmieheim, gest. 20.5.1821), mit der er
fünf Kinder hatte: Samuel (1810-1887, war als Webermeister und
Judenwirt in Kirchen tätig), Pfeiffer (1812-1874, war als
Trödler, später als Eisenbahnarbeiter tätig), Bernhard (war
später als Drehermeister tätig), David (1818), Resta (Esther, geb./gest.
1818). In zweiter Ehe war Elias Lieberles verheiratet mit Lina geb.
Sussmann (1797-1856) mit der er vier Kinder hatte: Süßmann
(1824), Joseph (1825-1876), Bärle (1827) und Vögele
(1829-1832). Süßmann Lieberles wird im Revolutionsjahr 1849 als
Mitglieder der Bürgerwehr in Kirchen genannt. Seit 1848 studierte er am
jüdischen Seminar und an der Universität in Würzburg; in dieser Zeit
hat er wohl als Vornamen Moses Elieser angenommen. 1855 wurde er
Bezirksrabbiner in
Bretten. wo er 1872 starb. |
Quellen: Buch "Schicksal und Geschichte der jüdischen Gemeinden Ettenheim - Altdorf - Kippenheim - Schmieheim - Rust -
Orschweier". 1988. S. 417. Albert Köberle: Ortssippenbuch Rust von Albert Köberle.
1969, S. 620.
Axel Hüttner: Die jüdische Gemeinde von Kirchen 1736-1940. 1978. S.
90.259-260. |
Zum Tod der drei ältesten Gemeindeglieder (1894)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1894: "Kirchen-Efringen,
12. Januar (1894). Innerhalb 8 Tagen wurden hier die 3 ältesten Leute
unserer israelitischen Gemeinde und zugleich des Dorfes zu Grabe getragen:
Abraham Blum 93 Jahre, David Bloch 89 Jahre und Frau Nathan Braunschweig
88 Jahre alt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1894: "Kirchen-Efringen,
12. Januar (1894). Innerhalb 8 Tagen wurden hier die 3 ältesten Leute
unserer israelitischen Gemeinde und zugleich des Dorfes zu Grabe getragen:
Abraham Blum 93 Jahre, David Bloch 89 Jahre und Frau Nathan Braunschweig
88 Jahre alt." |
Zum Tod von Veist Bloch (1896)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. November
1896: "Kirchen (Baden), 8. November (1896). Am 4. dieses
Monats verschied in Basel, wohin er sich infolge eines Fußleidens zur
Heilung begeben hatte, Herr Veist Bloch von hier. In ihm betrauert nicht
nur seine Frau ihren treuen Ehegatten, sondern auch die israelitische
Gemeinde ihren Vater; denn der Verstorbene wahrte als Vorsteher länger
denn zwölf Jahre mit Umsicht und treuer Pflichterfüllung die Interessen
derselben. Besonders durch die Restaurierung der Synagoge, die zum
größten Teil durch seine Bemühungen aus dem Zustande des Verfalls zu
einer Zierde unseres Ortes umgewandelt wurde, hat sich der Dahingegangene
großes Verdienst erworben. Es war darum auch ein unabsehbarer Trauerzug,
dessen Teilnehmer aus Fern und Nah herbeigeeilt waren, um den irdischen
Überresten das letzte Geleit zu geben. Mit gewohnter Meisterschaft
entrollte Herr Rabbiner Dr. Lewin aus Freiburg am Grabe ein Bild des
Verstorbenen, der es vom armen Eisenbahntaglöhner durch seinen Fleiß zu
einer geachteten Stelle im Orte brachte und bei Juden als auch Nichtjuden
in hohem Ansehen stand. Ehre seinem Andenken!". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. November
1896: "Kirchen (Baden), 8. November (1896). Am 4. dieses
Monats verschied in Basel, wohin er sich infolge eines Fußleidens zur
Heilung begeben hatte, Herr Veist Bloch von hier. In ihm betrauert nicht
nur seine Frau ihren treuen Ehegatten, sondern auch die israelitische
Gemeinde ihren Vater; denn der Verstorbene wahrte als Vorsteher länger
denn zwölf Jahre mit Umsicht und treuer Pflichterfüllung die Interessen
derselben. Besonders durch die Restaurierung der Synagoge, die zum
größten Teil durch seine Bemühungen aus dem Zustande des Verfalls zu
einer Zierde unseres Ortes umgewandelt wurde, hat sich der Dahingegangene
großes Verdienst erworben. Es war darum auch ein unabsehbarer Trauerzug,
dessen Teilnehmer aus Fern und Nah herbeigeeilt waren, um den irdischen
Überresten das letzte Geleit zu geben. Mit gewohnter Meisterschaft
entrollte Herr Rabbiner Dr. Lewin aus Freiburg am Grabe ein Bild des
Verstorbenen, der es vom armen Eisenbahntaglöhner durch seinen Fleiß zu
einer geachteten Stelle im Orte brachte und bei Juden als auch Nichtjuden
in hohem Ansehen stand. Ehre seinem Andenken!". |
Goldene Hochzeit des Herz Bloch'schen Ehepaares
(1913)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 14. November
1913: "Das Herz Bloch'sche Ehepaar in Kirchen (Baden) feierte
die goldene Hochzeit. Geheimrat Dörle überreichte die
Jubiläumsmedaille, der Synagogenrat im Auftrage des Oberrates der
Israeliten die Portraits des Großherzogpaares." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 14. November
1913: "Das Herz Bloch'sche Ehepaar in Kirchen (Baden) feierte
die goldene Hochzeit. Geheimrat Dörle überreichte die
Jubiläumsmedaille, der Synagogenrat im Auftrage des Oberrates der
Israeliten die Portraits des Großherzogpaares." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. November
1913: "Kirchen (Baden). Das Herz Bloch'sche Ehepaar feierte
die goldene Hochzeit. Geheimrat Dörle überreichte die
Jubiläumsmedaille, der Synagogenrat im Auftrage des Oberrates der
Israeliten die Porträts unseres Großherzogpaares. Auch der
Bürgermeister und der Pfarrer gratulierten persönlich." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. November
1913: "Kirchen (Baden). Das Herz Bloch'sche Ehepaar feierte
die goldene Hochzeit. Geheimrat Dörle überreichte die
Jubiläumsmedaille, der Synagogenrat im Auftrage des Oberrates der
Israeliten die Porträts unseres Großherzogpaares. Auch der
Bürgermeister und der Pfarrer gratulierten persönlich." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Nach der Emigration: Geburtsanzeige von Frances Helen
Kessler (1944, USA)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 31. März 1944: "We are happy to announce the arrival of our
daughter
Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 31. März 1944: "We are happy to announce the arrival of our
daughter
Frances Helen on March 24, 1944.
Alwin and Sophie Kessler née Braunschweig (formalery Giessen,
Lahn) - (formaly Efringen-Kirchen, Baden).
9 West 97th Streeet. New York City 25." |
Weiteres Dokument
(aus der Sammlung von Hansjörg Schwer, Waldshut-Tiengen)
Schreiben
an den Synagogenrat in Kirchen
- Mitteilung der Erhöhung der Diäten des
Rabbiners in Sulzburg (1868) |
 |
 |
| |
An
den Synagogenrath in Kirchen bei Efringen
Abschrift. Großherzoglicher Oberrath der Israeliten.
Karlsruhe, den 5ten Juni 1868
Die Erhöhung der Diäten der Rabbiner betr.
An das Bezirks Rabbinat Sulzburg
Gr. Ministerium des Inneren hat mittelst hoher Ver-
fügung vom 26ten v. Mts. No 6798 genehmigt daß den
Bezirks-Rabbinern bei auswärtigen Dienstver-
richtungen eine Diät von Vier Gulden und in der Zeit
vom 1. Oktbr bis zum letzten April ein Zuschlag von
10 Prozent berechnet werde.
Das dortige Rabbinat wird zu seiner Maßnahme
sowie zur Eröffnung an die betreffende Gemeinden
hiervon benachrichtigt.
Der Ministerial Commissär:
gez. W. Frey
Vermittelst Abschrift Nachricht hievon dem Srth Kirchen
Sulzburg 10. Juni 1868. Das Bez. Rabbinat
Dreyfuß. |
Zur Geschichte des Betsaales/Synagoge
Vermutlich war nach Aufnahme der
Dornacher Familien 1736 oder wenige Jahre später die Zehnzahl jüdischer
Männer vorhanden und es konnten Gottesdienste gefeiert werden, möglicherweise
zunächst gemeinsam mit den in Tumringen und Lörrach aufgenommenen Familien.
Eine der Bloch-Familien hat nach der Überlieferung aus Dornach eine Torarolle
mitgebracht, die noch bis ins 20. Jahrhundert erhalten, aber nicht sonderlich
gekennzeichnet war.
Bis 1789 wurden die Gottesdienste im Haus des Julius
Bloch abgehalten. Wegen Eigenbedarf seiner Räumlichkeiten wollte Bloch jedoch
im Frühjahr 1789 nicht mehr, dass die Gottesdienste in seinem Haus stattfinden.
Die jüdische Gemeinde, die damals aus neun Familien bestand, von denen nur zwei
bis drei "vermöglich" waren, wusste zunächst keinen Rat. Andere Räume standen
nicht zur Verfügung und für den Kauf eines Gebäudes zur Einrichtung einer
Synagoge war kein Geld vorhanden. Trotzdem ist es dann doch gelungen, die Mittel
für die Einrichtung einer Synagoge in einem anderen Gebäude zusammenzutragen.
Diese alte, vermutlich 1789/90 eingerichtete Synagoge bestand bis 1831
und wurde danach noch 40 Jahre lang (bis 1871) als Armenhaus der jüdischen
Gemeinde benutzt. 1871 hat die jüdische Gemeinde das Haus verkauft, da sie sie
damals noch immer 2.800 Gulden Schulden vom Bau der neuen Synagoge hatte.
Nach 1825 nahm die Zahl der jüdischen Einwohner in Kirchen
so zu, dass die bisherige Synagoge nicht mehr ausreichte (1825: 73, 1838: 122 jüdische
Einwohner). Die Gemeinde beschloss den Neubau einer Synagoge, der am 7. Oktober
1828 genehmigt wurde. Im Laufe des Jahres 1831 konnte man den Neubau
erstellen, in dem sich im Obergeschoss auch die Lehrer-/Vorsängerwohnung und in
einem Nebenhaus die Schule und das rituelle Bad befanden. Die neue Synagoge
wurde im Weinbrennerschen Stil erbaut. Ihre Vorderfront war von zwei
pylonartigen Türmen mit flachen, pyramidenförmigen Aufsätzen flankiert. Über
vier Stufen gelangte man in eine von zwei Säulen getragene Vorhalle. Über dem
Portal befand sich die aus Psalm 118,20 stammende, hebräische Inschrift:
"Dies ist das Tor zum Herrn, Gerechte ziehen durch es hinein" (mit
Jahreszahl (5)591 nach jüdischer Zählung = 1831). Im Inneren befand sich eine
zweiteilige Frauenempore, die nicht vergittert war. Die Außenverkleidung des
Toraschreines war aus dunkelrot marmoriertem Holz, flankiert von zwei Säulen.
Die Wände, die Decke und der Fußboden des Raumes waren völlig schmucklos. Für
den Bau der Synagoge hatte man freilich aus Geldmangel teils so schlechte
Materialien verwendet, dass schon wenige Jahre nach der Fertigstellung die
Klagen über schadhafte Teile, besonders der im Obergeschoss gelegenen
Lehrerwohnung nicht mehr abrissen.
Im Blick auf eine gründliche Renovierung der Synagoge führte
die Gemeinde 1895 in den umliegenden Gemeinden eine Spendensammlung
durch. Auch der badische Großherzog gab 100 Mark zu den Baumaßnahmen, worüber
sogar in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" berichtet wurde. Die
Renovierung 1896 durchgeführt. Die Synagoge hatte danach etwa 60 Plätze im
Betsaal der Männer und 30 Plätze auf der Frauenempore. Vorsteher der Gemeinde
während der Zeit der Renovierung war Veist Bloch. Er starb am 8. November 1896.
Im Nachruf auf ihn hieß es in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums": "Besonders
durch die Restaurierung der Synagoge, die zum größten Teil durch seine Bemühungen
aus dem Zustande des Verfalls zu einer Zierde unseres Ortes umgewandert wurde,
hat sich der Dahingegangene großes Verdienst erworben".
Eine Synagogenrestaurierung steht an -
Unterstützung durch den Großherzog (1895)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juli 1895:
"Kirchen (Baden), 2. Juli (1895). Die hiesige kleine Gemeinde
ist genötigt, die Synagoge zu restaurieren. Da die Mitte dazu ein wenig
knapp bemessen sind, hat sie sich an einige Schwestergemeinden gewendet,
sie möchten eine Beihilfe leisten. Dass dieser Aufruf überall Gehör
fand, wäre als selbstverständlich nicht erst berichtet worden - wenn
nicht ein Anderes Geschehen wäre. Der Synagogenrat hat sein Bittgesuch
auch dem Großherzog vorgetragen, und soeben geht die Nachricht ein, dass
unser Landesvater, der alle seine Bürger mit gleicher Huld empfängt,
auch unserer Bitte sein Ohr nicht verschlossen, vielmehr die Summe von
einhundert Mark uns zu bewilligen geruht hat! - Wir vermögen unsern Dank
nicht besser zu bekunden, als indem wir unsere Glaubensgenossen diesen
Beweis der gerechten Güte Großherzogs Friedrichs kunden, damit auch
außerhalb seines Landes frohe Herzen für ihn zum Himmel
beten!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juli 1895:
"Kirchen (Baden), 2. Juli (1895). Die hiesige kleine Gemeinde
ist genötigt, die Synagoge zu restaurieren. Da die Mitte dazu ein wenig
knapp bemessen sind, hat sie sich an einige Schwestergemeinden gewendet,
sie möchten eine Beihilfe leisten. Dass dieser Aufruf überall Gehör
fand, wäre als selbstverständlich nicht erst berichtet worden - wenn
nicht ein Anderes Geschehen wäre. Der Synagogenrat hat sein Bittgesuch
auch dem Großherzog vorgetragen, und soeben geht die Nachricht ein, dass
unser Landesvater, der alle seine Bürger mit gleicher Huld empfängt,
auch unserer Bitte sein Ohr nicht verschlossen, vielmehr die Summe von
einhundert Mark uns zu bewilligen geruht hat! - Wir vermögen unsern Dank
nicht besser zu bekunden, als indem wir unsere Glaubensgenossen diesen
Beweis der gerechten Güte Großherzogs Friedrichs kunden, damit auch
außerhalb seines Landes frohe Herzen für ihn zum Himmel
beten!" |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Gebäude zerstört.
Eine NS-Parteiformation, aus Haltingen kommend, unter der Führung des dortigen
Bürgermeister, plünderte die Synagoge, warf Ritualgegenstände und Geschirr,
das aus der über der Synagoge liegenden Lehrerwohnung stammte, auf die Straße
und in die anliegenden Gärten und zündete den Betsaal an. Die in Kirchen noch
verbliebenen jüdischen Einwohner wurden zusammengetrieben und mussten der Zerstörung
ihres Gotteshauses zusehen.
Die Ruine der Synagoge wurde bei der Kriegsbeschießung
Kirchens 1940 endgültig zerstört und 1945 abgebrochen. Heute ist nur noch ein
ca. 1 m hoher, 8 m langer Mauerrest erhalten; das Synagogengelände selbst wird
als Abstellfläche und als Garten genutzt (Grundstück hinter Basler Straße
57/Ecke Friedrich-Rottra-Straße, Lagerbuch-Nr. 263/264). Seit 1996 erinnert ein
Gedenkstein an die ehemalige Synagoge.
Fotos
Historische Fotos:
(Quelle: Fotos links und rechts bei Hundsnurscher/Taddey s. Lit. Abb. 39.41
und
Huettner s. Lit. im Bildanhang; Foto Mitte ist eine Ausschnittsvergrößerung
des linken Fotos)
 |
 |
 |
Außenansicht der
Synagoge Kirchen |
Das Portal mit der Inschrift
aus Psalm
118,20: "Dies ist das Tor zum HERRN,
Gerechte ziehen durch
es hinein" mit
hebräischer Jahreszahl (5)591 = 1831 |
Innenansicht
der Synagoge
|
| |
|
| |
|
|
 |
Links: Historische
Ansichtskarte von
Kirchen; die Synagoge ist links im
Hintergrund des
Gasthauses
"Zum Rebstock" zu erkennen
Quelle: Sammlung Hahn |
|
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
 |
 |
| |
Blick auf das Synagogengelände
(im Bereich des Holzstapels) |
dass., weiter
entfernte Perspektive |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Die rechts sichtbare Steinmauer
gehörte zu den Mauern der Synagoge |
Ansicht des
Synagogengrundstückes
aus anderer Blickrichtung
(Foto: Gemeinde Efringen-Kirchen) |
| |
| |
|
|
| |
|
|
Fotos 2003/04:
(Foto: Hahn, Aufnahmedatum 27.10.2003 bzw. mit *) von
J. Krüger, Karlsruhe, Aufnahmen Sommer 2004) |
|
 |
 |
 |
Gedenktafel für die Synagoge
am
jüdischen Friedhof der Gemeinde |
Gedenkstein unweit
des Synagogenstandortes* |
| |
| |
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Oktober
2010: Gedenken an die Deportation nach
Gurs im Oktober 1940 |
Artikel von Jochen Fillisch in der "Badischen Zeitung" vom 22.
Oktober 2010 (Artikel): "Schlimme Nazis und mutige Nachbarn
Heute vor 70 Jahren wurden auch Kirchener Juden ins südfranzösische Lager Gurs deportiert / Vertrieben waren sie schon vorher..
EFRINGEN-KIRCHEN. "Wiedergutmachen können wir nichts. Aber wir
können uns bemühen, das Gedenken zu erhalten", steht für Wolfgang
Weller fest. Heute ist wieder so ein Tag gegen das Vergessen: Vor genau 70
Jahren wurden 6500 Juden aus Baden und der Pfalz in das südfranzösische
Lager Gurs deportiert, darunter auch 22 Kirchener..." |
| |
| Oktober
2010: Gedenkfeier zur
Erinnerung an die Deportation nach Gurs |
Artikel von Reinhard Cremer in der
"Badischen Zeitung" vom 25. Oktober 2010 (Artikel): "Kirchen zeigen Scham und Reue
"Sprachlos, wo ein Aufschrei hätte hörbar werden müssen" / Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Judendeportation nach
Gurs.
EFRINGEN-KIRCHEN. Rund zwei Dutzend Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Feier teil, zu der das evangelische Distriktbüro aus Anlass des 70. Jahrestags der Deportation südbadischer Juden ins südfranzösische Internierungslager Gurs am Gedenkstein eingangs des jüdischen Friedhofs eingeladen hatte. Unter den Teilnehmern waren auch Bürgermeister Wolfgang Fürstenberger und der evangelische Pfarrer Steffen Mahler..."
|
| |
|
November 2014:
Auch in Efringen-Kirchen sollen
"Stolpersteine" verlegt werden |
Artikel von Jutta Schütz in der
"Badischen Zeitung" vom 8. November 2014: "Geschichte. Erinnerung an
NS-Opfer: Stolpersteinen steht nichts mehr im Weg.
Efringen-Kirchen. In Efringen-Kirchen soll ein neuer Versuch unternommen
werden, an die Geschichte der Juden in der Gemeinde zu erinnern.
EFRINGEN-KIRCHEN. 'Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen
ist'. Dieser Satz stammt aus dem Talmud, und unter diesem Motto verlegt der
in Berlin geborene Künstler Gunter Demnig seit dem Jahr 2000 in Deutschland
und Europa sogenannte Stolpersteine vor den Häusern, in denen Opfer der
NS-Zeit und damit viele jüdische Mitbürger lebten. Rosemarie Lange stellte
beim Bürgergespräch im Rathaus den Antrag, auch in Efringen-Kirchen über
Patenschaften Stolpersteine verlegen zu lassen. Sie stieß damit bei Zuhörern
und Gemeinderäten auf offene Ohren. Bürgermeister Wolfgang Fürstenberger
will den Antrag zur Beratung mit in den Gemeinderat nehmen. Bereits vor neun
Jahren hatte es in Efringen-Kirchen den Plan gegeben, mit Gunter Demnig für
das Verlegen von Stolpersteinen Kontakt aufzunehmen. Damals hatte sich
Diakon Horst Panzer aus Bad Bellingen für das Projekt stark gemacht. 'Seine'
Konfirmanden aus Efringen-Kirchen und Bad Bellingen hatten sich damals am
ökumenischen Projekt des 'Mahnmals für die deportierten Juden und Jüdinnen'
beteiligt und Gedenksteine für das
zentrale Mahnmal in Neckarzimmern und für den
jüdischen Friedhof in Efringen-Kirchen
angefertigt. 'Wir fanden die Idee, für die deportierten und ermordeten
jüdischen Mitbürger auch in Efringen-Kirchen Stolpersteine verlegen zu
lassen, ausgezeichnet und wollten Wolfgang Weller mit ins Boot nehmen, der
mit am besten über die Kirchener Juden informiert ist und die stets gut
besuchten Führungen auf dem jüdischen Friedhof anbietet", erinnert sich
Panzer. Weller aber protestierte vehement, berichtet Panzer. Er wolle nicht,
dass man den jüdischen Bürgern auf dem Kopf herumtrampelt – so habe er sich
ausgedrückt, weiß der Diakon noch. Panzer konnte die Reaktion nicht ganz
verstehen: 'Natürlich läuft man über die Steine – aber man beobachtet in
vielen Städten, in denen bereits Stolpersteine liegen, dass sie vielen
Fußgängern auffallen und diese dann nachlesen, wer im Haus, vor dem die
Steine liegen, gewohnt hat, wann er oder sie geboren und wo er oder sie
ermordet wurde – und das regt doch zum Nachdenken an', berichtet er aus
eigener Erfahrung. 2006 verlegte Demnig dann nicht in Efringen-Kirchen,
sondern nur in Müllheim Stolpersteine.
Rosemarie Lange berichtete, dass Deming mittlerweile 45 000 Stolpersteine in
Europa verlegt hat. Allein in 500 deutschen Städten und Gemeinden erinnern
die beschrifteten, goldfarbenen Kopfsteinpflastersteine an vom Terrorregime
der Nazis Verfolgte. 'Die Überlebenden und deren Nachkommen sind in das
Projekt mit einbezogen', berichtete sie. Finanziert wird die Verlegung der
Steine durch Spenden. Für Steine kann man eine Patenschaft übernehmen, die
120 Euro je Stein kostet. Die beiden Gemeinderätinnen Heike Hauk und Traudel
Töppler befürworteten den Antrag, Hauk ließ sich von Lange die Unterlagen
geben, die Fragen zu einer Genehmigung des Projekts behandeln. Bürgermeister
Fürstenberger versprach, sich kundig zu machen. 'Da es sich um eine
Verlegung von Gedenksteinen im öffentlichen Raum handelt und dazu auch der
Gehweg geöffnet wird, werden wir uns zunächst im Gemeinderat beraten', gab
er weiter."
Link zum Artikel |
| |
| September
2016: Auf den Spuren der jüdischen
Geschichte in Kirchen mit Wolfgang Weller |
Artikel von Regine
Ounas-Kräusel in der "Badischen Zeitung" vom 6. September 2016:
""Die Juden waren im Dorf integriert"
Wolfgang Weller führt seine rund 60 Zuhörer in die Geschichte der Juden in Kirchen ein.
EFRINGEN-KIRCHEN. "Die Juden waren im Dorf integriert." Dies betonte Wolfgang Weller in seinem Vortrag am jüdischen Friedhof von Kirchen immer wieder. Am europäischen Tag der jüdischen Kultur führte der ehemalige Lehrer seine rund 60 Zuhörer in die Geschichte der Juden in Kirchen ein und öffnete den Friedhof zur Besichtigung..."
Link zum Artikel: "Die Juden waren im Dorf integriert" (veröffentlicht am Di, 06. September 2016 auf badische-zeitung.de) |
| |
|
Oktober 2017:
Veranstaltung zur
200-jährigen jüdischen Geschichte in Kirchen |
Artikel in der "Weiler Zeitung"
vom 30. Oktober 2017: "Efringen-Kirchen 'Haben alle den gleichen Gott'.
Efringen-Kirchen (mao). An die rund 200-jährige jüdische Geschichte von
Kirchen, die mit dem Rassenwahn der Nazis ein jähes Ende fand, wurde bei
einem eindrucksvollen Abend am Sonntag im evangelischen Gemeindehaus
erinnert. Die Wurzeln der Gemeinde reichen zurück in den Raum Solothurn, aus
dem Juden vertrieben wurden. In dem vom Markgrafen zum Judenschutzdorf
erklärten Kirchen fanden sie ab 1736 eine neue Heimat. Dafür mussten sie ein
Judenschutzgeld entrichten. In Kirchen lebten sie ärmlich als Vieh- und
Weinhändler, als Trödler und Weber. Erst als die Juden 1865 die
Gleichberechtigung erhielten, begann ihr wirtschaftliche Aufschwung. Juden
wurden Kaufleute, Ärzte und Rechtsanwälte. Sie machten aber in Basel,
Freiburg oder Colmar Karriere, die Landflucht war allgegenwärtig. 1882
lebten noch 192 Juden im Dorf, die Zahl nahm danach stetig ab. Die Feuerwehr
und der Gesangverein 'Rhenus' wurden noch von Juden mitgegründet. Das Dorf
schien lange Zeit zu prosperieren, bis die Nazis 1933 das Ruder übernahmen
und am 10. November 38 unter Anleitung des Haltinger Bürgermeisters die
Synagoge schändeten. 'Die Kirchener Schuljugend musste danach das
zerstörerische Werk besichtigen', berichtete Axel Huettner. Das durch
französischen Beschuss stark beschädigte Gotteshaus wurde nach dem Krieg
abgetragen. Erhalten blieb der 1865 angelegte jüdische Friedhof in Kirchen,
ihn rührte selbst während der braunen Diktatur niemand an. Geschändet wurde
erst später, 'seit 1965 immer wieder', berichtete Huettner. Viel Lob zollte
er der Gemeinde, die den Friedhof sorgsam pflege. Bürgermeister Philipp
Schmid betonte, dass man die Erinnerung an dieses geschichtliche Erbe auch
künftig wachhalten wolle. Nach dem Holocaust kamen keine Überlebenden nach
Kirchen zurück. Ein Deportierter und einer der wenigen den Holocaust
überlebenden Juden ließen sich später in Steinen nieder und eröffneten dort
eine Metzgerei, antwortete Huettner auf eine Besucherfrage. 'Und welche
Rolle hatte die Kirche in der Zeit?', fragte ein anderer Zuhörer. Huettner
sprach von hellen und tief dunklen Seiten, die zu beleuchten allerdings
abendfüllend seien. Herbert Bräunlin, der kürzlich mit 94 Jahren verstorbene
Zeitzeuge, hatte sich indes noch gut an den regimetreuen Nazipfarrer von
Kirchen erinnert. Rachel Scheinker, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in
Lörrach, berichtete vom heutigen Leben der liberal orientierten jüdischen
Gemeinde in der Kreisstadt. 'Unser Haus ist offen für alle', warb die seit
1985 in Deutschland lebende Israelin und hob die drei Säulen jüdischen
Glaubens hervor: Glauben, Arbeit und Nächstenliebe. 'Wir haben alle den
gleichen Gott', erinnerte Moderator Stefan Hoffmann abschließend an die im
Alten Testament verankerten gemeinsamen Wurzeln des jüdisch-christlichen
Glaubens. Der Abend wurde von der Paradise House Band unter Leitung von Roy
Paraiso umrahmt. Er hatte auch die Idee zu der Veranstaltung, holte die
evangelische und jüdische Gemeinde mit ins Boot. Eine Neuauflage und weitere
Begegnungen zwischen Juden und Christen sollen folgen. Krankheitsbedingt
musste Rabbi Yael Nesinholz von der Israelitischen Gemeinde Basel absagen."
Link zum Artikel |
| |
|
November 2019:
Gedenkveranstaltung zum
Novemberpogrom 1938 |
Artikel in der "Weiler Zeitung"
vom 20. Oktober 2019: "Efringen-Kirchen Gedenkveranstaltung gegen
Fremdenhass
Efringen-Kirchen. Das Organisationsteam um Diakon Roy Paraiso hat eine
Veranstaltung zum Gedenken an die Reichspogromnacht organisiert. Dabei steht
die Frage 'Nie wieder... oder doch wieder?' im Fokus, die durch den Anschlag
auf eine Synagoge in Halle bedrückende Aktualität gewonnen hat, so die
Organisatoren. Denn mehr als 80 Jahre nach der Reichspogromnacht im Jahr
1938 sei nicht nur Antisemitismus, sondern auch Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit im Alltag präsent. 'Auch ohne ein unterdrückendes
Regime macht sich Gleichgültigkeit in unserer Gesellschaft breit, anstatt
Zivilcourage', heißt es in einer Pressemitteilung. Populisten seien auf dem
Vormarsch, und anstatt vernünftige Argumente zu hören, bleibe immer öfter
die Wahrheit auf der Strecke.
Zum Gedenken an die Reichspogromnacht wird ein Vortrag von Robert Neisen im
Teehüsli (Chrischonagemeinde Efringen-Kirchen) am 9. November ab 19 Uhr
stattfinden. Neisen ist Geschichtswissenschaftler und Politologie an den
Universitäten Freiburg und Madrid. Er hat mit seinem Buch 'Zwischen
Fanatismus und Distanz' die Geschichte von Lörrach und dem Landkreis während
des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Momentan arbeitet Neisen für die
Stadt Freiburg an der Ausstellung 'Nationalsozialismus in Freiburg'. Auch
ist er einer der Autoren der Stadtgeschichte von Villingen-Schwenningen. In
seinem Vortrag geht der Historiker auf die lang- und kurzfristigen Ursachen
des Judenhasses im nationalsozialistischen Deutschland ein, so die
Veranstalter. Er beleuchtet die innen- und außenpolitische Dynamik, die zu
den Pogromen am 9. und 10. November 1938 führten und schildert am Beispiel Kirchens und anderer badischer Gemeinden das konkrete Ereignis der
Pogromnacht selbst. Zum Schluss seines Vortrags wird der Historiker auf die
Funktionen, die antisemitische und fremdenfeindliche Denkweisen heute wie
damals haben, eingehen und zeigen, wie man ihnen am besten begegnen kann,
heißt es in der Ankündigung der Veranstalter."
Link zum Artikel |
| |
|
September 2020:
Auf den Spuren der jüdischen
Geschichte in Kirchen |
Artikel von Reinhard Cremer in
der "Weiler Zeitung" vom 6. September 2020: "Efringen-Kirchen Die
Kirchener und die Juden
Anlässlich des Tags der jüdischen Kultur hat Museumsleiterin Maren
Siegmann gestern rund 50 Bürger unter dem Titel 'Die Kirchener, die Juden
und das normale Leben um 1800' durch Kirchen geführt. Geboten wurden
interessante Einblicke und Hintergründe.
Efringen-Kirchen. Zahlreiche Urkunden und Bilder in Kopieen hatte
Siegmann im Gepäck, wobei sie sich auf die Zeit des 18. und frühen 19.
Jahrhunderts konzentrierte. Immerhin belief sich die jüdischen Bevölkerung
im Jahr 1870 auf 192 Personen.
Die ersten Juden. Die ersten jüdischen Familien in Kirchen stammten
aus Dorneck (Dornach), das sie 1730 innerhalb von vier Wochen hatten
verlassen müssen. Der Grund dafür, dass sich viele von ihnen in Kirchen
ansiedelten, sei möglicherweise, dass der Markgraf in der Mühle Gutenau eine
'Absteige' hatte, vermutete Siegmann. Geduldet aber wurden sie nur gegen ein
'Schutzgeld' – daher rührte der Begriff 'Schutzjuden'. Jeder dieser
Schutzjuden hatte 30 Gulden pro Jahr Schutzgeld zu entrichten. Mit dem Tod
des jeweiligen Markgrafen erlosch auch der Schutzbrief und musste neu
beantragt werden. Die Gemeinde Kirchen hatte kein Mitspracherecht.
Zugebilligt wurde die Haltung von einer Kuh und einem Ross. Diese durften
anfangs nur am Straßenrand weiden. Schon damals hatten die (christlichen)
Kirchener Bürger mehr Rechte als die zugezogenen 'Hintersassen'. Dennoch
'durften' sie die durch den Krieg 1743/44 von den Franzosen auferlegten
Lasten mittragen.
Die Lebensgrundlage. Da den Juden die Landwirtschaft und die Ausübung
eines handwerklichen Berufes untersagt war, blieb ihnen in der Regel nichts
anderes als der Handel und der Geldverleih. Die meisten Juden handelten mit
Vieh. Einige, die als Hausierer übers Land zogen, handelten auch mit Zucker
und dem damals sehr wertvollen Kaffee. Er wurde als 'böse' verunglimpft, da
er teuer war und die Frauen angeblich verführte, sich zu Kaffeekränzchen
zusammenzusetzen und dabei ihre Arbeit zu vernachlässigen. Dass der
Hausierhandel nicht ganz ungefährlich war, belegt das Schicksal eines
Hausierers, der im Jahr 1757 auf der Landstraße bei Kirchen ermordet
aufgefunden wurde. Hausierer waren quasi Freiwild. Im Jahr 1767 erhielt der
Apotheker Romann vom Markgraf das Privileg für einen Specerei- und Kramladen
an der Basler Straße. Dabei handelte es sich eher um einen
Gemischtwarenladen. Somit wurden die Apotheken zur Konkurrenz für die
jüdischen Hausierer.
Der Viehhandel. Der Viehmarkt in Kirchen fand auf dem Woogplatz
statt. Voraussetzung für die Juden war, dass sie sich den Handel mit Vieh
überhaupt leisten konnten. Unklar ist, ob zuerst der spezialisierte Jude
oder der Viehmarkt da war. Bereits im 18. Jahrhundert gab es das, was
Siegmann die 'Leasing-Kuh' nannte. Dieser Kauf auf Raten ermöglichte es
vielen Bauern erst, sich eine Kuh zuzulegen. Zum jüdischen Viehhandel
gehörte auch eine jüdische Schlachterei. Mit Samuel Ruf aus Blotzheim ist im
Jahr 1766 der erste jüdische Metzger aktenkundig. Da die Bevölkerungszahl
stark anstieg, wurde ein Drittel der Weideflächen in Ackerland umgewandelt,
was wiederum die Existenz derer bedrohte, die vom Viehhandel lebten. Große
Veränderungen brachte der Bahnbau mit sich. Dadurch verlagerten sich die
Viehmärkte vom Land in die Stadt. Das war der finanzielle Gau für die
ländlichen Viehhändler.
Mit Geselligkeit. Im 'Gasthaus Linde', eine jüdische Wirtschaft,
wurde an Fest- und Feiertagen gerne gefeiert und getanzt. Das aber war in
den Augen der Obrigkeit sehr gefährlich, da das Tanzen unter anderem zum
'Schwelgen, zu Unfug und Unsittlichkeit' verleitete. Außerdem führte es, so
die Argumentation, bei der jüdischen Jugend zu Verschwendung von Geld, das
sie nicht hatte, und infolge dessen zu bösen Taten.
Synagogen. Im Jahr 1795 wurde an der Friedrich-Rottra-Straße die
erste Synagoge in Kirchen errichtet. Nach dem Neubau der zweiten Synagoge im
Jahr 1831 nutzte man sie als 'Armenhaus' genutzt. Die Beherbergung armer
Juden wurde als religiöse Verpflichtung angesehen. Die zweite Synagoge war
dann der Mittelpunkt jüdischen Lebens in Kirchen. Unter dem Beschuss der
Franzosen wurde sie im Jahre 1940 so beschädigt, dass sie später abgetragen
werden musste. Ab 1861 erteilten die Verantwortlichen den Juden die volle
Gleichstellung mit der übrigen Bevölkerung. Das heißt, auch die Wahl ihres
Wohnorts war ihnen nun freigestellt, was die Abwanderung vieler in die
Städte zur Folge hatte."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 70ff. |
 | Axel Huettner: Die jüdische Gemeinde von Kirchen
1736-1940. 1978.1993³. |
 | Verena Alborino: Juden auf dem Land: Das Dorf
Kirchen, in: Markgräflerland 1996/1 S.127-137. |
 | Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -
Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from
their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem
1986. S. 478-481. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Kirchen. The
first Jewish families arrived in 1736 after being expelled from Switzerland and
were subjected to numerous disabilities and restrictions. The community began to
grow toward the end of the century and its economic situation improved with
inclusion in the Dutchy of Baden in the early 19th century. A synagogue
was built in 1831 and a cemetery was opened
in 1865, with the Jewish population reaching a peak of 192 in 1873,
characterized by its exceptionally low mean age and high natural increase.
Thereafter emigration was stepped up and the birthrate declined. A measure of
prosperity was achieved in the early 20th century, but the community was hard
hit in the post-world war I economic crisis. In 1933, 60 Jews remained (including
seven in neighboring Efringen). On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue
was burned and men were detained in the Dachau concentration camp. With the
outbreak of war in September 1939, the entire population was evacuated, the Jews
mostly to Konstanz. Ultimately, 21
emigrated, nine left for other German cities, and 26 were deported (five
surviving).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|