|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zu den
"Synagogen im Kreis Hersfeld-Rotenburg"
Bebra mit
Orten der Umgebung (Kreis Hersfeld-Rotenburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Bebra bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht
in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück. Bereits im 16. Jahrhundert werden
jüdische Einwohner genannt, darunter nach einem Dokument des Staatsarchivs
Marburg im Sommer 1585 die jüdischen Pferdehändler Susmann und Jost zu
Bebra.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts lebten zwei jüdische Personen
(beziehungsweise Familien) am Ort. 1744 wurden 13 jüdische Familien gezählt,
dieselbe Zahl 1789.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1812 26 jüdische Familien, 1835 80 jüdische Einwohner (6,9 % von
insgesamt 1.164 Einwohnern), 1842 90 (von 1281), 1861 111 (7,9 % von 1.404),
1871 98 (5,8 % von 1.679), 1885 145 (6,3 % von 2.303), 1895 120 (4,7 % von
2.570), 1905 109 (3,3 % von 3.317). Zur jüdischen Gemeinde zählten (teilweise
erst seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts)
die in Iba
(1835 46, 1861 27 jüdische Einwohner), Ronshausen
(1835 19, 1861 27; gehörten zur Gemeinde in Solz, seit 1884 zu Bebra) und Weiterode
(1835 18, 1861 19) lebenden jüdischen Personen.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine Jüdische
Volksschule (spätestens seit 1868 mit damals 18 Schülern; Schülerzahlen
in der Folgezeit: 1876 16, 1885 28, 1894 30, 1900 15, 1903-05 10 Schüler), ein
rituelles Bad und seit 1869 einen eigenen Friedhof
(zuvor Beisetzungen in Rotenburg a.d. Fulda). Zur Besorgung religiöser Aufgaben
der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der teilweise zugleich als
Vorbeter und Schochet fungierte. Als Lehrer sind bekannt: um 1866 S. Grünthal (Quelle),
später der 1900 in jungen Jahren verstorbene Lehrer Weingarten (siehe Bericht
zu seinem Tod unten); nach ihm Lehrer Seligmann Stahl (der auch in Felsberg,
Guxhagen und Rotenburg
a.d. Fulda Unterricht erteilte, gest. 1917, Grab auf dem jüdischen
Friedhof Bebra), zuletzt (von 1919 bis 1935) Männy
Rosenbusch. Die Gemeinde gehörte zum Kreisrabbinat in Rotenburg a.d. Fulda.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Leutnant Albert
Apfel (geb. 3.5.1893 in Bebra, gef. 1.5.1918), Sally Lindau (geb. 7.4.1882 in
Bebra, gef. 26.10.1917), Arnold Oppenheim (geb. 15.11.1891 in Bebra, gef.
7.4.1915), Moritz Georg Oppenheim (geb. 26.1.1887 in Bebra, vermisst seit
13.9.1914) und Leopold Rothfels (geb. 7.11.1893 in Ronshausen, gef. 6.10.1916).
Außerdem sind gefallen: Moritz Oppenheim (geb. 18.11.1873 in Bebra, vor 1914 in
Eschwege wohnhaft, gef. 29.11.1918) und Gefreiter Julius Sommer (geb. 29.11.1880
in Bebra, vor 1914 in Karlsruhe wohnhaft, gef. 7.10.1918).
Um 1925, als zur Gemeinde noch 136 Personen gehörten (2,8 % von
insgesamt 4.830 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher M. Abraham und S. Katz.
Als Lehrer war seit 1919 der bereits genannte Männy Rosenbusch tätig, als
Synagogendiener G. Rülf. An der Jüdischen Volksschule wurden noch 11 jüdische
Kinder unterrichtet. An jüdischen Vereinen gab es: 1. den Krankenpflegeverein
Bikkur-Cholim (1924/32 unter Leitung von J. Fackenheim mit 1924 13
Mitgliedern, 1932 18 Mitglieder; Zweck und Arbeitsgebiet: Krankenpflege), den Wohltätigkeitsverein
Gemillus Chassodim (gegründet 1832, 1924 unter Leitung von M. Rothfels
mit 18 Mitgliedern; 1932 unter Leitung von F. Rothfeld mit 16 Mitgliedern, Zweck
und Arbeitsgebiet: Unterstützung Hilfsbedürftiger), den Talmud Tora-Verein
(1924 unter Leitung von W. Levi mit 22 Mitgliedern), den Israelitischen Frauenverein
(gegründet 1860, 1924 unter Leitung von Frau Fackenheim mit 35 Mitgliedern,
1932 unter Leitung von Lina Apfel mit 33 Mitglieder, Zweck und Arbeitsgebiet:
Wohltätigkeit und Krankenpflege), den Literaturverein (1925 unter
Leitung von Lehrer Rosenbusch mit 70 Mitgliedern), die Israelitische Begräbniskasse
(1924 unter Leitung von W. Levi mit 30 Mitgliedern) sowie den Synagogenchorverein
(1924 unter Leitung von Lehrer Rosenbusch mit 28 Mitgliedern). 1932 waren
die Gemeindevorsteher M. Abraham (1. Vors.) und E. Apfel (2. Vors.). Weiterhin
war Lehrer Männy Rosenbusch in der Gemeinde tätig. Im Schuljahr 1931/32 hatte
er an der Jüdischen Volksschule jedoch nur noch 5 Kinder zu unterrichten.
Nach 1933 ist ein
großer Teil der
jüdischen Gemeindeglieder (1933: 135 jüdische Einwohner) auf Grund der zunehmenden Entrechtung,
der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts und der
Repressalien weggezogen (viele nach Frankfurt) beziehungsweise ausgewandert (13
in die USA, 1 nach Südamerika, 5 nach Südafrika, 3 nach Palästina, 7 nach
England / Frankfreich). Die jüdische Schule wurde zum 1. Januar 1934
aufgelöst. Beim Novemberpogrom
1938, der in Bebra bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober durch
auswärtige SS- und einheimische SA-Männer durchgeführt wurde, wurden die Inneneinrichtung der Synagoge
und der Jüdischen Schule wie auch die Einrichtung von
jüdischen Wohnungen und Geschäften völlig verwüstet. In der Nacht vom
9. auf den 10. November 1938 wurden erneut die Wohnhäuser jüdischer Familien
überfallen; das Mobiliar wurde herausgeholt und auf dem damaligen
"Adolf-Hitler-Platz" verbrannt. Letzter Vorsitzender der jüdischen
Gemeinde war Levi Oppenheimer. Er verließ Bebra 1938 und zog nach Frankfurt.
Lehrer Rosenbusch hatte die Gemeinde bereits 1935 verlassen und konnte über
Worms in die USA emigrieren.
Von den in Bebra geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ida Abraham geb. Fackenheim (1884), Joseph Abraham
(1869), Leo Abraham (1906), Leopold Abraham (1907), Louise Abraham geb. Jüngster (1878), Pauline
Abraham geb. Plaut (), Walter Abraham (1921), Helene Apfel geb. Fackenheim
(1866), Ludwig Apfel (1904), Helene Döllefeld (1868), Klara Döllefeld geb. Wallach (1889), Mathilde Döllefeld
(1872), Siegfried Döllefeld (1874), Walter Döllefeld (1910), Carolina
Dörnberg geb. Stern (1859), Else Fassbender geb. Katz (1894), Sophie Frank geb.
Jüngster (1878), Meta Fulda geb. Oppenheimer (1892), Selmar Ganz
(1875), Fritz (Friedrich) Goldschmidt (1888), Paula Goldschmidt (1880), Rosa
Horn geb. Oppenheimer (1875), Alfred Katz (1928), Reni Katz geb. Ochs
(1903), Walter Katz (1895), Meta Kruepke (1878), Alfred Levi (1915), Betty Levi geb. Frank (1892),
Franzel Levi (), Hedwig Levi geb. Wallach (1887), Julius Levi (1885), Karoline
Levi geb. Oppenheimer (1877), Leopold Levi (1897), Martha Levi geb. Frank
(1902), Max Levi (1881), Moses Levi (1877), Moses Levi (1881), Recha Levi geb.
Kuhl (1887), Louis Lindau (1874), Martha Lindau
geb. Baumgarten (1890), Mathilde Lindau (1870), Moritz Lindau (1877), Hedwig Löser geb. Döllefeld (1880), Jenny Mielzynski geb. Oppenheim (1873), Herta (Hanna)
Moses geb. Abraham (1905), Moritz Moses (1902), Moses Moses (1940), Pauline
Moses (1933), Ruth Neuhaus (1918), Albert Oppenheim (1888), Egon Oppenheim
(1925), Fritz Oppenheim (1888), Heinz Oppenheim (1925), Jenny Oppenheim geb. Grunsfeld (1877), Johanna
Oppenheim geb. Abraham (1876), Klara Oppenheim geb. Lichtenstein (1881), Kurt
Oppenheimer (1930), Leopold Oppenheimer (1883), Marie
Oppenheim geb. Ochs (1912), Mathilde (Male) Oppenheim geb. Tannenberg (1875), Theodor
Oppenheim (1886), Willy Oppenheim (1868), Ida
Plaut geb. Stern (1869), Frieda Redelmeier geb. Apfel (1890), Berta Rothfels
(1887), Else Rothfels geb. Fackenheim (1895), Isidor Rothfels (1896), Roni Rothfels
(1898), Theodor Rothfels (1901), Rachel Silbertang (1893), Kathinka Stein geb.
Goldschmidt (1884), Josef Stern (1870),
Jenny Süsskind geb. Wallach (1890), Sally Süsskind (1883), Julius Weingarten
(1911), Herbert Wertheim
(1888).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Jahresversammlung der jüdischen Lehrer Hessens in
Bebra (1874)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. August 1874: "Kassel, 10. August (1874). [Jahresversammlung
der jüdischen Lehrer Hessens zu Bebra]. In dem am Kreuzungspunkt
zweier Eisenbahnen günstig gelegenen Bebra fand am 12. Juli dieses
Jahres die jährliche Konferenz der jüdischen Lehrer Hessens unter
Leitung des Seminarlehrers Dr. Stein aus Kassel statt. Nachdem der
Vorsitzende die Anwesenden, etwa dreißig an der Zahl, begrüßt und die
Namen derjenigen, die ihre Abwesenheit entschuldigt, verlesen hatte,
gedachte derselbe der seit der vorigen Jahresversammlung verstorbenen
Lehrer Lewisohn - Langenselbold,
Fleischhacker - Niederaula
und Plaut - Neustadt. Er
hob namentlich die Verdienste Lewisohns hervor, wie derselbe als
tüchtiger Lehrer von anerkannter Wirksamkeit dagestanden; wie es nicht
leicht eine Frage von erziehlicher oder unterrichtlichter Bedeutung
gegeben, die nicht von ihm in Versammlungen und Konferenzen mitberaten
worden sei; und wie sich die allgemeine Teilnahme an dem herben Geschick
seiner Familie in so erhebender Weisekundgegeben. Auch auch die beiden
anderen Verblichenen seien Freunde der öffentlichen Sache und Förderer
der gemeinschaftlichen Bestrebungen gewesen. Die Versammlung ehrte ihr
Andenken durch Erheben von den Sitzen...
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. August 1874: "Kassel, 10. August (1874). [Jahresversammlung
der jüdischen Lehrer Hessens zu Bebra]. In dem am Kreuzungspunkt
zweier Eisenbahnen günstig gelegenen Bebra fand am 12. Juli dieses
Jahres die jährliche Konferenz der jüdischen Lehrer Hessens unter
Leitung des Seminarlehrers Dr. Stein aus Kassel statt. Nachdem der
Vorsitzende die Anwesenden, etwa dreißig an der Zahl, begrüßt und die
Namen derjenigen, die ihre Abwesenheit entschuldigt, verlesen hatte,
gedachte derselbe der seit der vorigen Jahresversammlung verstorbenen
Lehrer Lewisohn - Langenselbold,
Fleischhacker - Niederaula
und Plaut - Neustadt. Er
hob namentlich die Verdienste Lewisohns hervor, wie derselbe als
tüchtiger Lehrer von anerkannter Wirksamkeit dagestanden; wie es nicht
leicht eine Frage von erziehlicher oder unterrichtlichter Bedeutung
gegeben, die nicht von ihm in Versammlungen und Konferenzen mitberaten
worden sei; und wie sich die allgemeine Teilnahme an dem herben Geschick
seiner Familie in so erhebender Weisekundgegeben. Auch auch die beiden
anderen Verblichenen seien Freunde der öffentlichen Sache und Förderer
der gemeinschaftlichen Bestrebungen gewesen. Die Versammlung ehrte ihr
Andenken durch Erheben von den Sitzen...
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
Zum Tod von Lehrer Weingarten (1900)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1900: "Bebra, 22.
Dezember (1900). Heute haben wir die Überreste eines wackeren Mannes dem
Schoße der Erde überantwortet. Unser Lehrer, Herr Weingarten, ist uns im
37. Jahre seines Lebens durch den unerbittlichen Tod entrissen worden. Länger
als ein Jahr leidend, ertrug er sein Siechtum in Geduld und Ergebung. Um
den teuren Verblichenen trauern außer Weib und Kind, ein bejahrter Vater
und mehrere Schwestern, die in dem Bruder eine Stützte dahinsinken sehen,
die Gemeindemitglieder, die einen pflichttreuen Lehrer verloren haben. Ein
stattliches Gefolge, dem sich der Königliche Herr Ortsschulinspektor und
zahlreiche nichtjüdische Lehrer angeschlossen hatten, gab dem edlen
heimgegangenen das Geleite zu seiner letzten Ruhestätte. Die Lehrer des
Lehrergesangvereins Bebra trugen vor dem Sterbehause und am Grabe
ergreifende Lieder in ergreifender Weise vor. In längerer, nach Form und
Inhalt gleich ausgezeichneter Weise schilderte Herr Kreisrabbiner Strauß
– Rotenburg die Eigenschaften des Verklärten als Mensch, Familienvater
und als Lehrer. Einem letzten Wunsche des Entschlafenen zufolge sprach
sein Freund, Herr Lehrer Spiro aus Schenklengsfeld am Grabe. Von Rührung
überwältigt gab der letztgenannte Redner unter Zugrundlegung einer
passenden Midraschstelle seinem Schmerz über den Heimgang seines
geliebten Freundes Ausdruck. Es waren erschütternde Worte, die, aus dem
Herzen kommend, ihren Weg zum Herzen nahmen. Möge der Allgütige den
trauernden Hinterbliebenen den Trost spenden, der Er nur allein zu geben
vermag!" Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1900: "Bebra, 22.
Dezember (1900). Heute haben wir die Überreste eines wackeren Mannes dem
Schoße der Erde überantwortet. Unser Lehrer, Herr Weingarten, ist uns im
37. Jahre seines Lebens durch den unerbittlichen Tod entrissen worden. Länger
als ein Jahr leidend, ertrug er sein Siechtum in Geduld und Ergebung. Um
den teuren Verblichenen trauern außer Weib und Kind, ein bejahrter Vater
und mehrere Schwestern, die in dem Bruder eine Stützte dahinsinken sehen,
die Gemeindemitglieder, die einen pflichttreuen Lehrer verloren haben. Ein
stattliches Gefolge, dem sich der Königliche Herr Ortsschulinspektor und
zahlreiche nichtjüdische Lehrer angeschlossen hatten, gab dem edlen
heimgegangenen das Geleite zu seiner letzten Ruhestätte. Die Lehrer des
Lehrergesangvereins Bebra trugen vor dem Sterbehause und am Grabe
ergreifende Lieder in ergreifender Weise vor. In längerer, nach Form und
Inhalt gleich ausgezeichneter Weise schilderte Herr Kreisrabbiner Strauß
– Rotenburg die Eigenschaften des Verklärten als Mensch, Familienvater
und als Lehrer. Einem letzten Wunsche des Entschlafenen zufolge sprach
sein Freund, Herr Lehrer Spiro aus Schenklengsfeld am Grabe. Von Rührung
überwältigt gab der letztgenannte Redner unter Zugrundlegung einer
passenden Midraschstelle seinem Schmerz über den Heimgang seines
geliebten Freundes Ausdruck. Es waren erschütternde Worte, die, aus dem
Herzen kommend, ihren Weg zum Herzen nahmen. Möge der Allgütige den
trauernden Hinterbliebenen den Trost spenden, der Er nur allein zu geben
vermag!" |
Sitzung des Ausschusses der israelitischen
Lehrerkonferenz Hessens in Bebra (1912)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. Januar 1912: "Kassel, 19. Januar (1912).
Wie in einer zu Bebra stattgehabten Sitzung des Ausschusses der
israelitischen Lehrkonferenz Hessens mitgeteilt wurde, hat die
Regierung zu Kassel eine Verfügung erlassen, wonach die israelitischen
Lehrer nur den die Volksschule besuchenden Kindern Religionsunterricht zu
erteilen haben. Der anderen israelitischen Kindern, namentlich Schülern
höherer Schulen erteilte Religionsunterricht gilt als
Nebenbeschäftigung, bedarf der Genehmigung der Schulbehörde und muss
besonders honoriert werden. Dieser Entscheid ist für manchen Lehrer, aber
auch für die israelitischen Gemeinden von wesentlicher
Bedeutung",
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. Januar 1912: "Kassel, 19. Januar (1912).
Wie in einer zu Bebra stattgehabten Sitzung des Ausschusses der
israelitischen Lehrkonferenz Hessens mitgeteilt wurde, hat die
Regierung zu Kassel eine Verfügung erlassen, wonach die israelitischen
Lehrer nur den die Volksschule besuchenden Kindern Religionsunterricht zu
erteilen haben. Der anderen israelitischen Kindern, namentlich Schülern
höherer Schulen erteilte Religionsunterricht gilt als
Nebenbeschäftigung, bedarf der Genehmigung der Schulbehörde und muss
besonders honoriert werden. Dieser Entscheid ist für manchen Lehrer, aber
auch für die israelitischen Gemeinden von wesentlicher
Bedeutung", |
Verlobungsanzeige von Betty Blumenthal und Lehrer
Männy Rosenbusch (1928)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. Mai 1928: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. Mai 1928:
"Wir geben unsere Verlobung bekannt:
Betty Blumenthal Lehrer Männy Rosenbusch
Fulda Mittelstraße 47 - Bebra
Pfarrstraße 6". |
Israelitische Lehrerkonferenz in Bebra (1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 30. Mai 1930: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 30. Mai 1930:
Der Bericht ist noch nicht abgeschrieben - zum Lesen bitte
Textabbildung anklicken |
Die drei Konfessionsschulen in Bebra sollen zu
einer Simultanschule zusammengelegt werden (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. September 1931: "Bebra.
Schulzusammenlegung. Wie wir den 'K.N.N.' (Kasseler Neueste
Nachrichten) entnehmen, wird geplant, die drei Volksschulen in Bebra,
und zwar die evangelische mit zirka 600, die katholische mit 30, und die
jüdische mit 10 Schülern zu einer einzigen Simultanschule
zusammenzulegen. Dadurch würden neben den Sachkosten auch zwei
Lehrkräfte eingespart. Von Seiten der Gemeinde Bebra und der Lehrerschaft
wird der Plan gefördert, während sich die Religionsgemeinschaften
ablehnend dazu verhalten." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. September 1931: "Bebra.
Schulzusammenlegung. Wie wir den 'K.N.N.' (Kasseler Neueste
Nachrichten) entnehmen, wird geplant, die drei Volksschulen in Bebra,
und zwar die evangelische mit zirka 600, die katholische mit 30, und die
jüdische mit 10 Schülern zu einer einzigen Simultanschule
zusammenzulegen. Dadurch würden neben den Sachkosten auch zwei
Lehrkräfte eingespart. Von Seiten der Gemeinde Bebra und der Lehrerschaft
wird der Plan gefördert, während sich die Religionsgemeinschaften
ablehnend dazu verhalten." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Kritik an den liberalen Zuständen in Bebra
(1865)
In diesem Bericht wird über aus orthodox-jüdischer Sicht sehr
kritisch über die religiösen Zustände in Kurhessen geschrieben und das fromme
Gudensberg dem scharf kritisierten, liberalen Bebra
gegenübergestellt.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus
Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres
geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,
während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich
erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen
Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein
sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur
durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht
aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man
bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der
Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern
die Neuerungssucht begünstigt wird. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Aus
Kurhessen (Provinz Niederhessen). Der Korrespondent Ihres
geschätzten Blattes aus Kassel bringt Ihnen nur Nachrichten aus dieser Stadt,
während er das Innere unseres Landes ganz unberücksichtigt lässt. Ich
erlaube mir daher, den Lesern dieses Blattes ein Bild von den religiösen
Zuständen unserer Provinz zu entwerfen. Es wird dies nun freilich kein
sehr erfreuliches sein, denn viele unserer Gemeinden zeichnen sich nur
durch religiösen Indifferentismus oder durch stupide Nachahmungssucht
aus. Die Ursache dieses Übels wird nicht schwer zu finden sein, wenn man
bedenkt, dass 5 Kreise unserer Provinz schon seit geraumer Zeit der
Leitung eines Rabbiners entbehren, und auch selbst von manchen Seelsorgern
die Neuerungssucht begünstigt wird.
Wenden wir unseren Blick hingegen nach den Kreisen Fritzlar und Melsungen,
so sehen wir ein schon erfreulicheres Gemälde sich vor unseren Augen
aufrollen, denn diese beiden Kreise stehen unter der Führung eines
wahrhaft frommen und gottesfürchtigen Mannes, unter der des Kreisrabbinen
Wetzlar zu Gudensberg, welcher nun schon seit ca. 35 Jahren mit
seltener Berufstätigkeit und Aufopferung dahin strebt, in seinem
Wirkungskreise wahres Judentum und aufrichtige Gottesfurcht zu fördern.
So hat er schon seit vielen Jahren eine ziemlich beträchtliche Anzahl
Schüler um sich versammelt, welche er in die Gefilde der Tora einführt,
und sie mit liebenswürdiger Freundlichkeit, oft mit Hintansetzung seiner
eigenen Interessen, in ihrem Streben unterstützt.
Besonders erfreut sich Gudensberg in Folge seines frommen Eifers
eines sehr regen gottesfürchtigen Sinnes. Während z.B. in sehr vielen
anderen Gemeinden nur am Sabbat das Gotteshaus geöffnet wird, wir hier
täglich morgens und abends durch ordnungsvollen Gottesdienst Gott
verherrlicht, trotzdem die Gemeinde nur aus ca. 34 Familien besteht. Neben
diesen beiden Grundpfeilern des Judentums - Tora und Gottesdienst -
ist auch der dritte nicht ohne Pflege geblieben. So bestehen hier unter
der Leitung des Rabbiners drei Chebrot (Vereine), welche Wohltätigkeit
sich zur Aufgabe gemacht haben, und die ihrem Zwecke durchaus
entsprechen.
Als Gegenstück hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra,
im Kreise Rotenburg anführen. Hier hält man es für Bildung und
Aufklärung, wenn man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge
wurden bei der im vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die
der Frauengalerie umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft
empörend zu sehen, wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause
korrespondieren und kokettieren. Hoffen wir, dass bei dem demnächstigen
Besetzung des Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen
werde, der nicht einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." |
Delegiertenkonferenz jüdischer Gemeinden in Bebra
(1875)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1875: "Bebra, 10.
Januar (1875). Am heutigen Tage war in unserer Stadt eine große Anzahl
Delegierter verschiedener israelitischer Gemeinden des ehemaligen Kurfürstentums
Hessen versammelt, um über die Schritte zu beraten, welche zur
Beseitigung der Gesetze vom Jahre 1823 und 1833 die Gemeindeverhältnisse
betreffend, zu ergreifen sind, und um sich gleichzeitig über Ersetzung
der jetzigen bestehenden Einrichtung, insbesondere der Vorsteherämter
durch andere den heutigen Zeitverhältnissen geeignetere Einrichtungen zu
einigen und solche der Behörde in Vorschlag zu bringen. Man einigte sich
schließlich nach längerer Debatte über die Wahl einer Kommission von 10
Mitgliedern, welche die nötigen Vorschläge einer wiederholten
Versammlung zu machen und dieselbe ein Schriftstück in Form einer
Petition den verschiedenen Gemeinden an die kompetenten Behörden zur
Unterschrift vorzulegen hat." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1875: "Bebra, 10.
Januar (1875). Am heutigen Tage war in unserer Stadt eine große Anzahl
Delegierter verschiedener israelitischer Gemeinden des ehemaligen Kurfürstentums
Hessen versammelt, um über die Schritte zu beraten, welche zur
Beseitigung der Gesetze vom Jahre 1823 und 1833 die Gemeindeverhältnisse
betreffend, zu ergreifen sind, und um sich gleichzeitig über Ersetzung
der jetzigen bestehenden Einrichtung, insbesondere der Vorsteherämter
durch andere den heutigen Zeitverhältnissen geeignetere Einrichtungen zu
einigen und solche der Behörde in Vorschlag zu bringen. Man einigte sich
schließlich nach längerer Debatte über die Wahl einer Kommission von 10
Mitgliedern, welche die nötigen Vorschläge einer wiederholten
Versammlung zu machen und dieselbe ein Schriftstück in Form einer
Petition den verschiedenen Gemeinden an die kompetenten Behörden zur
Unterschrift vorzulegen hat." |
Antisemitische Vorgänge (1882): ein zweijähriges
jüdisches Kind wird durch ein achtjähriges christliches Kind getötet
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1882: "Aus
Mitteldeutschland. In dem, in der Provinz Hessen-Nassau, an dem
Knotenpunkte mehrerer Eisenbahnen gelegenen Dorfe Bebra hat in voriger
Woche ein verlotterter achtjähriger Christenknabe das zweijährige Söhnchen
eines jüdischen Einwohners an den Fluss gelockt und dasselbe dann
hineingestoßen, sodass das Kind ertrank. Wie man sich erzählt, hätte
dasselbe nach dem ersten Stoße sich wieder aufs Trockene gearbeitet
gehabt, worauf der Bösewicht es aufs neue ins Wasser zurückgestoßen und
so den Tod des armen Kindes herbeigeführt habe. Nach vollbrachter Tat
lief der Missetäter zu seiner Mutter und erzählte ihr, was er soeben
vollbracht habe. Diese riet ihm, über die Sache zu schweigen. Die Tat
wurde aber dennoch ruchbar, und Mutter und Sohn befinden sich bereits in
gefänglichem Gewahrsam. Der Knabe hat sicher Anlage, in der
‚Judenfrage’ nach dem vieldeutigen Ausdrucke ‚kühl bis ans Herz’
tätig zu sein. Da auch kindliche Ohren in dieser, von gewisser Seite
absichtlich in Fluss erhaltenen Frage so manches gehässige Wort
auffangen, so dürfte vielleicht auch dieser Fall aus das Konto der
Hetzapostel gesetzt werden können. Die betreffenden Eltern und das Kind
sind sicherlich sehr zu bedauern. Noch bedauerlicher aber wäre es in der
Gegenwart gewesen, wenn ein Umgekehrtes stattgefunden, wenn ein Judenknabe
ein Christenkind ins Wasser geworfen hätte! Wie leicht hätte man daraus
eine Tisza-Eszlár* Angelegenheit gemacht! Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1882: "Aus
Mitteldeutschland. In dem, in der Provinz Hessen-Nassau, an dem
Knotenpunkte mehrerer Eisenbahnen gelegenen Dorfe Bebra hat in voriger
Woche ein verlotterter achtjähriger Christenknabe das zweijährige Söhnchen
eines jüdischen Einwohners an den Fluss gelockt und dasselbe dann
hineingestoßen, sodass das Kind ertrank. Wie man sich erzählt, hätte
dasselbe nach dem ersten Stoße sich wieder aufs Trockene gearbeitet
gehabt, worauf der Bösewicht es aufs neue ins Wasser zurückgestoßen und
so den Tod des armen Kindes herbeigeführt habe. Nach vollbrachter Tat
lief der Missetäter zu seiner Mutter und erzählte ihr, was er soeben
vollbracht habe. Diese riet ihm, über die Sache zu schweigen. Die Tat
wurde aber dennoch ruchbar, und Mutter und Sohn befinden sich bereits in
gefänglichem Gewahrsam. Der Knabe hat sicher Anlage, in der
‚Judenfrage’ nach dem vieldeutigen Ausdrucke ‚kühl bis ans Herz’
tätig zu sein. Da auch kindliche Ohren in dieser, von gewisser Seite
absichtlich in Fluss erhaltenen Frage so manches gehässige Wort
auffangen, so dürfte vielleicht auch dieser Fall aus das Konto der
Hetzapostel gesetzt werden können. Die betreffenden Eltern und das Kind
sind sicherlich sehr zu bedauern. Noch bedauerlicher aber wäre es in der
Gegenwart gewesen, wenn ein Umgekehrtes stattgefunden, wenn ein Judenknabe
ein Christenkind ins Wasser geworfen hätte! Wie leicht hätte man daraus
eine Tisza-Eszlár* Angelegenheit gemacht!
Was überhaupt die Antisemitenbewegung betrifft, so täuscht man sich,
wenn man glaubt, dass dieselbe im Absterben begriffen sei. Sie strebt
vielmehr jetzt eine feste innere Organisation an…"
*Anmerkung: Im ungarischen Tisza-Eszlár fand 1882 noch ein
Ritualmordprozess statt. |
Die jüdische Jugend veranstaltet einen großen Winterball
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. November 1929: "Bebra. Man
schreibt uns: Die jüdische Jugend Bebras veranstaltet am Sonnabend, dem
7. Dezember, in sämtlichen Räumen des Hotels 'Hessischer Hof' einen
großen Winterball. Für den musikalischen Teil dieser Veranstaltung wurde
die Kasseler Tanzkapelle 'Astra Jazz' verpflichtet. Allerlei Darbietungen
werden den Abend umrahmen. Wir können der gesamten jüdischen Jugend den
Besuch des Abends empfehlen, da es in Bebra bisher immer sehr gemütlich
war. J.O." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. November 1929: "Bebra. Man
schreibt uns: Die jüdische Jugend Bebras veranstaltet am Sonnabend, dem
7. Dezember, in sämtlichen Räumen des Hotels 'Hessischer Hof' einen
großen Winterball. Für den musikalischen Teil dieser Veranstaltung wurde
die Kasseler Tanzkapelle 'Astra Jazz' verpflichtet. Allerlei Darbietungen
werden den Abend umrahmen. Wir können der gesamten jüdischen Jugend den
Besuch des Abends empfehlen, da es in Bebra bisher immer sehr gemütlich
war. J.O." |
Versammlung der Jüdischen Jugendgemeinschaft Kassel in
Bebra (1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 9. Mai 1930: "Jüdische Jugendgemeinschaft
Kassel. Über 30 junge Menschen waren vergangenen Sonntag in Bebra
versammelt und haben dort wieder den Anfang gemacht, zu werben und zu
arbeiten im Sinne des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands.
Die Tagung wurde von Lehrer Katz (Kassel) mit einer Aussprache
über praktische Zusammenarbeit im hiesigen Kreis eingeleitet und es wurde
beschlossen, in den einzelnen Gruppen Arbeitsgemeinschaften nach dem
Muster der Kasseler J.G.-Gruppe zu veranstalten. Der erste Abend soll
immer in den einzelnen Gruppen von einigen Kasselanern geleitet
werden. Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 9. Mai 1930: "Jüdische Jugendgemeinschaft
Kassel. Über 30 junge Menschen waren vergangenen Sonntag in Bebra
versammelt und haben dort wieder den Anfang gemacht, zu werben und zu
arbeiten im Sinne des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands.
Die Tagung wurde von Lehrer Katz (Kassel) mit einer Aussprache
über praktische Zusammenarbeit im hiesigen Kreis eingeleitet und es wurde
beschlossen, in den einzelnen Gruppen Arbeitsgemeinschaften nach dem
Muster der Kasseler J.G.-Gruppe zu veranstalten. Der erste Abend soll
immer in den einzelnen Gruppen von einigen Kasselanern geleitet
werden.
Am Nachmittag wurde eine kleine Fahrt gemacht. Katz berichtete nochmals
über Verbandsarbeit, es ergab sich eine rege Diskussion, die dahin
endete, dass alle bereit waren, jetzt recht rege für unseren Verband,
d.h. weil unser Verband alles Jüdische bejaht, für unser Judentum
zu arbeiten.
Fechenbach sprach ausführlich über München, dem Tagungsort der
diesjährigen Delegiertenversammlung und wird dort die Kasseler Gruppe
vertreten. Es wurden einige Resolutionen gefasst, die dem Verband
weitergeleitet wurden. K." |
Vortragsabend der Sinai-Loge Kassel in Bebra (1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Bebra. Am 6.
dieses Monats veranstaltete der Kultusausschuss der Sinai-Loge in Kassel
für unsere Gemeinde einen Vortragsabend. In selbstloser Weise widmen sich
Damen und Herren der Loge der Aufgabe, den jüdischen Gemeinden auf dem
Lande Anregung und Erleben zu geben für die Auseinandersetzung mit
jüdischem Denken und Fühlen. Das ist ihnen in unserer Gemeinde in vollem
Maße gelungen. Während Herr Dessauer in kurzem, einleitendem Vortrage
die Quellen, den Werdegang und die Besonderheiten des jüdischen Liedes in
das Blickfeld und das Interesse der über 100 erschienenen
Gemeindemitglieder stellte, verstand es Frau Dr. Gotthilfe, unterstützt
durch Fräulein Müllers auf Inhalt und Melodie eingehende Begleitung, in
ihrer überaus künstlerisch empfindenden Art die Zuhörer das jüdische Lied
und die jüdische Melodie in ihrer besonderen, aus jüdischem Denken und
jüdischer Not geborenen Eigenart erleben zu lassen. Um aus der Fülle nur
einiges herauszugreifen, seien Wiegenlied und Jonney genannt. Der dankbare
Beifall erzwang einige Zugaben, von denen besonders das herzige 'Heimkehr
vom Feste', vertont von Leo Blech, die Hörer entzückte." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 19. Dezember 1930: "Bebra. Am 6.
dieses Monats veranstaltete der Kultusausschuss der Sinai-Loge in Kassel
für unsere Gemeinde einen Vortragsabend. In selbstloser Weise widmen sich
Damen und Herren der Loge der Aufgabe, den jüdischen Gemeinden auf dem
Lande Anregung und Erleben zu geben für die Auseinandersetzung mit
jüdischem Denken und Fühlen. Das ist ihnen in unserer Gemeinde in vollem
Maße gelungen. Während Herr Dessauer in kurzem, einleitendem Vortrage
die Quellen, den Werdegang und die Besonderheiten des jüdischen Liedes in
das Blickfeld und das Interesse der über 100 erschienenen
Gemeindemitglieder stellte, verstand es Frau Dr. Gotthilfe, unterstützt
durch Fräulein Müllers auf Inhalt und Melodie eingehende Begleitung, in
ihrer überaus künstlerisch empfindenden Art die Zuhörer das jüdische Lied
und die jüdische Melodie in ihrer besonderen, aus jüdischem Denken und
jüdischer Not geborenen Eigenart erleben zu lassen. Um aus der Fülle nur
einiges herauszugreifen, seien Wiegenlied und Jonney genannt. Der dankbare
Beifall erzwang einige Zugaben, von denen besonders das herzige 'Heimkehr
vom Feste', vertont von Leo Blech, die Hörer entzückte." |
Chanukka-Ball der Bebraer jüdischen Jugend (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 6. November 1931: "Bebra. Am
Sonnabend, den 28. November, abends 8.30 Uhr, veranstaltet die Bebraer
jüdische Jugend ihren diesjährigen 'Chanukah-Ball' im großen Saale des
'Hessischen Hofes'. Es wurde keine Mühe gescheut, allen Besuchern einige
angenehme Stunden zu bereiten. Da es in Bebra stets sehr schön war und
jeder auf seine Kosten kam, können wir allen jugendlichen Lesern diese
Veranstaltung empfehlen. Der wirtschaftlichen Lage entsprechend, sind die
Eintrittspreise sehr niedrig bemessen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 6. November 1931: "Bebra. Am
Sonnabend, den 28. November, abends 8.30 Uhr, veranstaltet die Bebraer
jüdische Jugend ihren diesjährigen 'Chanukah-Ball' im großen Saale des
'Hessischen Hofes'. Es wurde keine Mühe gescheut, allen Besuchern einige
angenehme Stunden zu bereiten. Da es in Bebra stets sehr schön war und
jeder auf seine Kosten kam, können wir allen jugendlichen Lesern diese
Veranstaltung empfehlen. Der wirtschaftlichen Lage entsprechend, sind die
Eintrittspreise sehr niedrig bemessen." |
76. Geburtstag von Joseph Oppenheim (1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1927:
"Bebra, 23. Oktober (1927). Am Simchat Tora-Fest (= 19.
Oktober 1927) konnte Joseph Oppenheim, dahier, in voller Rüstigkeit
seinen 76. Geburtstag begehen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1927:
"Bebra, 23. Oktober (1927). Am Simchat Tora-Fest (= 19.
Oktober 1927) konnte Joseph Oppenheim, dahier, in voller Rüstigkeit
seinen 76. Geburtstag begehen." |
Zum Tod von Pinchas Seelig in Solz (1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 30. März 1928: "Solz. Hier starb der in
weiten Kreisen bekannte Pinchas Seelig. Wie beliebt und angesehen
er war, das zeigte sich, als man ihn zu Grabe trug. Wohl noch nie hat
unser Dorf einen solchen Leichenzug gesehen. Von weit her waren Freunde
und Verwandte gekommen. Vor dem Trauerhaus standen fast alle Einwohner des
Dorfes, um den Toten noch einmal zu ehren. Der Bürgermeister von Trott zu
Solz, der Pfarrer, die Lehrer, Rittergutspächter, Landwirte und Arbeiter,
alle waren sie gekommen, um dem Entschlafenen auf seinem letzten Weg das
Geleit zu geben. Die israelitische Gemeinde
Sontra wollte ihren Leichenwagen zur Verfügung stellen, doch ein
Landwirt in Solz ließ es sich nicht nehmen, den toten Freund zu Grabe zu
fahren. Der ehemalige Kultusminister von Trott zu Solz ehrte den
Verstorbenen durch Übersendung eines Blumenstraußes." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 30. März 1928: "Solz. Hier starb der in
weiten Kreisen bekannte Pinchas Seelig. Wie beliebt und angesehen
er war, das zeigte sich, als man ihn zu Grabe trug. Wohl noch nie hat
unser Dorf einen solchen Leichenzug gesehen. Von weit her waren Freunde
und Verwandte gekommen. Vor dem Trauerhaus standen fast alle Einwohner des
Dorfes, um den Toten noch einmal zu ehren. Der Bürgermeister von Trott zu
Solz, der Pfarrer, die Lehrer, Rittergutspächter, Landwirte und Arbeiter,
alle waren sie gekommen, um dem Entschlafenen auf seinem letzten Weg das
Geleit zu geben. Die israelitische Gemeinde
Sontra wollte ihren Leichenwagen zur Verfügung stellen, doch ein
Landwirt in Solz ließ es sich nicht nehmen, den toten Freund zu Grabe zu
fahren. Der ehemalige Kultusminister von Trott zu Solz ehrte den
Verstorbenen durch Übersendung eines Blumenstraußes." |
70. Geburtstag von Meier Rothfeld (1928)
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1928: "Bebra,
4. November (1928). Seinen 70. Geburtstag beging gestern Herr Meier
Rothfeld dahier." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1928: "Bebra,
4. November (1928). Seinen 70. Geburtstag beging gestern Herr Meier
Rothfeld dahier." |
Zum 75. Geburtstag von Berta Oppenheim geb. Meyerhoff
(1929)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1929: "Bebra, 20.
Februar (1929). Ihren 75. Geburtstag beging in größter Rüstigkeit und
geistiger Frische Frau Berta Oppenheim geb. Meyerhoff dahier." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1929: "Bebra, 20.
Februar (1929). Ihren 75. Geburtstag beging in größter Rüstigkeit und
geistiger Frische Frau Berta Oppenheim geb. Meyerhoff dahier." |
60-jähriges Bestehen des Hotels Fackenheim in Bebra
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. November 1929: "Bebra. Am 3.
November feierte das weitbekannte Hotel Fackenheim in Bebra sein
60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Glückwünsche und ehrende Anerkennungen
aus dem Kreise von Bekannten und Kunden zeugten von der Wertschätzung,
deren sich das angesehene Haus erfreut. Der Wirteverein des Kreises
Rotenburg a.F. ließ durch eine Abordnung seinem Ehrenmitgliede und
langjährigen Schriftführer, Herrn J. Fackenheim, seine Wünsche
mit einem Blumenangebinde übermitteln, zugleich ließ auch der Deutsche
Gastwirts-Verband e.V. ein Diplom überreichen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. November 1929: "Bebra. Am 3.
November feierte das weitbekannte Hotel Fackenheim in Bebra sein
60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Glückwünsche und ehrende Anerkennungen
aus dem Kreise von Bekannten und Kunden zeugten von der Wertschätzung,
deren sich das angesehene Haus erfreut. Der Wirteverein des Kreises
Rotenburg a.F. ließ durch eine Abordnung seinem Ehrenmitgliede und
langjährigen Schriftführer, Herrn J. Fackenheim, seine Wünsche
mit einem Blumenangebinde übermitteln, zugleich ließ auch der Deutsche
Gastwirts-Verband e.V. ein Diplom überreichen." |
Anstelle von Salomon Katz wurde Emil Apfel zum
Gemeindeältesten ernannt (1930)
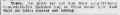 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. Februar 1930: "Bebra. An
Stelle des aus dem Amte ausgeschiedenen Gemeindeältesten Salomon Katz in
Bebra wurde Herr Emil Apfel als solcher ernannt und
bestätigt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 21. Februar 1930: "Bebra. An
Stelle des aus dem Amte ausgeschiedenen Gemeindeältesten Salomon Katz in
Bebra wurde Herr Emil Apfel als solcher ernannt und
bestätigt." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Das Hotel Fackenheim sucht eine Mitarbeiterin (1890)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1890: "Auf
sofort suche ein ordentliches israelitisches Mädchen aus anständiger
Familie zur Erlernung des Haushaltes und für die Küche. Bevorzugt werden
Solche, die bereits Vorkenntnisse besitzen, denen neben guter, familiärer
Behandlung eventuell auch eine kleine Vergütung gewährt wird. Offerten
mit Photo oder persönlicher Vorstellung. Hotel Fackenheim, Bebra,
Hessen-Nassau." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1890: "Auf
sofort suche ein ordentliches israelitisches Mädchen aus anständiger
Familie zur Erlernung des Haushaltes und für die Küche. Bevorzugt werden
Solche, die bereits Vorkenntnisse besitzen, denen neben guter, familiärer
Behandlung eventuell auch eine kleine Vergütung gewährt wird. Offerten
mit Photo oder persönlicher Vorstellung. Hotel Fackenheim, Bebra,
Hessen-Nassau." |
Anzeige des Eisen- und Eisenwarengeschäfte M. L. Apfel
(1902)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Dezember 1902: "Ein Lehrling Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Dezember 1902: "Ein Lehrling
mit guten Schulkenntnissen findet Stellung in meinem Samstags und
Feiertagen geschlossenen Eisen- und Eisenwarengeschäft.
M. L. Apfel, Bebra." |
Verlobungsanzeige für Martha Oppenheim und Manfred
Emanuel (1924)
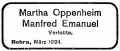 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 3. April 1924:
Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 3. April 1924:
"Martha Oppenheim - Manfred Emanuel.
Verlobte. Bebra, März 1924". |
Hochzeitsanzeige für Julius Rothfeld und Else geb.
Fackenheim (1924)
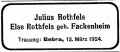 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 13. März 1924: "Julius
Rothfels - Else Rothfels geb. Fackenheim. Trauung: Bebra, 12.
März 1924".
Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 13. März 1924: "Julius
Rothfels - Else Rothfels geb. Fackenheim. Trauung: Bebra, 12.
März 1924". |
Anzeige des Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäftes
von M. Abraham (1924)
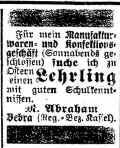 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 20. März 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 20. März 1924:
"Für mein Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft
(Sonnabends geschlossen) suche ich zu Ostern einen Lehrling
mit guten Schulkenntnissen. M. Abraham Bebra (Reg.-Bez.
Kassel)". |
Verlobungsanzeige von Julius David
und Else Oppenheim (1938)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1938:
"Wir haben uns verlobt: Else Oppenheim - Julius David. Bebra / New
York City 779 Riverside Drive - Malsch / New York City 545 West, 158
Street. September 1938." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1938:
"Wir haben uns verlobt: Else Oppenheim - Julius David. Bebra / New
York City 779 Riverside Drive - Malsch / New York City 545 West, 158
Street. September 1938." |
Hinweis auf Jakob Oppenheim (1874 in
Bebra, gest. 1947 in Cleveland/Ohio)
Jakob Oppenheim ist 1874 in Bebra geboren und kam 1905 nach
Tübingen. er war verheiratet mit
Karoline Oppenheim geb. Seemann aus Aschbach.
In Tübingen kamen die Kinder Heinz (1907) und Gertrud (1911) zur Welt. Jakob
Oppenheim war einer der erfolgreichsten und angesehenste Kaufleute in Tübingen.
Er führte seit 1906 das bisherige Damenkonfektions- und Aussteuergeschäft
"Eduard Degginger u.Co." in der Neuen Straße 16. Er war 1914 bis 1925
Synagogenvorsteher in Tübingen sowie Gemeinde- und Stiftungspfleger der
jüdischen Gemeinde. Weitere Geschichte der Familie siehe Seite
https://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine_in_Tübingen_Innenstadt. Er
starb 1947 in Cleveland/Ohio. Für Jakob Oppenheim und seine Familie wurden
in Tübingen "Stolpersteine" verlegt.
Zur Geschichte der Synagoge
Eine ältere Synagoge - vermutlich aus der Anfang des 19.
Jahrhunderts - war vorhanden (auf dem "Sandrock'schen" Grundstück in
der Nähe des Lindenplatzes). Beim Abbruch dieser alten Synagoge 1923 wurde
vermutet, dass es sich beim Synagogengebäude ursprünglich um eine Scheune
gehandelt hat, die in eine Synagoge umgebaut wurde. Jedenfalls handelte es sich
um ein zweigeschossiges Fachwerkhaus, in dem sich auch ein Schulraum für 45
Kinder und eine Lehrerwohnung befanden. 1864 erfolgte eine Renovierung der Synagoge, bei
der die traditionellen Schranken beziehungsweise Gitter der Frauenempore
entfernt wurden, was auf scharfe Kritik in der orthodox-jüdischen Zeitschrift
gestoßen ist:
Renovierung der Synagoge und scharfe Kritik von Seiten
der Zeitschrift "Der Israelit" (1865)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Als Gegenstück
hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra, im Kreise
Rotenburg, anführen. Hier hält man es für Bildung und Aufklärung, wenn
man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge wurden bei der im
vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die die Frauen-Galerie
umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft empörend zu sehen,
wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause korrespondieren und
kokettieren. .. Hoffen wir, dass bei der demnächstige Besetzung des
Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen werde, der nicht
einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Februar 1865: "Als Gegenstück
hierzu muss ich nun die fast ebenso zahlreiche Gemeinde Bebra, im Kreise
Rotenburg, anführen. Hier hält man es für Bildung und Aufklärung, wenn
man alles Jüdische verlacht und verhöhnt. Demzufolge wurden bei der im
vorigen Jahre stattgehabten Renovation der Synagoge die die Frauen-Galerie
umgebenden Schranken abgerissen, und es ist wahrhaft empörend zu sehen,
wie nun die Frauen mit den Männern im Gotteshause korrespondieren und
kokettieren. .. Hoffen wir, dass bei der demnächstige Besetzung des
Rabbinats zu Rotenburg auf einen Mann Rücksicht genommen werde, der nicht
einreißen, sondern aufbauen kann und will! A.L." |
1923/24 wurde die alte Synagoge abgebrochen und an der
Amalienstraße eine neue Synagoge erbaut. Großes Aufsehen erregte der Fund
eines Skelettes unter dem Fußboden der alten Synagoge. Die Antisemiten werteten
den Fund sofort als Spur eines Ritualmordes. Untersuchungen ergaben jedoch, dass
der Tote bereits lange Zeit, möglicherweise schon über 100 Jahre oder sogar über mehrere Jahrhunderte an dieser Stelle begraben war.
Gerichtliche Klärung des Skelettfundes im Bereich der Synagoge
(1923)
 Artikel in
der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 6. September 1923: "Das Ende eines Ritualmordschwindels. Der Skelettfund in Bebra aufgeklärt.
In Bebra wurde anlässlich des Umbaues der Synagoge bei den
Ausschachtungsarbeiten am 14. Juni 1923 ein menschliches Skelett gefunden.
Die judenfeindlichen Blätter haben sofort, wie auf geheime Verabredung,
in sensationeller Aufmachung ‚das Kindesskelett
in der Synagoge’ benutzt, um das Gespenst eines Ritualmordes in
deutschen Landen umgehen zu lassen. So hat das ‚Deutsche Wochenblatt’
vom 4. Juli an die in großen Lettern an der Spitze des Blattes gebrachte
Nachricht folgenden Kommentar geknüpft: ‚Was wird aus dieser
Untersuchung für ein Ergebnis entspringen? Es wird totgeschwiegen werden!
Solange nicht eine völkische Regierung in alle diese geheimnisvollen Vorgänge
mit starker Hand eingreift, werden wir vergebens auf Klarheit und Wahrheit
hoffen.’ Artikel in
der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 6. September 1923: "Das Ende eines Ritualmordschwindels. Der Skelettfund in Bebra aufgeklärt.
In Bebra wurde anlässlich des Umbaues der Synagoge bei den
Ausschachtungsarbeiten am 14. Juni 1923 ein menschliches Skelett gefunden.
Die judenfeindlichen Blätter haben sofort, wie auf geheime Verabredung,
in sensationeller Aufmachung ‚das Kindesskelett
in der Synagoge’ benutzt, um das Gespenst eines Ritualmordes in
deutschen Landen umgehen zu lassen. So hat das ‚Deutsche Wochenblatt’
vom 4. Juli an die in großen Lettern an der Spitze des Blattes gebrachte
Nachricht folgenden Kommentar geknüpft: ‚Was wird aus dieser
Untersuchung für ein Ergebnis entspringen? Es wird totgeschwiegen werden!
Solange nicht eine völkische Regierung in alle diese geheimnisvollen Vorgänge
mit starker Hand eingreift, werden wir vergebens auf Klarheit und Wahrheit
hoffen.’
Der ‚Völkische Beobachter’ schreibt am gleichen Tage, es sei schade,
dass man an dem Skelett eines so jungen Mädchens nicht nachweisen könne,
ob es ein jüdisches oder ein christliches gewesen sei.
Das Ergebnis der Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft liegt jetzt
vor. Die Tageszeitungen in der Umgebung Bebras bringen folgende Zuschrift
der Oberstaatsanwaltschaft in Kassel. Die Ermittlungen über das am 14.
Juni 1923 bei dem Umbau der Synagoge gefundene Skelett eines Menschen
haben folgendes ergeben. Es handelt sich um das Skelett eines etwa 30
Jahre alten Mannes, nicht um das Skelett eines etwa 5 Jahre alten Mädchens,
wie gelegentlich in der Presse verbreitet wurde. Das Skelett lag etwa 30
cm unter dem Fußboden, der aus Tonplatten bestand, über welche weiter
eine Holzdielung gelegt war. Die Knochenreste waren bereits im Zustand des
Verfalls. Die Oberfläche der Knochen war nicht mehr glatt, sondern sehr
rau und uneben, teilweise in fester Verbindung mit erdigen Bestandteilen.
Mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des feuchten Lehmbodens, in dem die
Knochenreste gefunden wurden und in dem der Verwesungsprozess um ein
Vielfaches langsamer vor sich geht als in anderen Bodenarten und im
Hinblick auf die Erfahrung über die Dauer der Verwesung von Knochenresten
ist nach dem Gutachten des vernommenen Sachverständigen mit einer an
Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der Schluss gerechtfertigt, dass
im vorliegenden Falle der Toten mindestens 100 Jahre, ja sogar noch viel länger
und zwar vielleicht mehrere Jahrhunderte in der Erde gelegen haben muss.
Mit Rücksicht auf die heute noch am Hinterkopfe des Schädels und oben
nachweisbaren Schädelverletzungen kommt offenbar ein gewaltsamer Tod in
Frage.
Durch Vernehmungen der ältesten eingesessenen Ortseinwohner in Bebra
steht fest, dass ihnen aus eigenem Wissen oder aus der Erwählung noch älterer
Ortseinwohner über das Verschwinden einer Person in oder im Umkreise von
Bebra nichts bekannt geworden ist. Das Erinnerungsvermögen dieser Leute
im Alter von 77, 83 und 87 Jahren geht bis auf die Zeit von mindestens 65
bis 75 Jahren zurück. Nach ihrer Bekundung hat sich die Synagoge immer in
demselben veralteten Zustande befunden. Ob die Synagoge früher als
Scheune gedient habe, hat sich nicht mit Bestimmtheit feststellen lassen.
Nach Auskunft des zuständigen Katasteramtes ist der älteste Nachweis für
das Vorhandensein der Synagoge auf 2. September 1892 datiert. Ein über
die bauliche Einrichtung des jetzt abgebrochenen Gebäudes vernommener
Bauunternehmer hält es mit Rücksicht auf die Balkenlage für möglich,
dass das Gebäude früher als Scheune diente.
Von welcher Person das vorgefundene Skelett stammt, hat sich nicht
feststellen lassen, ebenso auch nicht, ob ein Mord oder Totschlag vorlag
und wer als Täter in Frage kommt. Anhaltspunkt zu weiterer
Strafverfolgung sind demnach nicht gegeben und ebenso wenig ein Anlass zur
Beunruhigung der Bevölkerung.’
Wir haben diese Erklärung der Oberstaatsanwaltschaft auch dem
‚Deutschen Wochenblatt’ und dem ‚Völkischen Beobachter’ zugesandt
und sind überzeugt, dass sie den wahren Tatbestand ihren Lesern nicht
vorenthalten werden." |
In der neuen Synagoge gab 74 Männer- und 33 Frauenplätze.
Beim Bau handelte es sich um einen aus gebranntem Ziegelmauerwerk erstellten
eingeschossigen Massivbau mit Satteldach. Gottesdienste fanden bis 1938 in dem
Gebäude statt.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
- in Bebra bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. November - durch auswärtige
SS- und einheimische SA-Männer geschändet; die Inneneinrichtung völlig
zerstört.
Das Synagogengebäude blieb erhalten, wurde jedoch in den 1960er-Jahren im
Zusammenhang mit Maßnahmen der "Stadtsanierung" abgebrochen. Das
Grundstück wurde in den 1970er-Jahren neu mit einem Wohn-, Geschäfts- und
Ärztehaus überbaut. Eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Synagoge wurde angebracht.
Zusätzlich befindet sich hier eine Gedenktafel mit Namen zur Erinnerung an die
aus Bebra in der NS-Zeit umgekommenen jüdischen Personen.
Adresse/Standort der Synagoge: Amalienstraße 4.
Fotos
(Quelle: Fotos Mitte und rechts aus Arnsberg Bilder S. 19)
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Januar/Februar
2009: Ausstellung in den Bebraer Berufsschulen |
Artikel von Jan Baetz vom 28. Januar 2009
in: HNA-Online (Artikel):
Fotos gegen das Vergessen - Ausstellung zu NS-Terror in der Provinz - Bilder auch aus Bebra und Rotenburg
Bebra. Kahlgeschorene Frauen am Pranger, verwüstete Friedhöfe, Plakate mit judenfeindliche Parolen, zur Deportation aufgereihte Menschen. Die Schwarzweiß-Fotografien der Ausstellung "Vor aller Augen" sprechen eine deutliche Sprache. In den Bebraer Berufsschulen sind die beklemmenden Zeugnisse nationalsozialistischen Terrors in der Provinz bis Samstag, 14. Februar, zu sehen.
Werner Schnitzlein von der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit freut sich, dass das Kapitel der Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist..." |
| |
| Erinnerungen an die
jüdische Gemeinde im jüdischen Museum "Mikwe" in Rotenburg an
der Fulda |
 Links:
Erinnerungen an die jüdische Gemeinde in Bebra im jüdischen
Museum "Mikwe - Rotenburg an der Fulda". Links:
Erinnerungen an die jüdische Gemeinde in Bebra im jüdischen
Museum "Mikwe - Rotenburg an der Fulda".
(Foto: Hahn, Aufnahmedatum 8.4.2009) |
| |
| Mai 2010:
Stadtrundgang auf den Spuren der
jüdischen Geschichte |
Artikel von Stefan Düsterhöft in der "Hessischen Allgemeinen"
vom 27.5.2010 (Artikel): "Beim Stadtrundgang informierten sich 50 Interessierte über jüdisches Leben in Bebra.
Sie waren integriert.
Bebra. Eine Synagoge an der Amalienstraße, Geschäfte an der Nürnberger Straße oder ein Badehaus am Bach Bebra: Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die jüdische Gemeinde in Bebra fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Jüdische Familien lebten und arbeiteten nicht nur in der Stadt. Sie waren Mitglied im Radsportverein oder in der Feuerwehr, sie kickten im Fußballverein - sie waren integriert..."
Weitere Informationen über die jüdische Geschichte Bebras im Internet: www.hassia-judaica.de."
|
| |
|
November 2018:
Der Gemeinderat stimmt für die
Verlegung von "Stolpersteinen" |
Artikel von Clements Herwig in der
"Hersfelder Zeitung" vom November 2018: "Mehrheit für SPD-Antrag.
Stolpersteine nun auch für Bebra
Bebra. In Bebra sollen Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus verlegt werden. Die Mehrheit der Stadtverordneten
stimmte dem SPD-Antrag zu.
Die Sozialdemokraten hatten in der jüngsten Sitzung auf eine namentliche
Abstimmung der Parlamentarier bestanden. Es hatte bereits mehrfach Versuche
gegeben, die Erinnerungssteine an die Opfer der NS-Zeit in Bebra
einzuführen. 'Wir haben noch nie so viele unterstützende E-Mails zu einem
Antrag erhalten wie in diesem Fall', sagte SPD-Fraktionsvize Christina
Kindler. Ziel sei es, die Verlegung von Stolpersteinen auf eine breite
bürgerliche Basis zu stellen. Dafür sollen nun alle Akteure an einen Tisch
gebracht werden. Der ökumenische Arbeitskreis, die Bürgerinitiative der
Stadt Bebra und die Kirchengemeinden hätten bereits Interesse signalisiert.
Wichtig sei, dass eine Organisation die Koordination übernimmt. Jeder Bürger
kann für 120 Euro eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines
Stolpersteins übernehmen. Kosten für die Stadt entstünden daher nicht, so
Kindler. Gegen Stolpersteine hatte sich vor allem die CDU ausgesprochen: Die
Stadt Bebra habe mit der 2013 auf dem Rathausplatz angebrachten Gedenktafel
bereits einen würdigen Ort des Erinnerns, der für jedermann zugänglich sei,
so Martin Windolf (CDU). Das habe sich gerade bei der Gedenkveranstaltung zu
den Novemberpogromen gezeigt. 'Über Pflastersteine sind wohl schon genug
Stiefel marschiert', schloss Windolf. Es sei wichtig, neben der Gedenktafel
weitere, dezentrale Denkmäler zu haben, sagte Kindler: 'Sie tragen die
Erinnerung in den Alltag der Menschen.' In Nachbarstädten wie Rotenburg gebe
es schon lange Stolpersteine. Wichtig sei auch, die lebenden Nachfahren der
Opfer zu kontaktieren, Einverständnis einzuholen und zur Verlegung
einzuladen. Eine Anfrage der Nachfahren einer jüdischen Familie liege
bereits vor. Geschlossen mit Ja (17) stimmten die Fraktionen von SPD und
Gemeinsam. Gegenstimmen (12) kamen von CDU und FDP, Enthaltungen (3) von
CDU, FWG und BFB."
Link zum Artikel |
| |
|
Februar 2019:
Initiative zur Verlegung von
"Stolpersteinen" in Bebra |
Artikel von Clemens Herwig in der
"Hersfelder Zeitung" vom 17. Februar 2019: "Stolpersteine sollen an Opfer
der NS-Zeit erinnern. Porträt: Eine Familie, zwei Leben - Die Süsskinds
flüchteten 1936 aus Bebra
Bebra. Die Familie Süsskind aus Bebra ist auf unterschiedliche Weise
Opfer der NS-Zeit geworden. Stolpersteine sollen daran erinnern. Ein
Info-Treffen findet am 26. Februar statt. Als die Nachricht kommt, dass nach
langem Anlauf auch in Bebra Stolpersteine verlegt werden, ist für Gidon
Süsskind und seine Familie ein Wunder geschehen. 'Wir dachten, das klappt
nie', sagt der Enkel von Betty und Samuel Levi und Urenkel von Sophie Frank
– Juden aus Bebra, die das Terrorregime der Nationalsozialisten nicht
überlebt haben. Sie werden zu den Ersten gehören, an deren Leben und Tod mit
einem Stolperstein vor ihrem letzten Wohnort in Bebra erinnert wird. Wer
verstehen will, warum eine Entscheidung des Bebraer Stadtparlaments so
wichtig für ihre Nachkommen ist, eine Großfamilie, die in der Stadt Herzlia
etwa 15 Kilometer nördlich von Tel Aviv lebt, muss verstehen, was selbst die
gelungene Flucht aus Nazi-Deutschland bei dieser Familie und ihrer
Geschichte angerichtet hat.
Darüber spricht man nicht. 'Mein Mann und ich sind seit 44 Jahren
verheiratet. Als ich ihn kennenlernte, sagte er nur: Ich habe keine
Großeltern.' Nava Süsskind ist eine zierliche Frau mit grauem kurzen Haar
und einer ruhigen Stimme, aber gerade beugt sie sich so weit vor, dass sie
den gesamten Handybildschirm ausfüllt, der das Videotelefonat aus Israel
überträgt. Was sie mit eindringlichen Worten zusammenfasst, ist vielen
deutschen Familien bekannt: Man spricht nicht darüber, was passiert ist –
vor allem nicht darüber, was in den Jahren 1933 bis 1945 passiert ist.
Traudel Levi und Karl Siegfried Süsskind fliehen 1936 über Italien gemeinsam
nach Israel – damals noch ein Teil Palästinas. Beide sind jung, Mitte
zwanzig, sie bauen sich ein zweites Leben auf, heiraten, bekommen Kinder:
Gidon, seine Schwester, seinen Bruder. Und sie bauen eine Mauer auf. Zu
ihrem alten Leben in einem Deutschland, in dem sie nicht länger erwünscht
sind. Zu Bebra. Gidons Großeltern und Sophie Frank bleiben dort zurück – sie
wollen ihre Heimat nicht verlassen, glauben daran, dass alles wieder besser
wird. Als sie ihren Fehler erkennen, ist es zu spät. 'So sehr es meine
Eltern auch versuchten, sie bekamen keine Einreisegenehmigung für sie', sagt
ihr Enkel. Die Großeltern sterben in Deutschland: Samuel Levi an einer
Lungenkrankheit, seine Frau Betty 1942 nach der Deportation im
Konzentrationslager Lublin-Majdanek in Polen. Gidons Urgroßmutter Sophie
Frank nimmt sich kurz nach den Novemberpogromen 1938 das Leben. 'So lange
meine Eltern lebten, war das ein schwieriges Thema', sagt der 68-jährige
Gidon Süsskind. 'Wenn meine Großeltern zur Sprache kamen, hatte meine Mutter
Tränen in den Augen.' Er wächst mit der deutschen Sprache und Kultur auf,
'sie sind Teil meines Lebens', wie er sagt – doch die Familie in Deutschland
wird zum Tabu. 'Es war schwierig für sie, zu diesen Wunden zurückzukehren',
sagt Nava über die Eltern ihres Mannes, 'zurück zu ihren blutenden Herzen.'
Die letzten Briefe verbrannt. Vor seinem Tod im Alter von 93 Jahren –
fast 60 Jahre davon arbeitet er als Kinderarzt – verbrennt Gidons Vater die
letzten Briefe aus der einstigen Heimat und nimmt das Gefühl, seinen Eltern
nicht geholfen zu haben, mit ins Grab, wie seine Schwiegertochter vermutet.
Der Wendepunkt kommt im Jahr 2015, Gidon Süsskind ist mittlerweile selbst
fünffacher Großvater – er nennt es einen Sieg über den Holocaust: 'Wir sind
immer noch hier.' Die Familie in Israel bekommt Post aus
Heuchelheim, Germany. Die Gemeinde im
Kreis Gießen will Stolpersteine verlegen, auch Gidons Großeltern
väterlicherseits gehören zu den Opfern, an die erinnert werden soll. 'Die
Vergangenheit hat uns eingeholt, auf sehr starke und emotionale Weise', sagt
der 68-Jährige. Die Mauer in der Familiengeschichte, die seit der Flucht aus
Deutschland bestanden hat – sie bröckelt. 'Dahinter gab es Menschen, ihre
Leben, ein Haus, Fotos', erinnert sich Nava Süsskind, 'als diese Mauer
einmal niedergerissen war, konnten wir das nicht mehr ignorieren. Es ist
unsere Pflicht, ihnen zu Gedenken.' Ein Jahr später reisen die Süsskinds mit
ihren Kindern nach Deutschland, zur Verlegung in
Heuchelheim. 300 Menschen nehmen an
der Zeremonie teil. Für die Süsskinds ist es ein Abschluss – die Großeltern
aus Heuchelheim starben im
Vernichtungslager Sobibor, Gräber gibt es nicht – aber auch ein Anfang. In
Heuchelheim entstehen Freundschaften, die bis heute halten. 'Wir sind einer
Generation begegnet, die sehr viel mit uns zusammen bedauert', sagt Nava.
2016 ist auch das Jahr, in dem die Süsskinds nach Bebra kommen, um dem
Familienzweig von Traudel Levi nachzuspüren. Sie besuchen das Haus der
Großeltern in der Apothekenstraße (das mittlerweile einem Neubau des
VR-Bankvereins gewichen ist). 'Um zu sehen, 'wo sie gelebt haben, von wo sie
geholt wurden', sagt Gidon. Es gibt ein Bild, eine Delegation der Stadt mit
der Familie auf den Treppenstufen vor dem Eingang. Das Thema Stolpersteine
kommt auf. 'Wir waren enttäuscht über das klare Nein', sagt der Israeli.
'Uns wurde erklärt, dass das in Bebra anders läuft, mit einer Gedenktafel.'
Dafür hat Gidon Verständnis, auch für Kritik an den Stolpersteinen. 'Ich
sehe es nur nicht so', sagt er im gut 4000 Kilometer entfernten Israel und
zuckt mit den Achseln.
Kuckucksuhr aus Bebra mitgebracht. Im Hintergrund schlägt eine
Kuckucksuhr zur vollen Stunde. Seine Mutter hat sie damals aus Bebra
mitgebracht, ein mehr als 100 Jahre altes Kunstwerk aus Holz. Handbemalt.
'Niemand sollte von seiner eigenen Geschichte abgeschnitten sein', sagt
Gidon Süsskind. Das wünscht er sich, besonders für seine Kinder. Wenn die
ersten Stolpersteine in Bebra verlegt werden – wenn die Namen von Betty und
Traudel Levi und von Sophie Frank vor dem Haus in der Apothekenstraße einen
Platz im Asphalt finden – werden die Süsskinds da sein. Er reicht das Handy
weiter, Nava möchte etwas sagen. Es ist ihr wichtig, es ist der Moment, in
dem sie den Bildschirm ausfüllt. 'Wir kommen nicht, um anzuklagen', sagt
sie. 'Wir wollen die Chance nutzen, wieder ein wir zu werden.' Sekundenlang
blickt sie in die Kamera, ohne ein Wort zu sagen. Kämpft mit den Tränen. Bis
sich ihr Mann verabschiedet und auflegt.
Bebra und die Stolpersteine. Erst mit einer Abstimmung im
Stadtparlament Ende des vergangenen Jahres wurden die Pläne konkret, auch in
Bebra Stolpersteine verlegen zu lassen. Der Kontakt zu Künstler Gunter
Demnig ist hergestellt, ab dem 10. Juli soll es 17 Stolpersteine an sieben
Orten in der Eisenbahnerstadt geben. Ein Blick auf die Vorgeschichte, die
Nachbarstädte und den aktuellen Stand des Stolperstein-Projekts:
Die Abstimmung. 'Wir haben noch nie so viele unterstützende E-Mails
zu einem Antrag erhalten wie in diesem Fall', sagte SPD-Fraktionsvize
Christina Kindler bei ihrer Rede im Bebraer Parlament. Der Antrag hatte
Erfolg, die Mehrheit sprach sich im November für die Verlegung von
Stolpersteinen aus. Gegenstimmen gab es vor allem von der CDU: Die Stadt
Bebra habe mit der 2013 auf dem Rathausplatz angebrachten Gedenktafel
bereits einen würdigen Ort des Erinnerns, der für jedermann zugänglich sei.
Die Abstimmung im Parlament: Mit Ja (17) stimmten die Fraktionen von SPD und
Gemeinsam. Gegenstimmen (12) kamen von CDU und FDP, Enthaltungen (3) von
CDU, FWG und BFB.
Die Nachbarn. In den Nachbarstädten
Rotenburg (55 Messingtafeln) und
Bad Hersfeld (74) gibt es seit 2010
Stolpersteine – ohne Abstimmung in den Parlamenten, die Entscheidungen
fielen jeweils im Magistrat.
Der Blick ins Archiv. Als in Rotenburg im Mai 2010 die ersten
Gedenk-Messingplatten verlegt wurden, gab es im Kreis nur an wenigen Orten
Stolpersteine. Ein jüdischer Gast der Feier kommentierte: 'Ich befürchte,
dass selbst heute Gemeinden wie Bebra noch nicht bereit dafür sind.' Ein
Leserbrief greift die Aussage eine Woche später auf: 'Als Zugezogener habe
ich schon häufiger solche Einschätzungen über die Vergangenheitsbewältigung
in Bebra gehört', schrieb Gerhard Schneider-Rose. Und weiter: 'Ich gehe
davon aus, dass die Einschätzung nicht stimmt.' Dr. Heinrich Nuhn, Kurator
des Jüdischen Museums in Rotenburg, erinnert sich: 'Das hat damals für eine
Diskussion in Bebra gesorgt.' Die Eisenbahnerstadt sei einmal Vorreiter bei
der Erinnerungsarbeit gewesen: So habe etwa Bürgermeister August-Wilhelm
Mende in den 70er-Jahren Verbindung zu geflohenen jüdischen Bebranern in
Israel aufgenommen.
Der aktuelle Stand. Die Fäden für die Verlegung der Stolperstein hält
die Bürgerinitiative Zukunft für Bebra in der Hand, unterstützt von der
Stadtverwaltung. Die Brüder-Grimm-Gesamtschule und die Beruflichen Schulen
hätten bereits Hilfe zugesagt, die Bereitschaft zur Übernahme einer
Patenschaft für einen Stolperstein sei groß. Weitere Paten werden dennoch
gesucht. Am 26. Februar soll es eine Informationsveranstaltung im
evangelischen Gemeindehaus, Grüner Weg 2, in Bebra geben. Geplant ist zudem
ein kurzer Vortrag von Dr. Heinrich Nuhn.
Kontakt: Bürgerinitiative Bebra, Vorsitzender Gerhard Schneider-Rose,
Telefon 0 66 22/32 11."
Link zum Artikel |
| |
|
August 2019:
Besuch von Nachkommen der Familie
Süßkind in
Heuchelheim anlässlich der Verlegung von
"Stolpersteinen" in Bebra |
Artikel von Rüdiger Soßdorf im "Gießener
Anzeiger" vom 12. August 2019: "Stolpersteine sind keine Schlusssteine
Heuchelheim (so). Nicht
rückwärtsgewandt, sondern mit Blick nach vorn wolle man einander begegnen.
Das versprachen sich Mitglieder der Familie Süßkind und Heuchelheimer Bürger
bei ihren ersten Begegnungen vor drei Jahren. Ganz so, wie es Dr. Karl
Süßkind und sein Freund, der frühere Heuchelheimer Bürgermeister Otto Bepler,
für die Nachfahren gewünscht hatten. Die Zusage trägt: Im Juli weilten Gidon
und Nava Süßkind aus Herzlia/Israel einmal mehr am unteren Bieberbach. Mit
ihnen waren rund 20 weitere Angehörige der Familie nach Deutschland
gekommen. Kinder und Enkel sind dabei, die Urenkel von Karl Süßkind, der mit
seiner Frau Traudel vor bald 80 Jahren auf der Flucht vor den Nazis seine
Heuchelheimer Heimat gen Israel verließ. Gerade die Begegnungen dieser
Nachgeborenen mit Gleichaltrigen macht Mut, lässt optimistisch nach vorn
blicken.
Weiterer Anlass der neuerlichen Deutschland-Visite: Das Verlegen von
Stolpersteinen durch den Künstler Gunter Demnig in Bebra, der
Heimatstadt von Karl Süßkinds Frau. Da wurde noch einmal thematisiert, was
man einander bereits in Heuchelheim versprach, als im Juni 2016
Stolpersteine für Süßkinds verlegt wurden: "Stolpersteine sind keine
Schlusssteine." Ganz im Gegenteil sollen sie Denk-Prozesse anstoßen. Zudem
wird ein weiterer Ansatz verfolgt, um Diskussionen anzuregen: Im
Heuchelheimer Heimatmuseum im einstigen Kinzenbacher Bahnhof sollen Spuren
einstigen jüdischen Lebens in Heuchelheim dokumentiert werden. Das haben
Gidon Süßkind und Gerhard Kreiling, der Vorsitzende des Arbeitskreises
Heimatmuseum im Kulturring, verabredet. Gesucht werden nicht nur Dokumente
und Fotos, sondern darüber hinaus weitere Gegenstände, die an die
Heuchelheimer jüdischen Glaubens erinnern. Jüdisches Leben gehört für mehr
als 200 Jahre zur Heuchelheimer Geschichte, sagt Gerhard Kreiling. Wie
hilfreich diese Arbeit sein kann, um Diskussionen anzustoßen und eine Kultur
der Auseinandersetzung zu bereichern, die sich aus der Vergangenheit speist,
aber bis heute ungebrochen aktuell ist, das hat sich anderorts durchaus
gezeigt: So ist Kreiling im Austausch mit Dr. Heinrich Nuhn aus
Rotenburg/Fulda. Nuhn hat dort eine solche Arbeit bereits geleistet. Wer zur
geplanten Sammlung in Heuchelheim etwas beisteuern kann, ist gebeten, sich
an Gerhard Kreiling zu wenden:
heimatmuseum@gakreiling.de."
Link zum Artikel |
| |
|
Oktober 2021:
Verlegung von weiteren
"Stolpersteinen" in Bebra |
Artikel von Carolin Eberth und
Clemens Herwig in der "Hessischen Allgemeinen" hna.de (Lokalausgabe) vom 7.
Oktober 2021: "Angehörige aus Israel waren Gäste der Aktion
Weitere Stolpersteine in Bebra erinnern an jüdische Opfer des NS-Regimes
Den jüdischen Opfern einen Namen geben und an Menschen erinnern, die in der
NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert worden sind – das ist der Sinn der
zweiten Stolpersteinverlegung in Bebra.
Bebra - Geprägt von gefühlvollen Momenten, Tränen, bewegenden Worten
und Gesten fand die Zeremonie der Stolpersteinverlegung am Mittwochmorgen in
der Bebraer Innenstadt statt. Musikalisch begleitet wurde sie von Elisabeth
Fläming. Familie Süsskind – Nachkommen von Juden aus Bebra, die die Zeit des
Nationalsozialismus nicht überlebt haben – war extra zu viert aus Tel Aviv
angereist. 'Es ist ein hochemotionaler und wichtiger Moment für uns, hier zu
stehen, wo bis vor kurzem noch das Haus unserer Mutter Traudel und unseren
Großeltern Betty und Samuel Levi stand', sagte Gidon Süsskind an der
Apothekenstraße 10. Süsskinds Vorfahren lebten in Bebra und führten ein
Geschäft, bis sich der Antisemitismus in ganz Deutschland ausbreitete. Die
Eltern flohen nach Israel, das dunkle Kapitel Deutschland verschwand hinter
einer Mauer in der Familiengeschichte – die auch dank der
Stolpersteinverlegungen in Heuchelheim bei Gießen und in Bebra vor zwei
Jahren zu bröckeln begann (wir berichteten). Insgesamt wurden in Bebra
weitere 20 der von Künstler Gunter Demning gestalteten Stolpersteine
verlegt, die 'Passanten zum Anhalten und Gedenken einladen und so die Opfer
vor dem Vergessen bewahren sollen', wie es Bürgermeister Stefan Knoche bei
der Zeremonie beschrieb.
Begleitet wurde die Verlegung von der Klasse 10c der
Brüder-Grimm-Gesamtschule. Die Schüler hatten sich unter der Leitung von
Lehrerin Ann-Christin Allendorf und mithilfe des Heimathistorikers Dr.
Heinrich Nuhn etwa drei Wochen lang intensiv im Geschichtsunterricht mit den
Verbrechen der Nationalsozialisten an jüdischen Bürgern aus Bebra
beschäftigt. Die Klasse hatte für die Feierlichkeit Texte und Rollenspiele
vorbereitet. Wirklich bewusst dürfte den Schülern das von ihnen
recherchierte Leid im Gespräch mit den Süsskinds geworden sein. Die Israelis
besuchten die Klasse am Vortag der Stolpersteinverlegung,
Schulsozialpädagogin Christina Kindler hatte den Kontakt hergestellt. 'Es
ist etwas ganz anderes, wenn der Zeitzeugenbericht ein Gesicht bekommt –
oder in diesem Fall drei', sagte die stellvertretende Schulleiterin Maike
Gille bei der Begrüßung der Brüder Dan und Gidon Süsskind sowie Gidons
Ehefrau Nava.
Die Gäste antworteten offen auf die Fragen der Jugendlichen und schilderten
ihre Familiengeschichte – mal auf Englisch, mal auf Deutsch, oft
eindringlich und ohne die Schüler zu schonen. 'Kommen Sie gerne zur
Stolpersteinverlegung nach Bebra?', lautete eine dieser Fragen. 'Das ist
vielleicht nicht das richtige Wort, wir kommen mit gemischten Gefühlen',
sagte Dan Süsskind. 'Wir spüren Verwandten nach, denen das Leben genommen
wurde. Wir wollen fühlen, wie sie gelebt haben.' Und die Frau seines Bruders
ergänzte: 'Es ist wie eine Beerdigung für uns. Wir haben sonst keinen Ort
zum Trauern.' Ohne die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wären die
Süsskinds wie vor zwei Jahren mit der 21-köpfigen Familie samt Kindern und
Enkeln angereist.
Mit Sorge betrachten die Israelis die politische Entwicklung in Deutschland.
'Populismus ist etwas furchtbares', so Gidon Süsskind über die AfD, die
erneut im Bundestag vertreten sein wird. Die Geschichte dürfe sich nicht
wiederholen. 'Und es gibt Variationen, die ebenso gefährlich sind', warnen
die Nachfahren von Juden, die das NS-Regime nicht überlebt haben.
Neben der Familie Levi erinnern in Bebra nun auch Stolpersteine an die
Familien Emanuel (Hersfelder Straße 7), Abraham/Fackenheim, Katz, Röschen
Oppenheim, Fulda/Oppenheim (alle in der Nürnberger Straße) sowie die Familie
Ruth Neuhaus (Amalienstraße 3). Oder, wie es Bürgermeister Knoche in
Anlehnung an ein jüdisches Sprichwort sagte: 'Wirklich tot sind nur jene, an
die sich niemand erinnert.'"
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 56-57. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 19. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 38. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 42 (keine neuen
Informationen zum Stand 1988) |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995
S. 57-58. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 392-393. |
 | Quelle für 1585 wird angegeben in A. Baumann: Die
Neckarsulmer Juden S. 48 Anm. 163. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Bebra
Hesse-Nassau. Numbering 111 (8 % of the total) in 1861, the Jewish community had
members in neigboring Iba (27) and Weiterode
(19). After Worldwar I, it was affiliated with the rabbinate of Kassel. The
synagogue, reconstructed in 1924, was attacked by a mob on Kristallnacht
(9-10 Novembver 1938), its interior being destroyed. A jewish woman was raped in
the pogrom. Of the 166 Jews registered after 1933, 29 emigrated and 109 moved
elsewhere (some emigrating) by the end of 1939. At least 22 are known to have
perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|