|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"
Mühlhausen (Thüringen,
Unstrut-Hainich-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Mühlhausen gab es bereits im Mittelalter eine jüdische Gemeinde. In
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ließen sich Juden vermutlich
erstmals nieder. Das Mühlhäuser Rechtsbuch dokumentiert um 1220 Juden in der
ehemaligen Reichsstadt. Namentlich werden 1266 bis 1273 Simon von Mühlhausen
und seine Frau Vromud in Köln genannt, um 1280 hört man von einem Schemarja
aus Mühlhausen. Sie könnten freilich auch aus dem elsässischen Mühlhausen
stammen. Mit Sicherheit werden Mühlhausener Juden erstmals 1278 genannt.
1286 nennt R. Meir von Rothenburg einen Schreiber Leontin aus Mühlhausen. Im
14. Jahrhundert war das Judenregal zwischen dem Landgrafen von Thüringen und
der Stadt immer wieder ein Streitobjekt. Mehrfach wechselte die das Judenregal
zwischen beiden hin und her. Die Mühlhäuser Juden lebten vor allem vom
Geldverleih.
Bei der Verfolgung in der Pestzeit wurden die Mehrheit der Juden der Stadt am 21.
März 1349 erschlagen. Unter den Ermordeten war der Rabbiner Elieser.
Um die Habe der Juden wurde in der Folgezeit zwischen den Herrschaften
gestritten. Einige der Mühlhäuser Juden vor der Verfolgung fliehen: 1363 wird
eine Anzahl Mühlhäuser Juden in Erfurt genannt. In Mühlhausen selbst lassen
sich 1374 wieder Juden nachweisen. In der Folgezeit lebten jüdische
Familien vor allem in der "Jüdenstraße", wo sich eine Synagoge
befand (um 1380 erwähnt). 1417 wird erstmals ein Friedhof erwähnt, der
vor der Burgpforte an dem auch Judenberg genannten Burgwall lag. Die Zahl der
Juden oder jüdischen Familien betrug 1375 acht, 1406 sechs, 1418 18, 1452 zehn.
Auch in dieser Zeit lebten die Juden der Stadt vor allem von Geld- und
Pfandgeschäften, aber auch vom Pferdehandel und sonstigem Handel. Die jüdische
Gemeinde hatte einen Vorsteher (Parnass), dazu wird ein Rabbiner namens
Simon genannt (1431) ein Sänger und ein "Schulklopfer". Nach einem
erneuten Pogrom im Herbst 1452 verließ die Mehrzahl der Juden die Stadt.
Anfang des 16. Jahrhunderts kam das Ende der mittelalterlichen Gemeinde.
Letztmals erfährt man von Juden in der Stadt aus dem Jahr 1517. Das
Synagogengebäude war bereits 1513 in christlichem Besitz. 1537 wurden noch
Juden aufgenommen, doch 1561 für die Juden "für alle Zeiten" aus der
Stadt verbannt. Im 17. Jahrhundert erfährt man von Juden, die aus Mühlhausen
stammten, in Krakau, Posen und Lissa.
Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges (1643) werden wieder Juden in Mühlhausen
genannt, doch kam es erst seit dem 18. Jahrhundert wieder zu einer
kontinuierlichen Ansiedlung. 1781 werden 14 jüdische Familien in der Stadt
genannt, 1793 waren es 78 Personen. 1806 wurde eine Jüdische Gemeinde
gegründet.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1808 elf jüdische Familien, 1827 103 jüdische Einwohner, um 1840 20
bis 22 Familien, 1854 191 jüdische Einwohner, 1881 196.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule (Religionsschule), ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Prediger/Lehrer angestellt,
der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe die Ausschreibungen der
Stelle unten). Erster Prediger und Lehrer zur Zeit der Einweihung der Synagoge
war Dr. Gerson Cohn; 1846 wird neben ihm als Vorsänger/Kantor ein Herr Freystadt
genannt. 1859 wurde - nach dem Tod von Dr. Cohn - die Stelle des Religionslehrers und Vorbeters
neu ausgeschrieben,
parallel die eines Schochet und Hilfsvorbeters (siehe Ausschreibung 1859
unten).
Seit 1861 war Michael Fackenheim als Prediger und Lehrer in der Stadt
tätig (geb. 1828 in Lispenhausen,
zuvor Lehrer u.a. in Halsdorf und Dillich;
Vater des Eisenacher Sanitätsrates Dr. Julius Fackenheim [umgekommen im Ghetto
Theresienstadt], Großvater von Alfred Fackenheim [ermordet im KZ Auschwitz],
Urgroßvater der 1923 in Eisenach geborenen Avital (Erika) geb. Fackenheim, die
später mit Schalom Ben Chorin verheiratet war (Lebensgeschichte
von Avital Ben-Chorin). Michael Fackenheim starb 1896.
Die jüdischen Einwohner waren angesehene Bürger der Stadt, darunter waren
einige, die in den Gremien der Stadt u.a. als Stadtverordnete, Stadträte und
als Stadtverordnetenvorsteher (Louis Oppé 1900-1906) maßgeblichen Anteil an
der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Stadt hatten.
Von den jüdischen Einwohnern waren über Mühlhausen hinaus bekannt: Bruno Schönlank
(1859-1901), der SPD-Reichstagsabgeordneter und Chefredakteur der
"Leipziger Volkszeitung" sowie Paul Mankiewitz (1857-1924), der
Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank und Teilnehmer an den Versailler
Verhandlungen war. .
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Leopold Bachrach
(geb. 15.11.1899, gef. 21.3.1918), Richard Beyth (geb. 9.3.1885, gef.
19.12.1914), Herbert Frank (geb. 3.10.1898 in Arnstadt, gef. 29.3.1918),
Unteroffizier Siegfried Loebenstein (geb. 7.6.1891 in Mühlhausen, gef.
7.1.1916), Gotthilf Stern (geb. 29.12.1893 in Mühlhausen, gef. 27.11.1915),
Oskar Stern (geb. 15.1.1885 in Mühlhausen, gef. 2.5.1918).
Um 1924, als zur Gemeinde etwa 170 Personen gehörten (0,5 % von
insgesamt etwa 35.000 Einwohner), waren die Gemeindevorsteher Richard
Wallach, Georg Koppel, Jos. Elias, Dr. Bergmann, E. Goldschmidt. Der Repräsentanz
gehörten an: Max Elias, J. Lebenberg, A. Hanne, L. Maas, A. Mayer, J. Rießmann,
N. Weinberg, G. Cohnhoff, Siegfried Heilbrunn. Als Prediger, Schochet und Lehrer
war Max Rosenau angestellt. Er erteilte auch den Religionsunterricht an
den höheren Schulen der Stadt. An jüdischen Vereinen gab es u.a. den Humanitätsverein
(gegründet 1875, 1924 unter Leitung von Richard Wallach mit 47 Mitgliedern,
1932 unter Vorsitz von Dr. Bergmann mit etwa 50 Mitgliedern; Zweck und
Arbeitsgebiete: Ausbildungsbeihilfen, Unterstützung Hilfsbedürftiger), den Israelitischen
Frauenverein (gegründet 1839, vgl. unten Bericht zur Grundsteinlegung
der Synagoge 1840, 1924/32 unter Leitung von Laura Oppé mit 25 bzw. etwa 27
Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet: Unterstützung hilfsbedürftiger Frauen),
den Wohltätigkeitsverein Chebrah Gemillus Chessed (gegründet etwa 1900;
1924 unter Leitung von Max Elias mit 43 Mitgliedern, 1932 unter Vorsitz von Is.
Lebenberg mit etwa 30 Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet: Unterstätzung
Hilfsbedürftiger, Veranstaltung des Gottesdienstes bei Jahrzeiten und während
der Trauertage).
1932 bildeten den Gemeindevorstand Georg Koppel (1. Vors.),
Siegfried Heilbrunn (2. Vors.) und Dr. Fritz Cohn (3. Vors.). Vorsitzender der Repräsentanz
war Max Elias. Lehrer und Schochet war weiterhin Max Rosenau. Im Schuljahr
1931/32 erhielten 31 Kinder aus der Gemeinde Religionsunterricht.
1933 wurden 204 jüdischen Einwohner gezählt. Von ihnen ist in der
Folgezeit ein Großteil auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der
zunehmenden Entrechtung und der Repressalien ausgewandert oder in andere Städte
verzogen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der
Synagoge zerstört (s.u.), 31 jüdische Männer wurden verhaftet und - von einer
johlenden Menge begleitet, in die Turnhalle des damaligen 'Fritz-Sauckel-Hauses'
gebracht. Am 11. November 1938 wurden sie auf Lastwagen in das KZ Buchenwald
verschleppt, wo zwei von ihnen umgekommen sind, zwei weitere starben im Dezember
1938 an den Folgen der Haft. Am 14. April 1942 begannen die Deportationen in die
Konzentrations- und Vernichtungslager des Ostens. 1943 ab es keine jüdischen
Einwohner mehr in der Stadt.
Von den in Mühlhausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ilse Abraham (1903), Ilse
Abraham (1926), Siegbert Abraham (1925), Rudi Alexander Adler (1899), Josef Apt
(1871), Malli Bachrach (1898), Karl Baumann (1884), Anna Bergmann geb. Blank
(1875), Franz Bergmann (1873), Mathilde Martha Bing geb. Wallach (1890),
Adelheid Bruck geb. Oppi (1883), Albert Cohn (1874), Fritz Siegfried Cohn
(1881), Hermann Cohn (1922), Marie (Mirjam) Cohn (1871), Wilhelm Cohnheim
(1907), Alfred Compart (1897), Rosa Doege geb. Meyer (1881), Johanna Fackenheim
geb. Bacharach (1869), Julius Fackenheim (1863), Kurt Michael Fackenheim (1900),
Lina Freudenthal geb. Hellmann (1861), Hedwig Fürst geb. Oppe (1875), Sidonie
(Toni) Gassenheimer geb. Fuld (1886), Lina Goldmann geb. Harwitz (1890),
Henriette Goldschmidt (), Emma Gossels geb. Heilbrunn (1875), Louis Kahn
(1876), Rudolf Kahn (1912), Benno (Bruno) Koppenhagen (1867), Isaak Lebenberg
(1865), Jeanette Lebenberg geb. Stein (1864), Rita Levy (1921), Sara
Lichtenstein geb. Daniel (1871), Willy Lichtenstein (1867), Jenny Liebert
(1874), Leo Liebert (1881), Luise Liebert (1879), Ruth Lilienfeld (1910),
Elfriede Löbenstein (1925), Frieda Löbenstein (1885), Leopold Löbenstein
(1884), Edith Mayer (1927), Rita Mayer (1928), Meta Meijer geb. Oppenheim
(1884), Anne Rahel Müller geb. Werner (1887), Johanna Neumann geb. Metzger
(1895), Siegmar Nussbaum (1886), Kurt Pinkus (1895), Manfred Pinkus (1926),
Julie Preuß geb. Rosenkranz (1876), Hedwig Rosenberg (1886), Sophie Rosenthal
geb. Beyth (1878), Johanna Herta Scheps geb. Stienhardt (1888), Paul Schwartz
(1873), Henriette Fanny Simon geb. Braun (1860), Therese Stein geb. Wolfermann
(1870), Therese Steinhardt geb. Posener (1857), Emma Stern geb. Wolf (1890),
Erna Stern (1923), Grete Stern geb. Neumann (), Moritz Stern (1892), Ludwig
Strauss (1898), Max Wallach (1888), Adolf Weil (1869), Elsbeth Weinberg (1917),
Walter Zucker (1898).
 An
mehrere der genannten Personen erinnern seit Mai 2010 sog.
"Stolpersteine" in der Stadt das Foto zeigt den
"Stolperstein" für Sophie Rosenthal geb. Beyth vor dem Gebäude
Linsenstraße 26 (geb. 1878, deportiert 1942 Region Lublin, ermordet; vgl.
Presseartikel unten; Foto: Hahn, Aufnahmedatum 27.4.2011). Eine weitere
Verlegeaktion war im Juni 2011 (neun "Stolpersteine",
siehe Pressebericht unten). An
mehrere der genannten Personen erinnern seit Mai 2010 sog.
"Stolpersteine" in der Stadt das Foto zeigt den
"Stolperstein" für Sophie Rosenthal geb. Beyth vor dem Gebäude
Linsenstraße 26 (geb. 1878, deportiert 1942 Region Lublin, ermordet; vgl.
Presseartikel unten; Foto: Hahn, Aufnahmedatum 27.4.2011). Eine weitere
Verlegeaktion war im Juni 2011 (neun "Stolpersteine",
siehe Pressebericht unten).
Bei der Verlegeaktion am 11. Mai 2013 wurden
"Stolpersteine" verlegt für Frieda, Leopold und Elfriede
Löbenstein (Herrenstraße 5), für Kurt und Manfred Pinkus (Steinweg 45),
für Johanna und Kurt Michael Fackenheim (Erfurter Str. 3), für Withold,
Hedwig, Fritz und Eva Freudenheim (Schwanenteichallee 5, alle vier sind
nach Uruguay geflohen). Seit einer Verlegung von 12
"Stolpersteinen" im September 2016 (auch für Opfer der
"Euthanasie"-Aktion erinnern insgesamt 53
"Stolpersteine" in Mühlhausen an Opfer der
NS-Gewaltherrschaft. |
Hinweis: in den einzelnen Listen (die obige Übersicht kann auch davon
betroffen sein) kommt es immer wieder zu Verwechslungen zwischen den in
verschiedenen Orten Mühlhausen (Franken, Elsass, Westpreußen)
bestehenden jüdischen Gemeinden.
Über die aktuelle Situation (2011) der wenigen jüdischen Familien in
Mühlhausen siehe unten: Presseartikel
vom Januar 2011.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle(n) des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1859 /
1862 / 1873 / 1888 sowie Ausschreibung der Stelle eines Vorbeters zu Jom Kippur (1916)
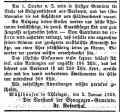 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Januar 1859:
"Am 1. Oktober dieses Jahres wird in hiesiger Gemeinde die Stelle des
Religionslehrers und Vorbeters, und den 1. November die des Schächters
und Hilfsvorbeters vakant. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Januar 1859:
"Am 1. Oktober dieses Jahres wird in hiesiger Gemeinde die Stelle des
Religionslehrers und Vorbeters, und den 1. November die des Schächters
und Hilfsvorbeters vakant.
Bei Besetzung beider Stellen werden nur solche Aspiranten berücksichtigt,
die preußische Staatsbürger sind und gute Zeugnisse aufzuweisen haben. -
Vom Kandidaten der ersteren wird außerdem verlangt, dass derselbe eine
angenehme sonore Stimme und genügende musikalische Kenntnisse besitzt, um
einen Chor selbständig leiten zu können. Bewerber der zweiten müssen
unverheiratet sein.
Das jährliche Einkommen dieser letztern beläuft sich inklusive aller
Akzidenzien auf ungefähr 180 Thaler, das des Lehrers und Vorbeters ist
mit 250 Thaler fixiert, erreicht aber mit den damit verbundenen
Emolumenten die Höhe von mindestens 300 Thaler.
Alle desfallsigen Anmeldungen müssen portofrei geschehen.
Mühlhausen in Thüringen, den 2. Januar 1859. Der Vorstand der
Synagogen-Gemeinde Dr. Rosenthal." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Juli 1862: "Vom
1sten November dieses Jahres ist an der hiesigen Synagogengemeinde die
Stelle eines Religionslehrers und ersten Vorbeters vakant; sie bietet
einen fixen Gehalt von dreihundert Thalern, außer den üblichen
Akzidenzien. Erfordern wird neben tüchtiger Lehrer-Qualifikation auch
besonders die für einen geordneten Gottesdienst nötige musikalische
Bildung. Reflektierende wollen ihre Zeugnisse einsenden an den Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Juli 1862: "Vom
1sten November dieses Jahres ist an der hiesigen Synagogengemeinde die
Stelle eines Religionslehrers und ersten Vorbeters vakant; sie bietet
einen fixen Gehalt von dreihundert Thalern, außer den üblichen
Akzidenzien. Erfordern wird neben tüchtiger Lehrer-Qualifikation auch
besonders die für einen geordneten Gottesdienst nötige musikalische
Bildung. Reflektierende wollen ihre Zeugnisse einsenden an den
Vorstand der israelitischen Synagogen-Gemeinde zu Mühlhausen in
Thüringen." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom, 18. Februar 1873:
"Ein Vorbeter mit musikalischer Befähigung, der gleichzeitig das Schächteramt
versehen kann, wird zum 1. April für unsere Gemeinde gesucht.
Unverheirateten Bewerbern werden wir unter gegenwärtigen
Gemeindeverhältnissen den Vorzug geben. Nähere Bedingungen sind beim
Unterzeichneten zu erfragen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom, 18. Februar 1873:
"Ein Vorbeter mit musikalischer Befähigung, der gleichzeitig das Schächteramt
versehen kann, wird zum 1. April für unsere Gemeinde gesucht.
Unverheirateten Bewerbern werden wir unter gegenwärtigen
Gemeindeverhältnissen den Vorzug geben. Nähere Bedingungen sind beim
Unterzeichneten zu erfragen.
Mühlhausen in Thüringen, im Februar 1873. Der Vorstand M. Mankiewitz." |
| |
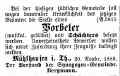 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1888:
"Bei der hiesigen jüdischen Gemeinde soll wegen dauernder
Kränklichkeit des jetzigen Beamten die Stelle eines Vorbeters Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1888:
"Bei der hiesigen jüdischen Gemeinde soll wegen dauernder
Kränklichkeit des jetzigen Beamten die Stelle eines Vorbeters
(musikalisch gebildet) und Schächters besetzt werden.
Unverheiratete Bewerber wollen sich unter Zusendung ihrer Zeugnisse
baldigst melden.
Mühlhausen in Thüringen, 20. November 1888. Der Vorstand der
Synagogen-Gemeinde. Bergmann." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 8. September 1916: Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 8. September 1916:
"Die Synagogengemeinde Mühlhausen (Thüringen) sucht zu
Jom-Kippur einen
Vorbeter für Schachris und Mincha. Offerten mit Preisangaben an den
Vorstand." |
Wahl von Dr. Gerson Cohn aus Dessau zum Prediger und Religionslehrer
(1839)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Dezember
1839: "Mühlhausen, 10. Dezember 1839: Auch hier, in
Mühlhausen in Thüringen, wo nur eine kleine jüdische Gemeinde weilt,
wurde das Bedürfnis gefühlt, hinter den Fortschritten des jüdischen
Kultus nicht hintenan zu bleiben, und die Gemeinde hat den Dr. G. Cohn
aus Dessau zu ihrem Prediger und Religionslehrer erwählt, der seit
Ostern dieses Jahres auf eine kräftige und gediegene Weise, die
Wahrheiten unserer Religion bespricht. Am zweiten Tage des
Laubhüttenfestes fand die erste Einsegnung zweier Knaben auf eine
feierliche Weise statt, wobei deutsche Gesänge vor und nach der Predigt
eingeschaltet wurden. Die Ausbildung unseres Gottesdienstes geht
insbesondere durch die Mühewaltung des Vorstehers Oppe ihren ruhigen,
aber sicheren Gang. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Dezember
1839: "Mühlhausen, 10. Dezember 1839: Auch hier, in
Mühlhausen in Thüringen, wo nur eine kleine jüdische Gemeinde weilt,
wurde das Bedürfnis gefühlt, hinter den Fortschritten des jüdischen
Kultus nicht hintenan zu bleiben, und die Gemeinde hat den Dr. G. Cohn
aus Dessau zu ihrem Prediger und Religionslehrer erwählt, der seit
Ostern dieses Jahres auf eine kräftige und gediegene Weise, die
Wahrheiten unserer Religion bespricht. Am zweiten Tage des
Laubhüttenfestes fand die erste Einsegnung zweier Knaben auf eine
feierliche Weise statt, wobei deutsche Gesänge vor und nach der Predigt
eingeschaltet wurden. Die Ausbildung unseres Gottesdienstes geht
insbesondere durch die Mühewaltung des Vorstehers Oppe ihren ruhigen,
aber sicheren Gang.
(Im Herzogtum Sachsen zählt man bereits drei Gemeinden, wo regelmäßig
deutsche religiöse Vorträge gehalten werden: Magdeburg, Nordhausen,
Mühlhausen. In der Mark eine: Berlin. In Schlesien eine: Glogau, In
Preußen zwei: Königsberg und Danzig. Im Rheinland mehrere, die wir aber
nicht mit Bestimmtheit angeben können. Redakt." |
Dr. Gerson B. Cohn betreibt eine Pensions-Anstalt für
jüdische Knaben (1843)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Dezember
1843: "Neu eröffnete Pensions-Anstalt. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Dezember
1843: "Neu eröffnete Pensions-Anstalt.
Da bei vielen Eltern das Bedürfnis einer Pensionsanstalt in einer solchen
Stadt fühlbar geworden ist, wo ihren Söhnen die Vorteile der Vorbildung
für jeglichen Beruf dargeboten werden, ohne die Nachteile allzu großer
Kostspieligkeit und der Verwöhnung in größeren Städten, so habe ich
nach meiner kürzlichen Verheiratung mich entschlossen, am hiesigen Orte
eine solche zu errichten. Für das jüngere Alter bietet die jüdische
Schule. für die, welche sich dem Studium widmen wollen, das hiesige
Gymnasium, für die, welche sich für den Kaufmannsstand bestimmen, meine
eigene Lehranstalt alle nötigen Mittel zu der erforderlichen Ausbildung
dar. Ich erbiete mich daher zur Aufnahme von Knaben jeden Alters, und es
wird mir stets heilige Pflicht sein, meinen Zöglingen die liebevollste
Pflege und die sorgfältigste Aufsicht und Leitung zu widmen, um ihre
intellektuelle und religiös sittliche Bildung so zu fördern, wie es zu
ihrem wahren Wohle und zur Freude ihrer Eltern geschehen kann. Im Besitze
der Zufriedenheit der hiesigen nicht bloß israelitischen, sondern auch
christlichen Eltern, deren Söhnen ich vorbereitenden Unterricht für den
Kaufmannsstand erteile, schmeichele ich mir auch das Zutrauen auswärtiger
Eltern und Vormünder zu erwerben. Die Bedingungen, die ich auf portofreie
Briefe mitzuteilen bereit bin, werde ich so billig, wie möglich
stellen.
Mühlhausen in Thüringen, im November 1843.
Dr. G. B. Cohn,
Geistlicher der israelitischen Gemeinde zu Mühlhausen in Thüringen.
Wenn ich in Bezug der vorstehenden Anzeige hiermit erkläre, dass das
Gymnasium Zöglinge des Israelitischen Geistlichen, Herrn Dr. Cohn
jederzeit gern aufnehmen wird, so geschieht dies in Folge der Erfahrung,
dass die bisher uns von ihm zugeführten Schüler sich durch gutes
Betragen, eifrigen Fleiß und erfreuliche Fortschritte auszuzeichnen
pflegten. Überdies habe ich sowohl den gewissenhaften Ernst und die
liebevolle Sorgfalt, als auch |
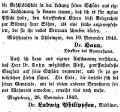 die
Geschicklichkeit in der Leitung seiner Schüler aus eigener Anschauung so
kennen lernen, dass ich es für meine Pflicht halte, den betreffenden
Eltern diese Gelegenheit zur Bildung ihrer Söhne, als eine solche
anzuempfehlen, der sie ihr volles Vertrauen schenken dürfen. die
Geschicklichkeit in der Leitung seiner Schüler aus eigener Anschauung so
kennen lernen, dass ich es für meine Pflicht halte, den betreffenden
Eltern diese Gelegenheit zur Bildung ihrer Söhne, als eine solche
anzuempfehlen, der sie ihr volles Vertrauen schenken dürfen.
Mühlhausen in Thüringen, den 19. November 1843,
Dr. Haun, Direktor des Gymnasiums.
Auch ich kann aus eigener Anschauung versichern, dass Herr Dr. Cohn
möglichsten Fleiß, gewissenhafteste Sorgfalt auf seine Schüler
verwendet, und sie zu gedeihlichen Zielen führet. Die Liebe, die derselbe
sich bei seiner Gemeinde, wie bei vielen anderen Bewohnern seines Wohnorts
erworben, erweiset dies noch mehr.
Magdeburg, 26. November 1843. Dr. Ludwig Philippson, Rabbiner."
|
Über die beiden Kultbeamten der jüdischen Gemeinde (1846)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November
1846: "In dem benachbarten Mühlhausen, einer wirklich
gebildeten Gemeinde, ist vor wenigen Jahren eine neue Synagoge gebaut, und
sind schon vielfältige Verbesserungen dort eingeführt worden. Überhaupt
zeigt man sich dort für alles Gute recht empfänglich. Der Herr Dr. Cohn
wirkt als Prediger wie als Schulmann in Verbindung mit dem kenntnisreichen
Vorsänger, Herrn Freystadt, recht wacker, und die Liebe seiner Gemeinde
erleichtert ihm seinen schweren Beruf." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November
1846: "In dem benachbarten Mühlhausen, einer wirklich
gebildeten Gemeinde, ist vor wenigen Jahren eine neue Synagoge gebaut, und
sind schon vielfältige Verbesserungen dort eingeführt worden. Überhaupt
zeigt man sich dort für alles Gute recht empfänglich. Der Herr Dr. Cohn
wirkt als Prediger wie als Schulmann in Verbindung mit dem kenntnisreichen
Vorsänger, Herrn Freystadt, recht wacker, und die Liebe seiner Gemeinde
erleichtert ihm seinen schweren Beruf." |
Todesanzeige für den Prediger Dr. Gerson Cohn (1859)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. September 1859: "Todesanzeige.
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. September 1859: "Todesanzeige.
Am 18ten dieses Monats entschlief nach kurzem Krankenlager zu einem
besseren Leben mein teurer Gatte, der Prediger Dr. Gerson Cohn, in
seinem 52sten Lebensjahre. Wer den edlen Verklärten kannte, wird meinen
tiefen Schmerz bemessen, da ich mit vier unmündigen Kindern am Grabe des
geliebten Mannes weine. Nur auf Gott, den vater der Witwen und Waisen,
vertraue ich, 'sein Stab und sein Stecken, sie trösten mich!'
Mühlhausen in Thüringen, 25. August 1859. Verwitwete Dr. Cohn
geb. Löbenstein." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Uhrenhandlung en gros von J. M. Bon (1863)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1863: Einen Lehrling mit bester Schulbildung und
der französischen Sprache vollkommen mächtig, suche für meine
Uhrenhandlung en gros in Mühlhausen. J. M. Bon,
Leipzig Reichsstraße 3 und Mühlhausen in Thüringen". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1863: Einen Lehrling mit bester Schulbildung und
der französischen Sprache vollkommen mächtig, suche für meine
Uhrenhandlung en gros in Mühlhausen. J. M. Bon,
Leipzig Reichsstraße 3 und Mühlhausen in Thüringen". |
Lehrlingssuche des
Leder-Geschäftes Bergmann & Co. (1883)
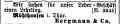 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. März
1883: "Wir suchen für unser Leder-Geschäft einen Lehrling. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. März
1883: "Wir suchen für unser Leder-Geschäft einen Lehrling.
Mühlhausen in Thüringen. Bergmann & Co." |
Anzeige der Viehhandlung A. Stein jr. (1898)
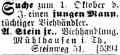 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1898: "Suche
zum 1. Oktober dieses Jahres einen jungen Mann, tüchtiger
Viehhändler. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1898: "Suche
zum 1. Oktober dieses Jahres einen jungen Mann, tüchtiger
Viehhändler.
A. Stein jr., Viehhandlung, Mühlhausen in Thüringen, Steinweg
51." |
Zur Geschichte der Synagoge
Die mittelalterliche Synagoge in der "Jüdenstraße" wird um
1380 erstmals genannt. 1474 wurde die Synagoge erweitert. Sie war bis Anfang des
16. Jahrhunderts in jüdischem Besitz. 1513 wurde das Gebäude verkauft. Um 1560 -
etwa 50 Jahre nach dem Ende der ersten jüdischen Gemeinde in der Stadt - wird
die ehemalige Synagoge als leerstehend bezeichnet.e Über
die Frage, ob die mittelalterliche Synagoge im späteren Rathaus aufgegangen
sein könnte, was jedoch durch nichts belegt werden kann, siehe unten die
Presseartikel vom September 2010.
Nachdem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrere jüdische Familien
zugezogen waren und 1806 eine neue jüdische Gemeinde gegründet worden war,
wurde von den im Jahr 1808 elf in der Stadt wohnenden jüdischen Familien
die Abhaltung von Gottesdiensten beantragt. Am 2. Mai 1839 wurde der Antrag für
den Bau einer Synagoge auf dem rückwärtigen Teil eines Grundstückes in der Jüdenstraße
(heute: Jüdenstraße 24) gestellt. Der Antrag wurde genehmigt. Im folgenden
Jahr konnte mit dem Bau begonnen werden - die Grundsteinlegung war am 7.
September 1840.
Grundsteinlegung zur neuen Synagoge am 7.
September 1840
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Oktober 1840:
"Mühlhausen, 18. September (1840), Obgleich unsere Gemeinde
hier nur aus 20-22 Familien besteht, so hat sie demnach beschlossen, eine
neue Synagoge erbauten zu lassen, und die dazu gehörigen Mittel unter
sich selbst aufgebracht. Mit lobenswertem Eifer nimmt sich unser Vorsteher
Herr S.A. Oppe der Sache an. Ihm zur Seite aber stehen auch noch viele
andere Mitglieder unserer Gemeinde und jeder trägt mit Freuden sein
Scherflein bei. Am Montag, den 7. September, wurde der Grundstein zu
diesem neuen Gotteshause gelegt. Am Bauplatze hatten sich alle Gemeinde-Mitglieder
versammelt. Die Handlung begann mit Absingung eines Hallelujah, worauf der
Dr. Cohn ein Dokument verlas, welches die näheren Berichte über den Bau
dieser Synagoge, über den Zustand unserer Gemeinde usw. enthielt und
welches mit einem Exemplar des Testamentes des hochseligen Königs von Preußen,
mit einem Exemplar des hiesigen Wochenblattes, der Allgemeinen Zeitung des
Judentums und mit einem hebräischen Gedichte, verfasst von Herrn D.
Mankiewitz, in einer Büchse von Zink verwahrt in den Grundstein gelegt
wurde. Hierauf sprach Dr. Cohn einige Worte über die hohe Bedeutung des
Tages und über die des Ortes, worauf wir standen, und forderte die
Gemeinde auf, stets in Einigkeit und Liebe zu leben, da diese den
Grundstein zu allen hohen und edlen Taten bilden. Darauf folgte die
eigentliche Handlung der Grundsteinlegung, und unser Vorsteher Herr S.A.
Oppe ergriff den Hammer, und indem er einige Worte mit großer Rührung
sprach, worin er Gott dankte für die hohen Freuden, die er ihm und uns
allen bereitet hat, tat er die ersten Schläge, worauf die übrigen
Mitglieder der Gemeinde dasselbe taten. Nun erfolgte von Seiten unseres
Predigers die Einsegnung des Ortes, und ein Gebet zum Herrn um seinen
Segen für das Werk, und um seinen Schutz für die Arbeiter. Zum Schluss
ward der 150. Psalm abgesungen, und die Feier war vollendet, nicht ohne
tiefen Eindruck bei jedem Einzelnen zu hinterlassen, der gewiss
segensreiche Früchte tragen wird. Noch will ich einen frommen Verein
unserer Frauen erwähnen, der durch den Dr. Cohn seit einem Jahre
gestiftet wurde, und welcher seine Mitglieder verpflichtet, für arme, kranke,
sterbende und tote Frauen mit menschenfreundlicher Liebe zu sorgen. Der
Verein hat seit seiner Entstehung leider schon oft Gelegenheit gehabt,
seine Wirksamkeit zu zeigen, und die einzelnen Mitglieder desselben
bemühen sich, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Möge Gott ihnen
dazu seinen Segen verleihen und die Kraft, stets das Gute aus reinen,
liebevollen Ansichten zu üben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Oktober 1840:
"Mühlhausen, 18. September (1840), Obgleich unsere Gemeinde
hier nur aus 20-22 Familien besteht, so hat sie demnach beschlossen, eine
neue Synagoge erbauten zu lassen, und die dazu gehörigen Mittel unter
sich selbst aufgebracht. Mit lobenswertem Eifer nimmt sich unser Vorsteher
Herr S.A. Oppe der Sache an. Ihm zur Seite aber stehen auch noch viele
andere Mitglieder unserer Gemeinde und jeder trägt mit Freuden sein
Scherflein bei. Am Montag, den 7. September, wurde der Grundstein zu
diesem neuen Gotteshause gelegt. Am Bauplatze hatten sich alle Gemeinde-Mitglieder
versammelt. Die Handlung begann mit Absingung eines Hallelujah, worauf der
Dr. Cohn ein Dokument verlas, welches die näheren Berichte über den Bau
dieser Synagoge, über den Zustand unserer Gemeinde usw. enthielt und
welches mit einem Exemplar des Testamentes des hochseligen Königs von Preußen,
mit einem Exemplar des hiesigen Wochenblattes, der Allgemeinen Zeitung des
Judentums und mit einem hebräischen Gedichte, verfasst von Herrn D.
Mankiewitz, in einer Büchse von Zink verwahrt in den Grundstein gelegt
wurde. Hierauf sprach Dr. Cohn einige Worte über die hohe Bedeutung des
Tages und über die des Ortes, worauf wir standen, und forderte die
Gemeinde auf, stets in Einigkeit und Liebe zu leben, da diese den
Grundstein zu allen hohen und edlen Taten bilden. Darauf folgte die
eigentliche Handlung der Grundsteinlegung, und unser Vorsteher Herr S.A.
Oppe ergriff den Hammer, und indem er einige Worte mit großer Rührung
sprach, worin er Gott dankte für die hohen Freuden, die er ihm und uns
allen bereitet hat, tat er die ersten Schläge, worauf die übrigen
Mitglieder der Gemeinde dasselbe taten. Nun erfolgte von Seiten unseres
Predigers die Einsegnung des Ortes, und ein Gebet zum Herrn um seinen
Segen für das Werk, und um seinen Schutz für die Arbeiter. Zum Schluss
ward der 150. Psalm abgesungen, und die Feier war vollendet, nicht ohne
tiefen Eindruck bei jedem Einzelnen zu hinterlassen, der gewiss
segensreiche Früchte tragen wird. Noch will ich einen frommen Verein
unserer Frauen erwähnen, der durch den Dr. Cohn seit einem Jahre
gestiftet wurde, und welcher seine Mitglieder verpflichtet, für arme, kranke,
sterbende und tote Frauen mit menschenfreundlicher Liebe zu sorgen. Der
Verein hat seit seiner Entstehung leider schon oft Gelegenheit gehabt,
seine Wirksamkeit zu zeigen, und die einzelnen Mitglieder desselben
bemühen sich, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Möge Gott ihnen
dazu seinen Segen verleihen und die Kraft, stets das Gute aus reinen,
liebevollen Ansichten zu üben." |
Ein knappes Jahr später konnte die Einweihung der
neuen Synagoge festlich begangen werden.
Einweihung der neuen Synagoge am 6.
August 1841
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. September
1841: "Mühlhausen im August 1841. Der 6. August dieses Jahres
war für die Israeliten Mühlhausens ein feierlicher Tag, wie ihn diese
Gemeinde nicht leicht vorher erlebt haben mochte. An diesem Tage fand die Einweihung
der geschmackvoll neu erbauten und behufs der Feier sinnreich
geschmückten Synagoge, nachmittags 1 1/2 Uhr statt. Der wohllöbliche Vorstand,
bestehend aus den Gemeindemitgliedern, den Herren Kaufleuten Mankiewitz
und Oppe, sowie dem Herrn Dr. med. Rosenthal hatten durch ein besonderes
Programm und ausgegebene Einladungsscharten dazu außer ihren
Glaubensgenossen auch folgende Bewohner eingeladen: die Vorgesetzten der
Stadt, die Geistlichkeit, die Generalität, die oberen Gerichtspersonen,
die Gymnasiallehrer und die Direktoren sämtlicher Schulanstalten, sowie
die Stadtverordneten nebst anderen Angesehenen. Ein großer Teil erschien
und kaum reichte der etwas beschränkte Raum aus; ungeachtet die
christliche Geistlichkeit sich nicht eingefunden hatte, weil ihnen von
ihrem Oberhaupte eine Kabinettsorder vom Jahre 1822 in Erinnerung gebracht
worden war, welche das Besuchen von dergleichen Feierlichkeiten untersagt.
Die Gymnasiallehrer waren sämtlich zugegen; vom Gerichte waren mehrere
verreist, andere anderweitig verhindert, die daher ihren Damen ihre Stelle
überließen. Referent, kein Mitglied Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. September
1841: "Mühlhausen im August 1841. Der 6. August dieses Jahres
war für die Israeliten Mühlhausens ein feierlicher Tag, wie ihn diese
Gemeinde nicht leicht vorher erlebt haben mochte. An diesem Tage fand die Einweihung
der geschmackvoll neu erbauten und behufs der Feier sinnreich
geschmückten Synagoge, nachmittags 1 1/2 Uhr statt. Der wohllöbliche Vorstand,
bestehend aus den Gemeindemitgliedern, den Herren Kaufleuten Mankiewitz
und Oppe, sowie dem Herrn Dr. med. Rosenthal hatten durch ein besonderes
Programm und ausgegebene Einladungsscharten dazu außer ihren
Glaubensgenossen auch folgende Bewohner eingeladen: die Vorgesetzten der
Stadt, die Geistlichkeit, die Generalität, die oberen Gerichtspersonen,
die Gymnasiallehrer und die Direktoren sämtlicher Schulanstalten, sowie
die Stadtverordneten nebst anderen Angesehenen. Ein großer Teil erschien
und kaum reichte der etwas beschränkte Raum aus; ungeachtet die
christliche Geistlichkeit sich nicht eingefunden hatte, weil ihnen von
ihrem Oberhaupte eine Kabinettsorder vom Jahre 1822 in Erinnerung gebracht
worden war, welche das Besuchen von dergleichen Feierlichkeiten untersagt.
Die Gymnasiallehrer waren sämtlich zugegen; vom Gerichte waren mehrere
verreist, andere anderweitig verhindert, die daher ihren Damen ihre Stelle
überließen. Referent, kein Mitglied |
 der
jüdischen Gemeinde, kann gleichwohl, übereinstimmend mit dem Urteil
sachkundiger und vorurteilsfreier Zuhörer versichern, dass diese
religiöse Feier sich im Allgemeinen des Beifalls der Anwesenden erfreut
habe und er erlaubt sich demgemäss ein gedrängtes Ergebnis derselben
mitzuteilen. Ungeachtet die Tageshitze drückender geworden war und trotz
der zahlreichen Versammlung und ungeachtet Liturgie und Predigt beinahe
zwei Stunden lange gedauert hatten, fand dennoch die größte Andacht
statt, da stilles, ruhiges Verhalten überall eine große Teilnahme von
Seiten sämtlicher Anwesenden zu erkennen gab. Die Musik dirigierte Herr
Musikdirektor Möller auf eine der Feier dieses Tages angemessene Weise.
Am meisten aber sprach die Predigt des Herrn Dr. Cohn an, dessen
Rednertalent schon öfters rühmlich anerkannt worden ist. Seiner frommen
Betrachtung legte er zu Grunde den Text aus Psalm 26,8. Er bewies klar und
bündig, in einem würdigen und kräftigen Vortrag 'Wozu die Liebe zum
Gotteshause führen sollte, inwiefern sie auffordern müsse erstens zum
Dank, zunächst gegen den Schöpfer und hob mit Recht die bedeutenden
Opfer hervor, welche die kleine Gemeinde hierselbst gebracht hatte, so wie
er den Edelmut des Magistrats lobte, der das wichtige Werk zu befördern
gesucht habe. Eine zweite Forderung war: 'Habet einen wahrhaft frommen
Sinn. Eine dritte: 'übertraget diesen -- auf Euer ganzes Leben und Euern
Wandel außer dem Tempel. Die ganze Auseinandersetzung innerhalb einer
halben Stunde, bewies sattsam, das der Redner wohl eingesehen hatte, dass
die Forderung eines Gotteshauses an seine Gemeinde nicht allein, sondern
auch an alle Menschen, ohne Unterschied des Glaubens ergehe. Eine
erfreuliche, kosmopolitische Ansicht, die dem weisesten hebräische
Regenten immer zur Ehre gereichen wird (1. Buch der Könige Kap. ?, V. 41
usw.) Übrigens ist christlicherseits ein Abdruck der Predigt gewünscht
worden. - Bei dieser Gelegenheit wollen wir nur noch erwähnen, dass Herr
Cohn es ist, der im Verein mit den Herren Vorstehern seiner Gemeinde
folgende Veranstaltung getroffen hat. Der Gottesdienst ist durch Gesänge,
durch andachtvolles ruhiges Beten zu heben. Alles war die Andacht stört,
wird vermieden. Alle Psalmen werden Vers um Vers, vom Vorsänger und von
der Gemeinde rezitiert. - Der im Programm abgedruckte Choral (I) gehört
dem Vorsteher Herrn Mankiewitz an, dessen Kenntnisse auch außerdem
Anerkennung verdienen. Außer der gottesdienstlichen Feier, hatte die
Gemeinde, die bereits durch Aufführung ihres Tempels eine Summe von
3-4000 Talern verwendet hatte, auch noch den folgenden Tag alle jüdische
Arme und überdies 42 christliche Dürftige öffentlich gespeist, so wie
sie auch ihre Freude über ihr ereichtes Ziel durch ein gemeinsames frohes
Mahl und einen Ball im neuen Schauspielhaus zu erkennen gab.
S-r." der
jüdischen Gemeinde, kann gleichwohl, übereinstimmend mit dem Urteil
sachkundiger und vorurteilsfreier Zuhörer versichern, dass diese
religiöse Feier sich im Allgemeinen des Beifalls der Anwesenden erfreut
habe und er erlaubt sich demgemäss ein gedrängtes Ergebnis derselben
mitzuteilen. Ungeachtet die Tageshitze drückender geworden war und trotz
der zahlreichen Versammlung und ungeachtet Liturgie und Predigt beinahe
zwei Stunden lange gedauert hatten, fand dennoch die größte Andacht
statt, da stilles, ruhiges Verhalten überall eine große Teilnahme von
Seiten sämtlicher Anwesenden zu erkennen gab. Die Musik dirigierte Herr
Musikdirektor Möller auf eine der Feier dieses Tages angemessene Weise.
Am meisten aber sprach die Predigt des Herrn Dr. Cohn an, dessen
Rednertalent schon öfters rühmlich anerkannt worden ist. Seiner frommen
Betrachtung legte er zu Grunde den Text aus Psalm 26,8. Er bewies klar und
bündig, in einem würdigen und kräftigen Vortrag 'Wozu die Liebe zum
Gotteshause führen sollte, inwiefern sie auffordern müsse erstens zum
Dank, zunächst gegen den Schöpfer und hob mit Recht die bedeutenden
Opfer hervor, welche die kleine Gemeinde hierselbst gebracht hatte, so wie
er den Edelmut des Magistrats lobte, der das wichtige Werk zu befördern
gesucht habe. Eine zweite Forderung war: 'Habet einen wahrhaft frommen
Sinn. Eine dritte: 'übertraget diesen -- auf Euer ganzes Leben und Euern
Wandel außer dem Tempel. Die ganze Auseinandersetzung innerhalb einer
halben Stunde, bewies sattsam, das der Redner wohl eingesehen hatte, dass
die Forderung eines Gotteshauses an seine Gemeinde nicht allein, sondern
auch an alle Menschen, ohne Unterschied des Glaubens ergehe. Eine
erfreuliche, kosmopolitische Ansicht, die dem weisesten hebräische
Regenten immer zur Ehre gereichen wird (1. Buch der Könige Kap. ?, V. 41
usw.) Übrigens ist christlicherseits ein Abdruck der Predigt gewünscht
worden. - Bei dieser Gelegenheit wollen wir nur noch erwähnen, dass Herr
Cohn es ist, der im Verein mit den Herren Vorstehern seiner Gemeinde
folgende Veranstaltung getroffen hat. Der Gottesdienst ist durch Gesänge,
durch andachtvolles ruhiges Beten zu heben. Alles war die Andacht stört,
wird vermieden. Alle Psalmen werden Vers um Vers, vom Vorsänger und von
der Gemeinde rezitiert. - Der im Programm abgedruckte Choral (I) gehört
dem Vorsteher Herrn Mankiewitz an, dessen Kenntnisse auch außerdem
Anerkennung verdienen. Außer der gottesdienstlichen Feier, hatte die
Gemeinde, die bereits durch Aufführung ihres Tempels eine Summe von
3-4000 Talern verwendet hatte, auch noch den folgenden Tag alle jüdische
Arme und überdies 42 christliche Dürftige öffentlich gespeist, so wie
sie auch ihre Freude über ihr ereichtes Ziel durch ein gemeinsames frohes
Mahl und einen Ball im neuen Schauspielhaus zu erkennen gab.
S-r." |
Fast 100 Jahre war die Synagoge in Mühlhausen Mittelpunkt des religiösen
Lebens der jüdischen Gemeinde in der Stadt.
Beim
Novemberpogrom 1938
wurde die Synagoge geschändet. NSDAP-Kreisleiter Paul Vollrath war mit seinen Saufkumpanen in
die Synagoge eingedrungen. Lehrer Max Rosenau wurde die Treppe hinunter geworfen
und mit Pistolenschüssen schwer verletzt. Die Inneineinrichtung der Synagoge
wurde völlig zerstört.
Nach 1945 wurde die ehemalige Synagoge der jüdischen Landesgemeinde
Thüringen übergeben (1947). Seit 1987 gab es Bemühungen um die Restaurierung
des Gebäudes, die in den 1990er-Jahren durchgeführt wurde. Am 9. November
1998 konnte das Gebäude wieder eingeweiht werden. Die ehemalige Synagoge
und das jüdische Gemeindehaus werden seitdem als Begegnungsstätte mit
Ausstellung und Bibliothek verwendet.
Öffnungszeiten: Montags und Samstags geschlossen, Dienstag bis Freitag
10.00 - 16.45 Uhr, Sonntags 13.00 - 16.45 Uhr
Termine nach Voranmeldung möglich unter Tel. 0 36 01 - 40 47
70 E-Mail
Eintrittspreise: Erw. 1,50 € pro Person, erm. 1,00 € pro Person
Adresse/Standort der Synagoge: Jüdenstraße 24: das Hofgebäude ist die frühere Synagoge, die jüdische
Gemeindehaus mit der Schule ist das Vorderhaus
Fotos
(Fotos: wenn nicht anders angegeben: Hahn, Aufnahmedatum
27./28.4.2011)
Außenansichten des
restaurierten
ehemaligen jüdischen Gemeindehauses
und der Synagoge
|
 |
 |
| |
Das ehemalige jüdische Gemeindehaus
mit Hinweistafel: "Jüdisches Gemeindehaus und Synagoge -
Jüdenstraße 24. Vorderhaus um 1700 erbaut, 1840 Erwerb durch Jüdische
Gemeinde und Nutzung als Gemeindehaus. 1841/42 Bau der Synagoge im
Hofbereich. 9. November 1938 Schändung der Synagoge. Vorderhaus als
Ghettohaus verwendet und nach 1945 als Wohnhaus für jüdische Bürger
genutzt. 1998 Sanierung beider Gebäude und Wiederweihe der
Synagoge". |
| |
|
|
 |
 |
 |
Rundbogenfenster der
ehemaligen Synagoge
(Quelle: www.synagogen.info) |
Blick auf Gebäude
der ehemaligen Synagoge mit dem Rundfenster über dem
Standort des Toraschreines |
| |
| |
|
|
Innenraum der
restaurierten
ehemaligen Synagoge
(Quelle: Website
der Stadt Mühlhausen) |
 |
 |
| |
Blick in den
Innenraum (Blick nach Süden) |
Der rekonstruierte
Toraschrein (Quelle) |
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
| November
2008: Gedenken zum 70. Jahrestag des
Novemberpogrom 1938 |
Artikel von Dr. Uta Ziegner in der "Thüringer
Landeszeitung" vom 13. November 2008 (Artikel):
"Ökumenische Friedensdekade in der Synagoge.
MÜHLHAUSEN. Am 10. November 1938, 0.30 Uhr, wurde die Synagoge in Mühlhausen von den Nazis gestürmt, der Rabbiner
Rosenau misshandelt und angeschossen, die Räumlichkeiten demoliert. Fast auf den Tag genau, 70 Jahre später, versammeln sich in dem gepflegten lichten Gebetsraum erwartungsvolle Zuhörer zum Konzert
"Schalom, liebe Freunde", nunmehr die Chance nutzend, eine andere Kultur
kennenzulernen.
Die Veranstaltung fand innerhalb der 16. Tage der jüdisch-israelischen Kultur in Thüringen statt, die das Zitat Theodor Herls "Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen" zum Motto nimmt. Seine Utopie von 1902 wurde vor 60 Jahren mit der Staatsgründung von Israel durch David Ben Gurion in Tel Aviv zur Wirklichkeit:
yes, we can. Damit begann auch die Wiederbesinnung auf die eigenen kulturellen Werte durch Sammlungen alter Volkslieder sowie Kompositionen neuer Musik. Diese wiederum beziehen die modalen Bildungen und Rhythmen ihrer Vorbilder gern ein. Zu ihnen gehört die israelische Komponistin Naomi
Shemer. Aus ihrem Repertoire sang die Mezzosopranistin Regina Goldstein, begleitet von Ludmila
Kutzovskaya. Beide Interpretinnen leben heute in Erfurt. Als Regina Goldstein 1996 aus der Ukraine nach Thüringen übersiedelte, begann sie mit dem Gesangsstudium. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin und betrachtet die Musik als ihr Hobby. Das aber pflegt sie besonders mit zeitgenössischer, israelischer Gesangsliteratur, die sie oft direkt aus Israel bezieht. Ihre Partnerin Ludmila Kutzovskaya übernimmt die speziellen Duo-Bearbeitungen. Sie studierte Klavier in Moskau und ist seitdem eine vielgesuchte Begleiterin und Korrepetitorin. Seit 2005 lebt sie in Deutschland und übt eine rege Konzerttätigkeit aus.
Das Programm mit dem Titel "Schalom, liebe Freunde" innerhalb der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade in Mühlhausen ist eine musikalische Reise durch Israel. Das Spektrum ist groß. Es fehlten auch jene dem volkstümlichen Albumblatt angenäherten Lieder nicht, die inzwischen auch Israels Musikpodien erreicht haben, wie der Walzer mit Vokalise aus dem Jahr 2001.
Inhaltlich dominierten die Wünsche um Frieden, Glück, Hoffnung und Gesundheit. Von den beiden Musikerinnen, die sehr gut aufeinander eingespielt waren, ging auch in den Moderationen von Regina Goldstein große Herzlichkeit aus. Sie sang in drei Sprachen. Ihr perfektes Russisch und Jiddisch stellte sie in alten Volksliedern vor, während sie in Hebräisch das gelobte Heilige Land besang. Nicht nur den künstlerischen Darbietungen, sondern auch der freundlichen Atmosphäre des Abends galt der Beifall des Publikums." |
| |
| April
2010: Die Verlegung von
"Stolpersteinen" in der Stadt wird vom Mühlhäuser Stadtrat
abgelehnt |
Artikel (ske) vom 15. April
2010 in der "Thüringer Allgemeinen" (Artikel):
"Stolpersteine in Mühlhausen wieder fraglich
Deutlich abgelehnt mit 22 Nein- bei 11 Ja-Stimmen wurde Donnerstagabend im Mühlhäuser Stadtrat ein Antrag der Fraktionen Pro Mühlhausen/Grüne und Linke.
Mühlhausen. Der Antrag sah vor, dass die Verwaltung einen Initiativkreis unterstützt, der Stolpersteine in der Stadt verlegt, die an jüdische Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Sachlich ausgetauscht wurden dabei die Argumente Für und Wider, Befürworter und Gegner des Kunstprojekts zitiert..."
Link zum Artikel siehe oben. |
| |
| September
2010: War das Mühlhäuser Rathaus
ursprünglich die mittelalterliche Synagoge ? |
Artikel von Jürgen Wand in der "Thüringer Allgemeinen" vom 4.
September 2010 (Artikel):
"Mühlhäuser sucht nach Beweis für verschollene Synagoge.
Mit einem Festakt wurde unlängst an die Ersterwähnung des Mühlhäuser Rathauses 1310 erinnert. Doch wurden der Gebäudekomplex oder Teile von ihm schon immer als Rathaus genutzt? Jedenfalls deutete der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Helge Wittmann, auf besagter 700-Jahrfeier an, dass noch vieles im Dunkeln liegt.
Mühlhausen. Diese Ansicht teilt auch der Mühlhäuser Hobby-Historiker Roland Lange, der im Ergebnis einer fast zweijährigen akribischen Recherche zu der Erkenntnis gelangt: Die Gemäuer gehören zu einer der besterhaltendsten Synagogen
Europas..."
Link zum Artikel siehe oben. |
| |
| September
2010: Beim Rathaus handelt es sich
nicht um die frühere Synagoge |
Artikel von Jürgen Wand in der "Thüringer Allgemeinen" vom 24.
September 2010 (Artikel):
"Das Mühlhäuser Rathaus stand schon immer hier.
War das heutige Mühlhäuser Rathaus schon immer ein Rathaus oder gehörten Gebäudeteile gar mal zu einer der größten Synagogen in Deutschland, wie das der Mühlhäuser Roland Lange mutmaßt - Einen konkreten Beweis oder schriftliche Überlieferungen dafür gibt es nicht. Das älteste Zeugnis ist eine am 6. Mai 1310 ausgefertigte lateinische Urkunde, als der Ritter Heinrich von Mihla gezwungen wurde, sich auf dem Rathaus als Gefangener in Eisen legen zu lassen.
Mühlhausen. Nach Ansicht von Stadtarchivar Dr. Helge Wittmann und von Martin Sünder, Vorsitzender des Geschichtsvereins, erfüllen die Untersuchungsergebnisse des Hobby-Forschers keine wissenschaftlichen Kriterien. Damit solle das Engagement von Roland Lange nicht in Abrede gestellt werden. Er habe auch überall freien Zugang erhalten, um seine Untersuchungen führen zu können. Aber seine These sei trotz der bei vielen als interessant ankommenden Überlegungen durch nichts belegt. Die Geschichtswissenschaft betreibe keine Bauforschung, sondern halte sich an die schriftlichen Quellen..."
Link zum Artikel siehe oben. |
| |
| Januar
2011:
Die Synagoge in Mühlhausen wird kaum als
Synagoge genutzt |
Artikel von Doreen Zander in der "Thüringer Allgemeinen" vom
21. Januar 2011 (Artikel):
"Mühlhausens Synagoge ist fast nur Veranstaltungsort.
"Was macht einen modernen Juden in Thüringen aus?", fragt Wolfgang Nossen, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde mit Sitz in Erfurt. Schwer sei es, zu definieren, wer den Glauben lebe oder sich nur durch Geburt als Jude bezeichne. Genauso schwer ist es deshalb auch, eine Gemeinde aufzubauen und zu
pflegen.
Mühlhausen. Eine von vielen Voraussetzungen für eine jüdische Gemeinde ist eine geweihte Synagoge. Die hat Mühlhausen und nutzt sie auch für kulturelle Veranstaltungen rund um das Judentum. Mit der Anne-Frank-Ausstellung im letzten Jahr wurde auf das dunkelste Kapitel in der modernen Geschichte dieser Religion verwiesen. Im Nationalsozialismus wurden die jüdischen Bürger in Mühlhausen vollkommen aus der Stadt verdrängt, die Synagoge in der Reichspogromnacht zerstört. In der Nachkriegszeit hier wieder eine jüdische Gemeinde aufzubauen gelang nie..."
Link zum Artikel siehe oben. |
| |
| März /
Mai 2010: Ende Mai 2010 werden zehn
"Stolpersteine" in der Stadt verlegt |
Artikel in der
"Thüringischen Allgemeinen" vom 5. März 2010 (Artikel):
"Gunter Demnig verlegt Stolpersteine am 26. Mai in Mühlhausen
Am 26. Mai werden zehn Stolpersteine in der Mühlhäuser Innenstadt verlegt, die an Opfer der Schoah erinnern. Das sagten gestern Linken-Stadtrat Dirk Anhalt und Pfarrer Teja Begrich von der Mühlhäuser Aktionsgruppe.
Mühlhausen. Der Künstler Gunter Demnig wird die "Steine gegen das Vergessen" verlegen. Vorgesehen sind vier für die Familie Abraham am Steinweg 72, zwei für Siegmund und Malli Bachrach am Steinweg 45, zwei für Hertha und Max Scheps in der Johannisstraße 2 sowie einer für Gertrud Heilbrun, Linsenstraße 20, und Sophie Rosenthal, Linsenstraße 26. Sollte es Erinnerungen an diese Personen geben, dann würde sich die Initiativgruppe über Hinweise freuen, sagten Begrich und Anhalt. Dieser ersten Aktion sollen sich weitere anschließen. Ziel ist es, in einigen Jahren aller 59 Opfer aus Mühlhausen zu gedenken. 95 Euro kostet ein Stein, erste Spenden sind bereits eingezahlt worden, weitere aber willkommen, sowohl für den Auftakt am 26. Mai als auch die Zukunft. In Mühlhausen kümmern sich Stadträte der Linken und der Grünen, der christlich-jüdische Arbeitskreis, das evangelische Kirchspiel und der Verein "Miteinander" um die Stolpersteine.
Spendenkonto: Kreiskirchenamt Mühlhausen; Konto 05 52 00 10 40; Sparkasse Unstrut-Hainich; BLZ 820 560 60, Kennwort: Spende Stolpersteine. Kontakt: Teja Begrich, Telefon: (03601) 40 57 15." |
| |
| Januar
2011: Sonderführung durch die
Synagoge am 30. Januar 2011 |
Artikel aus dtoday.de vom 26.
Januar 2011 (Artikel):
"Mit der jüdischen Geschichte beschäftigen. 'Die Mühlhäuser
Synagoge' - Sonderführung am Sonntag
Mühlhausen (red) - Schon das Mühlhäuser Rechtsbuch, einer der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache, dokumentierte um 1220 jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen.
Eine Synagoge findet um 1380 schriftliche Erwähnung. Das heute zu besichtigende Gebäude entstand ab 1840, wurde am 9. November 1938 geschändet und nach 1945 der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen übergeben. Die Bemühungen zur Erhaltung wurden im November 1998 mit der Wiederweihe gekrönt. Synagoge und Gemeindehaus sind für Gottesdienste nutzbar, dienen zurzeit vor allem als Begegnungsstätte mit Ausstellung (inkl. jüdisches Kultgerät) und Bibliothek. Mit der jüdischen Geschichte der Stadt Mühlhausen beschäftigt sich, die am 30.01.2011 von der Tourist-Information Mühlhausen angebotene Sonderführung, die eine Führung der Mühlhäuser Synagoge beinhaltet. Treffpunkt ist 14.00 Uhr an der Tourist-Information, Ratsstraße 20. Um eine Voranmeldung zur Führung wird unter der Rufnummer 03601- 40 47 70 gebeten." |
| |
| Mai
2011: Neue Ausstellung über jüdische
Schicksale aus Mühlhausen |
Artikel von Matthias Schenke in der "Thüringer Allgemeinen" vom
13. Mai 2011 (Artikel):
"Jüdische Schicksale aus Mühlhausen dokumentiert
In der Mühlhäuser Synagoge wurde am Donnerstagabend eine Dokumentation zur "Arisierung" in Thüringen eröffnet. Sie wird von Arbeiten begleitet, in der Tilesius- Gymnasiasten konkrete Fälle aus der Stadt belegen.
Mühlhausen. Seit drei Jahren wandert die Ausstellung "Ausgegrenzt. Ausgeplündert. Ausgelöscht." über die "Arisierung" in Thüringen durch den Freistaat. Mühlhausen, wo sie gestern Abend eröffnet wurde, ist aber eine besondere Station: Zum einen, weil sie in einer Synagoge zu sehen ist. Zum anderen, weil die Forschungsarbeiten von Schülern des Tilesius-Gymnasiums rechtzeitig fertig wurden. In den anderen Städten war das nicht der Fall, lobte Dr. Monika Gibas, die Leiterin der Projektgruppe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena..."
Link zum Artikel siehe oben. |
| |
| Juni
2011: Weitere
"Stolpersteine" werden verlegt |
Artikel in dtoday.de vom 14.
Juni 2011 (Artikel):
"Am 21. Juni ab 9.00 Uhr werden sie verlegt. Weitere Stolpersteine für Mühlhausen
Mühlhausen (mdk) - Das Kunstprojekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer Gedenktafeln aus Messing in das Straßenpflaster einfügt werden.
In Mühlhausen wurden im vergangenen Jahr die ersten Stolpersteine verlegt. Neun weitere werden nun folgen. Begonnen wird am Dienstag, 21. Juni, um 9.00 Uhr Hinter der Harwand 13 (Familie Liebert). Dann geht es zur Johannisstraße 2 (Therese Steinhardt), zur Jüdenstr. 13 (Marie Cohn) und gegen 10.30 Uhr wird man in der Kilianistraße 47 (Familie Stern) sein. Dort wird es ein kleines musikalisches Programm und eine Ansprache geben, da Angehörige der Familie Stern anwesend sein werden. Der neunte Stein wird in der Karl-Marx-Str. 48 (Dr. Siegfried Cohn) verlegt. Wer diese Aktion unterstützen möchte ist herzlich willkommen.
'Sie können sich auch finanziell beteiligen. Ein Stolperstein kostet 95 Euro. Jede Spende ist herzlich willkommen! Einzahlungen bitte an das Kreiskirchenamt Mühlhausen; Konto 05 52 00 10 40; Sparkasse UH: BLZ 820 560 60; Kennwort: Spende Stolpersteine', sagte Pfarrer Teja Begrich, der unter der Telefonnummer 03601 405715 zu erreichen
ist." |
| |
| Oktober
2011: Führung auf den Spuren
der jüdischen Geschichte |
Artikel von Michael Fiegle in
der "Thüringer Allgemeinen" vom 19. Oktober 2011: "An
jüdisches Leben in Mühlhausen erinnert. Ihre Führung ließ sie (sc.
Ute Helbing) in der Synagoge beginnen. Das Haus der ehemaligen jüdischen
Gemeinde in der Jüdenstraße und die dazugehörige Hinterhaussynagoge
sind seit ihrer Instandsetzung 1998 der Gedenkort für jüdisches Leben in
Mühlhausen..."
Link
zum Artikel - auch eingestellt
als pdf-Datei. |
| |
November
2011: Das Mühlhäuser Rathaus war
keine Synagoge -
für Januar 2012 ist im Rathaus eine Ausstellung zu jüdischem Leben im
Mittelalter geplant |
Artikel von Diana Döll in der
"Thüringer Allgemeinen" vom 17. November 2011: "Rathaus
von Mühlhausen war keine Synagoge.
Ist es eine oder ist es keine? Die Frage, ob das Rathaus von Mühlhausen
einst eine Synagoge war, bildete die Grundlage mehrfacher öffentlicher
und privater Diskussionen. Simon Paulus von der Universität Braunschweig
lieferte am Dienstabend mit seinem Vortrag eine wissenschaftliche Antwort
auf offene Fragen..."
Link
zum Artikel - auch eingestellt
als pdf-Datei. |
| |
| Januar
2012: Könnte die Fakultät für
Judaistik an der Universität Erfurt nach Mühlhausen kommen? |
Artikel von Jürgen Wand in der
"Thüringer Allgemeinen" vom 13. Januar 2012: "Politiker
wollen Uni-Fakultät nach Mühlhausen holen. Die Fakultät für
Judaistik, die an der Universität Erfurt eingerichtet werden soll, wollen
SPD-Kreisvorsitzender Walter Pilger und der Juso-Kreischef Oleg Shevchenko
nach Mühlhausen holen..."
Link
zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist
kostenpflichtig) |
| |
| Mai
2013: Weitere Verlegung von
"Stolpersteinen" in der Stadt |
Artikel in der "Thüringer
Allgemeinen" vom Mai 2013: "Bewegende Ehrung für deportierte
jüdische Mühlhäuser Bürger.
Mühlhausen. Unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit sowie in
Anwesenheit von Gästen aus Israel und Uruguay wurden am Samstag zwölf
Stolpersteine für deportierte jüdischer Mühhäuser Bürger
verlegt..."
Link
zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist
kostenpflichtig) |
| |
|
November 2015:
SchülerInnen übernehmen Führung in
der Synagoge |
Artikel von Frank Börner in der
"Thüringer Allgemeinen" vom 6. November 2015: "Schüler wollen künftig
Führungen in der Synagoge übernehmen.
Mühlhausen Mädchen der 'AG offene Synagoge' des evangelischen Schulzentrums
zeigten zur Generalprobe, dass sie das können
Das Schild 'Geschlossen!' hängt an der Tür des Gebäudes in der Jüdenstraße
auf dessen Hinterhof die Synagoge steht. Schüler der 9. bis 11. Klasse des
evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen wollen das ändern und das jüdische
Gotteshaus für Besucher öffnen und eigene Führungen anbieten. Deswegen heißt
ihre Arbeitsgemeinschaft auch 'AG offene Synagoge'. Am gestrigen Donnerstag
zeigten die Schüler erstmals, wie sie sich das vorstellen – zu einer
Generalprobe..."
Link zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist
kostenpflichtig) |
| |
|
Januar 2016:
Rundfunkbeitrag zur jüdischen
Geschichte Mühlhausens und seiner Synagoge |
Artikel von Josefine Janert in
Deutschlandfunk-Kultur vom 3. Januar 2016: "Einstiges jüdisches Leben in
Thüringen - die Synagoge von Mühlhausen..."
Link zum Artikel (eingestellt als pdf-Datei) |
| |
|
August 2016:
Veranstaltungen anlässlich "175
Jahre Synagoge Mühlhausen" |
Artikel von Antje Lauschner in
der "Thüringer Allgemeinen" vom 3. August 2016: "Erinnerung an
Mühlhausens jüdische Geschichte.
Mühlhausen Vor 175 Jahren wurde die Synagoge in der Stadt erstmals
geweiht. Heute wird sie vor allem als Begegnungsstätte genutzt.
Mit Vorträgen, Führungen und Konzerten erinnert die Stadt Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis)
in dieser Woche an die Weihe ihrer Synagoge vor 175 Jahren. Zu den
Veranstaltungen vom morgigen Donnerstag an bis Sonntag werden Vertreter der
Jüdischen Landesgemeinde und der Thüringer Landesregierung sowie Gäste aus
Israel und Nachkommen früherer jüdischer Bürger aus Mühlhausen erwartet..."
Link zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist
kostenpflichtig)
Weiterer Artikel hierzu in "Die Welt" vom 2. August 2016: "Thüringen.
Mühlhäuser Synagoge vor 175 Jahren geweiht. Mühlhausen erinnert an Weihe der
Synagoge vor 175 Jahren.
Mühlhausen (dpa/th) - Mit Vorträgen, Führungen und Konzerten erinnert
Mühlhausen in dieser Woche an die Weihe der Synagoge vor 175 Jahren. Zu den
Veranstaltungen von Donnerstag bis Sonntag werden Vertreter der Jüdischen
Landesgemeinde, der Landesregierung, Gäste aus Israel und Nachkommen
früherer jüdischer Bürger aus Mühlhausen erwartet..."
Link zum Artikel |
| |
| September
2016: Weitere Verlegung von
"Stolpersteinen" - auch für Opfer der "Euthanasie"-Aktion |
Artikel in der "Thüringer
Allgemeinen" vom 7. September 2016: "Weitere zwölf Stolpersteine.
Erstmals soll Opfern von Euthanasie und Widerstand gedacht werden
Mühlhausen. 41 Stolpersteine wurde seit 2010 in Mühlhausen verlegt. Nächste Woche sollen weitere zwölf an zehn verschiedenen Orten hinzukommen.
Erstmals soll mit den Stolpersteinen auch an Widerstandskämpfer wie Walter Schunk und an drei Euthanasie-Opfer erinnert werden.
'Euthanasie gehört zu den dunkelsten Kapiteln der 100-jährigen Geschichte der Nervenheilanstalt Pfafferode, des jetzigen Ökumenischen
Hainich-Klinikums', sagt Teja Begrich. Der Pfarrer der evangelischen Gemeinden Divi Blasii-St. Marien sowie St.Nicolai trägt maßgeblich das Projekt Stolpersteine in der Stadt..."
Anmerkung: für jüdische Opfer wurden im September
"Stolpersteine" verlegt: Bei der Marienkirche 17: Helene Riesmann (1868), deportiert nach Theresienstadt, ermordet 16. Februar 1943;
An der Burg 23: Adolf Weil (1869), deportiert 1942 nach Theresienstadt, ermordet 12. April 1944. Sofie Weil (1882), deportiert 1942 nach Theresienstadt, befreit;
Kilianistraße 9: Therese Stein (1870), ermordet in Theresienstadt 1942; Kiliansgraben 20: Rosa Döge (1881), ermordet in Auschwitz.
Link
zum Artikel (das Lesen des ganzen Artikels ist
kostenpflichtig) |
| |
|
April 2024:
Die "Stolpersteine" werden
gereinigt |
Artikel in "nordthueringen.de"
vom 18. April 2024: "Stolpersteine in Heiligenstadt - Putzen für die
Erinnerung.
Zwölf junge Menschen werden diesen Sonntag in Heiligenstadt Stolpersteine
putzen. Die quadratischen im Boden eingelassenen Messingtafeln sollen an die
Opfer des Nationalsozialismus erinnern, die in Heilbad Heiligenstadt lebten
und wirkten...
'Die evangelische Junge Gemeinde im Eichsfeld macht bei der 72-Aktion der
kath. Kirche mit und hat auch Freunde motivieren können', erzählt
Gemeindepädagogin Alexandra Kunze. Das Anliegen der Jugendlichen ist es,
etwas zu tun, das man als Zeichen der Erinnerungskultur erkennt und sich
gegen antisemitische und rechtsextreme Ansichten positioniert. 'Dafür haben
sie extra ein T-Shirt entworfen', freut sich Alexandra Kunze. Am
Sonntagvormittag trifft man die Aktiven dann in Kleingruppen in
Heiligenstadt. Mit ihren einheitlichen Shirts werden sie gut zu erkennen
sein. In der Mittagspause gibt es für alle ein gemeinsames Pizza-Essen.
Dabei sein wird dann auch Hans Ulrich Fiebelkorn, der Vorsitzende des
Gemeindekirchenrates. Er erzählt die Geschichten der Menschen, für die diese
Steine gesetzt wurden. Stolpersteine, die ab Sonntag in Heiligenstadt frisch
geputzt sind und damit wieder ein bisschen auffälliger an die Opfer und die
Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Hintergrund der 72-Stunden-Aktion des
BDJK: 72 Stunden lang engagieren sich junge Menschen für Andere. Die
Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind
lebensweltorientiert und geben dem Glauben 'Hand und Fuß'.
https://www.bdkj.de/aktionen/72-stunden-aktion."
Link
zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur (kleine Auswahl):
 | Germania Judaica II,2 S. 550-553; III,2 S.
885-893.
|
 | Carsten Liesenberg: Zur Geschichte der Juden in
Mühlhausen und Nordthüringen und die Mühlhäuser Synagoge. Mühlhäuser
Beiträge. Sonderheft 11. 1998.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Muehlhausen Saxony. The
first definite evidence of a Jewish presence in Muehlhausen dates from 1278. The
community, which had a synagogue in 1380 and a cemetery in 1407, suffered from
intermittent persecution, including the Black Death disturbances of 1348-49. The
Jews were finally expelled in 1561.
In 1643, Jewish settlement war renewed. The medieval cemetery was in use up to
1860 and then replaced by a new one. A synagogue was built in the 1840s. Toward
the end of the 19th century, the Jews played an important role in the local
textile industry, constituting at times as much as 30 % of the textile
manufacturers. From as early as 1848, up to 1926, Jews were elected to the city
council. Between 1880 and 1925, the Jewish population of Muehlhausen was about
190. In 1933, when the Nazis came to power, it was 170. Emigration began against
a background of boycotts, attacks, and a show trial on charges of so-calles
racial defilement (Rassenschande). By January 1938, the community
numbered 110. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue and
the cemetery were wrecked while businesses and homes were looted and destroyed.
The community's teacher was shot and two elderly women were beaten up on the
street, dying shorty afterwards either from their injuries of by suicide. Some
20-30 Jews were arrested and taken to the Buchenwald concentration camp. In
1942, 34 of the remaining Jews were deported to the east. In October, only 19
Jews were left in the city, most of them probably protexted by marriage to
non-Jew. In all, at least 59 Jews from Muehlhausen perished under Nazi rule,
including several who sought refuge in other cities of neighboring countries.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|