|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht "Synagogen im Kreis Marburg-Biedenkopf"
Breidenbach (Kreis
Marburg-Biedenkopf)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Breidenbach
bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/39. Ihre Entstehung geht in die
Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück, wobei auf Grund der lange geringen Zahl
der jüdischen Familien am Ort erst 1826 eine selbständige jüdische
Religionsgemeinde gegründet werden konnte. Bereits am Ende des 16.
Jahrhunderts lebten jedoch Juden am Ort. Sie verdienten ihren
Lebensunterhalt zunächst überwiegend durch Geldverleih und durch Handel mit
Fellen und Häuten. Enge Beziehungen gab es zu den in Gladenbach
und Laasphe lebenden Juden.
Im 18. Jahrhundert stieg die Zahl der jüdischen Familien langsam an. 1728
waren sechs jüdische Haushaltungen am Ort (zwei Ehepaare mit je vier Kindern,
ein Ehepaar mit zwei Kindern, ein Witwer mit fünf Kinder, ein Witwer mit zwei
Kindern und eine Witwe mit zwei Kindern). 1779 werden folgende jüdische
Männer genannt: Aaron Löw, Joseph Gumbel, Salmo Gumbel, Joseph Moses, Aaron
Salmo, Löw Hirsch sowie Ascher Moses.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1800 35 jüdische Einwohner (11 % der Gesamteinwohnerschaft), 1810
39, 1831 73, 1858 104 (14 % von insgesamt 743 Einwohnern), 1871 88.
Bei der Wahl fester Familiennamen wählten die Familien 1808 die
folgenden Namen: Löwenstein, Sonnenborn, Stern (zweimal), Berg, Sundheim,
Edinger und Buchholz. Nach Bildung einer selbständigen jüdischen Gemeinde 1826
war Isaak Löwenstein der erste Vorsteher. 1831 waren acht Häuser im Ort von jüdischen
Familien bewohnt. 1834 hießen die wahlberechtigten Juden Daniel Herzberg, Bär
Stern, Feibel Sonneborn, Jonas Sundheim (Vorsteher), Isaak Löwenstein
(Vorsteher), Isaak Stern, Moses Sonneborn, Joseph Sonneborn (Rechner), Salomon
Sundheim, Hirsch Gerson. 1835 lebten die jüdischen Familien überwiegend vom
Viehhandel mit Rindvieh und kleinem Vieh sowie als Metzger ohne ständigen
Laden, doch gab es auch mehrere Spezereikrämer, einen Mehlhändler und Brotverkäufer,
mehrere Baumwollzeughändler sowie einen Schuhmacher.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule,
ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der
zugleich als Vorbeter und Schochet fungierte (vgl. Ausschreibungstexte der
Stelle unten). Unter den Lehrern sind bekannt: Salomon Levi (um 1825), David
Stern (um 1839), Isaak Wechsler (1850-1853), danach für teilweise nur kurze
Zeit Abraham Marx, Ferdinand Salomon, Lehrer Nußbaum, Benjamin Heidingsfelder,
Levison. Die Gemeinde gehörte bis 1872 zum Rabbinatsbezirk Gießen, danach zum
Rabbinatsbezirk Oberhessen mit Sitz in Marburg.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Theodor Stern (geb.
17.11.1887 in Breidenbach, gef. 26.9.1914). Außerdem ist gefallen: Max Stern
(geb. 18.2.1894 in Breidenbach, vor 1914 in Gießen wohnhaft, gef. 18.10.1915).
Um 1924, als noch 12 Gemeindeglieder gezählt wurden (1,1 % von insgesamt
etwa 1.100 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Heinemann (Heymann) Stern
und Leopold Roth. 1927 gab es noch zwei jüdische Händler am Ort, neben dem
genannten Leopold Roth noch Max Gunsenhäuser.
Nach 1933 lebten zunächst weiterhin die Familien Stern, Gunsenhäuser
und Roth in Breidenbach. Das damals letzte am Ort geborene jüdische Kind war
Sonja Roth (geb. 1. Juli 1933). In den folgenden Jahren waren auch
die Breidenbacher jüdischen Familien
von den Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien betroffen. Als erste verließ Guste Roth 1933 Breidenbach und
emigrierte über Luxemburg in die USA. Beim Novemberpogrom 1938 wurden Max
Gunsenhäuser und Hermann Roth verhaftet und in das KZ Buchenwald verschleppt.
Erst vier Wochen später wurden sie wieder freigelassen. Im Februar 1938
verließen die Familien Breidenbach und emigrierten in die USA. Am Ort
blieb nur die in "Mischehe" lebende Hermine Schauß zurück, die
jedoch 1942 nach Auschwitz deportiert und dort 1943 ermordet wurde.
Von den in Breidenbach geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hedwig E. Beifus geb.
Stern (1888), Bertha Grüneberg geb. Stern (1887), Lily Grünewald geb. Stern
(1899), Leo Herzberg (1890), Martha Katz geb. Stern (1891), Hermine Schauß geb.
Herzberg (1886), Sara Schuster geb. Wallach (1875), Isidor Sonneborn (1880),
Herz Stern (1858), Julius Stern (1890), Jenny Vogel geb. Sonneborn (1881).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1893
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1870:
"Die Lehrerstelle der Religionsgemeinde zu Breidenbach,
Regierungsbezirk Wiesbaden, steht seit einigen Wochen offen, mit einem
jährlichen Gehalt von 200 bis 230 Thaler, freier Wohnung, Heizung und
Reinigung; bei Vertragsabschluss werden sämtliche Reisekosten vergütet.
Bewerber wollen sich gefälligst wenden an den Vorstand: Joseph Stern".
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1870:
"Die Lehrerstelle der Religionsgemeinde zu Breidenbach,
Regierungsbezirk Wiesbaden, steht seit einigen Wochen offen, mit einem
jährlichen Gehalt von 200 bis 230 Thaler, freier Wohnung, Heizung und
Reinigung; bei Vertragsabschluss werden sämtliche Reisekosten vergütet.
Bewerber wollen sich gefälligst wenden an den Vorstand: Joseph Stern". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1871:
"Die hiesige Gemeinde wünscht ihre erledigte Lehrer- und
Kantorstelle wieder zu besetzen. Fixer Gehalt neben freier Wohnung und
Heizung 200 bis 220 Thaler. Lusttragende Bewerber beliebten sich
baldmöglichst unter Einsendung ihrer Zeugnisse bei dem unterzeichneten
Vorstand zu melden. Breidenbach, Regierungsbezirk Wiesbaden. J. Stern." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1871:
"Die hiesige Gemeinde wünscht ihre erledigte Lehrer- und
Kantorstelle wieder zu besetzen. Fixer Gehalt neben freier Wohnung und
Heizung 200 bis 220 Thaler. Lusttragende Bewerber beliebten sich
baldmöglichst unter Einsendung ihrer Zeugnisse bei dem unterzeichneten
Vorstand zu melden. Breidenbach, Regierungsbezirk Wiesbaden. J. Stern." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1871:
"Bekanntmachung. In der Gemeinde Breidenbach
(Regierungs-Bezirk Wiesbaden) ist die Stelle eines Lehrers und Kantors
vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Indem ich bemerke, dass mit
dieser Stelle ein jährlicher Gehalt von 200 bis 220 Thalern, freier
Wohnung nebst freiem Brennholz und auch Nebenverdiensten verbunden ist,
werden konkurrenzfähige Bewerber aufgefordert, ihre Gesuche und Anschluss
der erforderlichen Zeugnisse alsbald bei mir einzureichen bei
Vertragsabschluss werden Reisekosten vergütet. Breidenbach
(Regierungsbezirk Wiesbaden), den 12. November 1871. Der Vorstand.
Joseph Stern." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1871:
"Bekanntmachung. In der Gemeinde Breidenbach
(Regierungs-Bezirk Wiesbaden) ist die Stelle eines Lehrers und Kantors
vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Indem ich bemerke, dass mit
dieser Stelle ein jährlicher Gehalt von 200 bis 220 Thalern, freier
Wohnung nebst freiem Brennholz und auch Nebenverdiensten verbunden ist,
werden konkurrenzfähige Bewerber aufgefordert, ihre Gesuche und Anschluss
der erforderlichen Zeugnisse alsbald bei mir einzureichen bei
Vertragsabschluss werden Reisekosten vergütet. Breidenbach
(Regierungsbezirk Wiesbaden), den 12. November 1871. Der Vorstand.
Joseph Stern." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:
"In der israelitischen Gemeinde Breidenbach bei Biedenkopf ist die
mit einem Fixum von 700 Mark, freier Wohnung und Feuerung dotierte Stelle
eines Kantors und Religionslehrers von Mitte August ab zu besetzen.
Unverheiratete Bewerber wollen baldmöglichst ihre Zeugnisse dem
Unterzeichneten einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:
"In der israelitischen Gemeinde Breidenbach bei Biedenkopf ist die
mit einem Fixum von 700 Mark, freier Wohnung und Feuerung dotierte Stelle
eines Kantors und Religionslehrers von Mitte August ab zu besetzen.
Unverheiratete Bewerber wollen baldmöglichst ihre Zeugnisse dem
Unterzeichneten einsenden.
Marburg, 1. Juli 1884. Der Provinzial-Rabbiner. Dr. Munk." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1891:
"Die hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle mit einem Gehalt von
Mark 750, bei freier Wohnung mit Garten und freiem Holz, ist zu besetzen.
Reflektierende belieben sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse an den
Unterzeichneten zu wenden. Breidenbach bei Biedenkopf, 1. März 1891. Der
Vorstand: F. Sonneborn I." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1891:
"Die hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle mit einem Gehalt von
Mark 750, bei freier Wohnung mit Garten und freiem Holz, ist zu besetzen.
Reflektierende belieben sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse an den
Unterzeichneten zu wenden. Breidenbach bei Biedenkopf, 1. März 1891. Der
Vorstand: F. Sonneborn I." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893:
"Die hiesige Religionslehrer- und Vorbeter-Stelle ist vakant. Das
Gehalt beträgt 750 Mark bei freier Wohnung und Heizung nebst
Nebenverdiensten. Unser bisheriger Lehrer S. Sulzbacher ist gerne
bereit, nähere Auskunft zu erteilen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893:
"Die hiesige Religionslehrer- und Vorbeter-Stelle ist vakant. Das
Gehalt beträgt 750 Mark bei freier Wohnung und Heizung nebst
Nebenverdiensten. Unser bisheriger Lehrer S. Sulzbacher ist gerne
bereit, nähere Auskunft zu erteilen.
Breidenbach (Kreis Biedenkopf.). Der Vorstand: L. Stern." |
| |
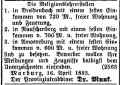 Anzeige in
der Zeitschrift „Der Israelit“ vom 20. April 1893: „Die
Religionslehrerstellen 1. in Breidenbach mit einem festen Einkommen
von 720 Mark, freier Wohnung und Feuerung, 2. in Rauschenberg mit einem
festen Einkommen von 700 Mark und freier Wohnung, 3. in Amöneburg
mit einem festen Einkommen von 600 Mark und freier Wohnung sind zu
besetzen. Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse baldigst dem
Unterzeichneten einsenden. Marburg, 16. April 1893. Der Provinzialrabbiner
Dr. Munk.“ Anzeige in
der Zeitschrift „Der Israelit“ vom 20. April 1893: „Die
Religionslehrerstellen 1. in Breidenbach mit einem festen Einkommen
von 720 Mark, freier Wohnung und Feuerung, 2. in Rauschenberg mit einem
festen Einkommen von 700 Mark und freier Wohnung, 3. in Amöneburg
mit einem festen Einkommen von 600 Mark und freier Wohnung sind zu
besetzen. Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse baldigst dem
Unterzeichneten einsenden. Marburg, 16. April 1893. Der Provinzialrabbiner
Dr. Munk.“ |
| |
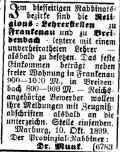 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1899:
"Im diesseitigen Rabbinatsbezirke sind die Religions-Lehrerstellen
zu Frankenau und zu Breidenbach - letztere mit einem
unverheirateten Lehrer - alsbald zu besetzen. Das feste Einkommen beträgt
neben freier Wohnung in Frankenau 900-1000 Mark, in Breidenbach 800-900
Mark. - Reichsangehörige Bewerber wollen ihre Meldungen mit
Zeugnisabschriften alsbald an die unterzeichnete Stelle einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1899:
"Im diesseitigen Rabbinatsbezirke sind die Religions-Lehrerstellen
zu Frankenau und zu Breidenbach - letztere mit einem
unverheirateten Lehrer - alsbald zu besetzen. Das feste Einkommen beträgt
neben freier Wohnung in Frankenau 900-1000 Mark, in Breidenbach 800-900
Mark. - Reichsangehörige Bewerber wollen ihre Meldungen mit
Zeugnisabschriften alsbald an die unterzeichnete Stelle einsenden.
Marburg, 10. Oktober 1899. Der Provinzial-Rabbiner: Dr. Munk." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Antijüdische Ausschreitungen im Revolutionsjahr 1848
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1848:
"Kassel, 2. Mai (1848). Die Exzesse gegen Personen und
Eigentum in den Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und
Juden, nehmen auf eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar,
Melsungen, Rothenburg und
Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren
geretteten Habseligkeiten hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine
Anzahl der Exzedenten gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal
Zeit, gegen diese Übertäter, deren Absicht lediglich auf Plünderung und
Raub gerichtet ist, energisch einzuschreiten und die Gesetze wieder zu
Ansehen zu bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in
Haft zu nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme
hat deren schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenburg ein
Advokat und ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbsbetriebe durch die
Juden beengt fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und
Nachsicht wäre hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1848:
"Kassel, 2. Mai (1848). Die Exzesse gegen Personen und
Eigentum in den Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und
Juden, nehmen auf eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar,
Melsungen, Rothenburg und
Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren
geretteten Habseligkeiten hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine
Anzahl der Exzedenten gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal
Zeit, gegen diese Übertäter, deren Absicht lediglich auf Plünderung und
Raub gerichtet ist, energisch einzuschreiten und die Gesetze wieder zu
Ansehen zu bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in
Haft zu nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme
hat deren schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenburg ein
Advokat und ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbsbetriebe durch die
Juden beengt fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und
Nachsicht wäre hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." |
Berichte zu einzelnen Personen / Familien aus der Gemeinde
Über die Geschichte von Angehörigen der Familien
Sonneborn und Stern (Quelle: Arnsberg S. 91-92; noch gründlicher
recherchiert durch Runzheimer Bd. I S. 67-68, von hier wird das Nachstehende
großenteils zitiert)
Gegen Ende der 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts
wanderte Henry Sonneborn, ein Sohn des
Breidenbacher Moses Sonneborn nach Baltimore/Maryland aus. Er gründete
dort in den 70er-Jahren eine Fabrik für Herrenmoden, die später bis zu
4.000 Arbeiter beschäftigte und zu den größten im Lande zählte. Der
Staat Maryland hatte nicht nur 'Wachset in Vielfalt' auf sein
Wappen geschrieben, er war auch einer der ersten, die diese Vielfalt auf
die Religionen bezog und volle Freiheit gewährte.
Josef und Leo Stern, Söhne von Jakob Stern und Reichel geb.
Baumeister , ließen sich Anfang der 80er-Jahre in Köln nieder. Sie
begründeten die 'Rheinische Vaseline, Öl- und Fettfabrik Gebr. Stern',
die, nachdem Isaak (Jacques) Sonneborn (ein Sohn von Levi
Sonneborn, s.u., der in Biedenkopf die Realschule besucht hatte), dem
Unternehmen beigetreten war, in die Handelsgesellschaft 'Ölwerke Stern -
Sonneborn AG', kurz OSSAG, umgewandelt wurde und Zweigstellen in Hamburg,
London, Paris und Genua errichtete. 1925 wurde die Gesellschaft an die
Shell-Gruppe verkauft.
Levi Sonneborn, 1864 Prokurist in der
Viehhandelsfirma seines Vaters Joseph Sonneborn, hatte viele Kinder, von
denen die meisten Deutschland verließen. Das führte, obwohl Levi mit
seiner Familie 1891 nach Marburg gezogen war - zu einem ständigen Kontakt
zwischen Breidenbach und Übersee, zumal die zweite Tochter Nanni in
Breidenbach selbst verheiratet war (sie starb schon mit 28 Jahren).
Die älteste Tochter Hilda heiratete nach Zwingenberg und die
Tochter Auguste ging nach Baltimore, wo sie den Witwer Henry
Sonneborn heiratete. Die jüngste Tochter Bertha (geb. 1870)
heiratete in die Schweiz. Sie kam 1908 nach Marburg, emigrierte 1933 in
die Schweiz und ging von dort in die USA.
Der bereits oben genannte Sohn Levis Isaak Sonneborn (geb. 1863),
der die Realschule in Biedenkopf besucht hatte, trat in die Rheinische
Vaseline- und Fettfabrik ein und ging später ebenfalls in die USA. Der
Sohn Siegmund Sonneborn (1872-1940) folgte 1889 seiner Schwester
Auguste nach Baltimore, nachdem er die Realschule in Marburg besucht und
eine Lehre bei einem Großhändler in Weilburg absolviert hatte. Er trat
zunächst in das Herrenausstattungsgeschäft seines Schwagers in Baltimore
ein. Der Sohn Dr. Ferdinand Sonneborn (1874-1953) erhielt seine
Ausbildung bei der OSSAG, studierte Chemie und ging ebenfalls nach
Baltimore. Dort gründete er zusammen mit seinem Bruder Siegmund 1903 die
Firma L.(=Levi) Sonneborn Söhne AG, die sich mit der Herstellung von
Petroleumprodukten befasste. Die Firma betreibt mehrere Raffinieren und
Zweigstellen in USA und Kanada und nimmt heute eine führende Position
ein. Der Sohn Joseph Sonneborn (1877-1907) besuchte die Realschule
in Biedenkopf und stierte Literatur und Sprachen. Er starb in jungen
Jahren an den Spätfolgen eines Unfalls. Der jüngste Sohn Samuel
Sonneborn (1881-1968) ging nach der Schule nach Basel, Paris und Oslo
und erlernt in verschiedenen Betrieben die Seifenherstellung. In Marburg
gründete er eine Fabrik für Seifen und chemische Spezialitäten. 1933
verließ er mit Frau Rösel und seinen Kindern Kurt (geb. 1918) und Lotte
geb. 1921) Deutschland und richtete in Luxemburg eine weitere Fabrik für
Seifen und Seifenprodukte ein. Das Betriebsvermögen wurde aus Deutschland
transferiert, der sonstige Besitz in Marburg verkauft. Wenige Tage vor
Ausbruch des zweiten Weltkrieges fuhr er nach England und reiste von dort
1942 in die USA. |
 Link zu www.sonneborn.com
Link zu www.sonneborn.com |
| Stammbaum
der Familie Sonneborn - Breidenbach - Seite von Norbert Nossek. |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betsaal in einem der jüdischen Häuser
vorhanden. 1770 war "die Judenschul" in dem aus zwei Stockwerken
bestehenden Wohnhaus des Löw Aron. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in einer früheren Brauerei
eine Synagoge eingerichtet. Noch vor 1837 (möglicherweise bereits 1828
oder erst zwischen 1831 und 1838) wurde ein Synagogenneubau
erstellt. Wie lange nach dem Rückgang der Zahl der jüdischen Einwohner im
20. Jahrhundert in dem Gebäude Gottesdienste abgehalten werden konnten, ist
nicht bekannt. Nach Angaben bei Arnsberg s. Lit. Bilder S. 30 fanden bis 1938
Gottesdienste statt, vermutlich jedoch nur an den Feiertagen.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Synagogengebäude nicht zerstört, da
es inzwischen der bürgerlichen Gemeinde gehörte. Das Gebäude blieb auch nach
1945 erhalten, wurde als Wohnhaus genutzt, jedoch 1969 zur Erweiterung
der Bundesstraße abgebrochen. Anstelle der Synagoge wurde ein Wohnhaus
(mit Apotheke im Erdgeschoss) erbaut (Perf-Apotheke,
Hauptstraße 47-49).
Adresse/Standort der Synagoge: Hauptstrasse
49
Fotos
(Quelle: abgebildet in Arnsberg s. Lit. S. 30; Altaras
1988 S. 102; Runzheimer I S. 64, dort mit Quelle: Archiv des Hinterländer
Geschichtsvereins).
Das Synagogengebäude
(in
den 1960er-Jahren) |
 |
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 90-92. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 30. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 102. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 84. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirk Gießen und Kassel. 1995 S. 146. |
 |  Jürgen
Runzheimer: Abgemeldet zur Auswanderung. Die Geschichte der Juden im
ehemaligen Landkreis Biedenkopf. Bd. 1 Biedenkopf 1992. Bd. II 1999
(Beiträge zur Geschichte des Hinterlandes Bd. III und Bd. VII.
Hinterländer Geschichtsverein e.V.). Jürgen
Runzheimer: Abgemeldet zur Auswanderung. Die Geschichte der Juden im
ehemaligen Landkreis Biedenkopf. Bd. 1 Biedenkopf 1992. Bd. II 1999
(Beiträge zur Geschichte des Hinterlandes Bd. III und Bd. VII.
Hinterländer Geschichtsverein e.V.).
|
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|