|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Hessen"
Zur Übersicht "Jüdische
Friedhöfe im Stadtkreis Wiesbaden"
Wiesbaden (Landeshauptstadt
von Hessen)
Jüdische Friedhöfe
Bitte besuchen Sie auch die Website zum alten
jüdischen Friedhof:
https://juedische-geschichte-wiesbaden.de/
Übersicht:
Zur Geschichte der Friedhöfe
Der alte jüdische Friedhof (1747-1890)
Die Toten der jüdischen Gemeinde
Wiesbadens wurden bis 1747 auf dem alten Friedhof in Wehen
beigesetzt. In diesem Jahr konnte ein eigener Friedhof in Wiesbaden "Auf
dem Kuhberg" (heute: "Schöne Aussicht") angelegt
werden. Dieser alte jüdische Friedhof wurde 1779 und 1850 erweitert und bis 1890 belegt; die letzte
Beisetzung in einem Familiengrab erfolgte 1929. Die Friedhofsfläche umfasst
46,93 ar. Es sind nach der 1987 erstellten Dokumentation der "Kommission
für die Geschichte der Juden in Hessen" (siehe unten) 583 Grabsteine aus
der Belegzeit von 1750 bis 1924 vorhanden. Viele der früher schlichten
Grabsteine aus Sandstein sind inzwischen verwittert, zerbrochen, oft
unleserlich. Die neueren Steine des 19. Jahrhunderts sind besser erhalten,
etliche allerdings (gewaltsam?) umgestürzt. Heute wird der Friedhof gepflegt;
die Steine werden nach und nach wieder aufgerichtet.
Während der Zeit des Bestehens des alten jüdischen Friedhofes bestand ein
Friedhofsverband mit den umliegenden Gemeinden Biebrich,
Bierstadt und Schierstein.
Als der alte Friedhof geschlossen wurde, wurde der Friedhofsverband aufgelöst.
Die jüdischen Gemeinden Biebrich, Bierstadt und Schierstein legten damals ihre
eigenen Friedhöfe an.
Hinweis auf eine Dokumentation des alten Friedhofes
| Hinweis: Nach dem Verzeichnis der
durch die "Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen"
bearbeiteten hessischen Friedhöfe ergibt sich für den alten
Friedhof in Wiesbaden die Zahl von 583
vorhandenen Grabsteinen aus der festgestellten Belegzeit
von 1750 bis 1924. Siehe landesgeschichtliches
Informationssystem Hessen - Kommission für die Geschichte der Juden in
Hessen und Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde in Marburg:
https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/current/30/sn/jfh?q=Wiesbaden |
Aus der Geschichte des alten jüdischen Friedhofes
Diskussion in der Gemeinde um die Art der Beisetzung
eines Selbstmörders (1853)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 31. Januar 1853: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 31. Januar 1853:
Der Artikel ist noch nicht abgeschrieben; zum Lesen bitte
Textabbildungen anklicken |
 |
 |
Der alte Friedhof wird geschlossen, ein neuer angelegt
(1890)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. August
1890: "Wiesbaden, 10. August (1890). Der auf der 'schönen
Aussicht' gelegene Friedhof der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde,
welcher seit etwa hundertundfünfzig Jahren - vorher begrub die Gemeinde
ihre Toten auf dem israelitischen Friedhofe in Wehen - im Gebrauch ist,
wird, der Anordnung des Ministeriums gemäß, am Ende dieses Jahres
geschlossen werden. Denn da in Folge der Erweiterung, welche die so
mächtig emporblühende Stadt Wiesbaden auch nach dieser Seite hin
genommen, der Friedhof längst von Villen und Landhäusern umgeben ist, so
war es leicht vorauszusehen, dass die höchste Behörde dem Drängen der
angrenzenden Bewohner nach Verlegung des Friedhofes Folge geben würde.
Lange Zeit beschäftigte die Frage wegen Akquirierung eines Terrains zur
Anlegung eines neuen Friedhofs die Vertreter der Gemeinde aufs Ernsteste.
Nach manchen missglückten Versuchen fand dieselbe in allseitig
befriedigender Weise ihre Lösung. Denn die Liberalität der städtischen
Behörden gewährte der Gemeinde für diesen Zweck ein an den
Kommunalfriedhof grenzendes Stück Land, das einige Morgen groß, dem
Bedürfnisse der Gemeinde auf lange hinaus entsprechen dürfte. Wenn auch
die Kommunalbehörden, die an dem Grundsatze festhalten, kein städtisches
Eigentum zu veräußern, sich das ideelle Besitzrecht vorbehalten, so ist
doch die Unantastbarkeit der Gräber vertragsmäßig für alle Zeit
gesichert. - Eine Kalamität ist aus diesem Wechsel des Friedhofs für
einige benachbarte Gemeinden, die bisher mit der hiesigen einen Friedhofsverband
bildeten, erwachsen, da unter den veränderten Verhältnissen diese
Gemeinschaft nicht länger erhalten werden konnte. So sind denn diese
Gemeinden zur Anlegung eigener Friedhöfe genötigt. Zwei dieser Gemeinden
(Biebrich und Schierstein)
haben sich hierbei gleichfalls eines freundlichen Entgegenkommens seitens
der lokalen Behörden, die ihnen das erforderliche Terrain kostenlos
gewährten, zu erfreuen gehabt, während die dritte Gemeinde (Bierstadt)
ein Stück Land zur Anlegung eines Friedhofs ankaufen
musste." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. August
1890: "Wiesbaden, 10. August (1890). Der auf der 'schönen
Aussicht' gelegene Friedhof der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde,
welcher seit etwa hundertundfünfzig Jahren - vorher begrub die Gemeinde
ihre Toten auf dem israelitischen Friedhofe in Wehen - im Gebrauch ist,
wird, der Anordnung des Ministeriums gemäß, am Ende dieses Jahres
geschlossen werden. Denn da in Folge der Erweiterung, welche die so
mächtig emporblühende Stadt Wiesbaden auch nach dieser Seite hin
genommen, der Friedhof längst von Villen und Landhäusern umgeben ist, so
war es leicht vorauszusehen, dass die höchste Behörde dem Drängen der
angrenzenden Bewohner nach Verlegung des Friedhofes Folge geben würde.
Lange Zeit beschäftigte die Frage wegen Akquirierung eines Terrains zur
Anlegung eines neuen Friedhofs die Vertreter der Gemeinde aufs Ernsteste.
Nach manchen missglückten Versuchen fand dieselbe in allseitig
befriedigender Weise ihre Lösung. Denn die Liberalität der städtischen
Behörden gewährte der Gemeinde für diesen Zweck ein an den
Kommunalfriedhof grenzendes Stück Land, das einige Morgen groß, dem
Bedürfnisse der Gemeinde auf lange hinaus entsprechen dürfte. Wenn auch
die Kommunalbehörden, die an dem Grundsatze festhalten, kein städtisches
Eigentum zu veräußern, sich das ideelle Besitzrecht vorbehalten, so ist
doch die Unantastbarkeit der Gräber vertragsmäßig für alle Zeit
gesichert. - Eine Kalamität ist aus diesem Wechsel des Friedhofs für
einige benachbarte Gemeinden, die bisher mit der hiesigen einen Friedhofsverband
bildeten, erwachsen, da unter den veränderten Verhältnissen diese
Gemeinschaft nicht länger erhalten werden konnte. So sind denn diese
Gemeinden zur Anlegung eigener Friedhöfe genötigt. Zwei dieser Gemeinden
(Biebrich und Schierstein)
haben sich hierbei gleichfalls eines freundlichen Entgegenkommens seitens
der lokalen Behörden, die ihnen das erforderliche Terrain kostenlos
gewährten, zu erfreuen gehabt, während die dritte Gemeinde (Bierstadt)
ein Stück Land zur Anlegung eines Friedhofs ankaufen
musste." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. September 1890: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. September 1890:
Ein weitgehend identischer Artikel erschien in der Zeitschrift
"Der Israelit" |
Der orthodoxe Friedhof (1877-1942)
Die orthodoxe, "Alt-Israelitische
Kultusgemeinde" hatte, nachdem durch den Austritt ihrer Mitglieder aus der
Israelitischen Kultusgemeinde eine Benutzung des Friedhofes der Kultusgemeinde
nicht mehr möglich war, gleichfalls einen Friedhof. Er konnte 1877
angelegt und - verbunden mit der Beisetzung von Amalie Hirsch - am im November
1877 durch Rabbiner Dr. Cahn eingeweiht werden. Dieser Friedhof enthält 372 Gräber
(Dokumentation um 1970) und umfasst eine
Fläche von 26,94 ar. Unter den Beigesetzten sind auch zwei junge Töchter
des Rabbiners Dr. Cahn sowie seiner Frau Sara geb. Dukas (1851-1919; stammte wie
er aus Sulzburg). 1936 wurde unter großer Anteilnahme auch Rabbiner Dr.
Leo Kahn auf dem Friedhof beigesetzt. Die letzten Toten wurden 1942 hier
beerdigt.
Insgesamt sind etwa 300 Grabsteine vorhanden, viele waren für Kurgäste, die
nur vorübergehend in Wiesbaden weilten. Einer der berühmtesten Kurgäste war Wolf
Vishniac (Wischnjak), der Großvater von Roman Vishniac (1897-1990, vgl. Wikipedia-Artikel
"Roman Vishniac"), der seinen Sohn Wolf V. Vishniac (1922-1973,
vgl. Wikipedia-Artikel
Wolf V. Vishniac") wiederum nach dem Großvater benannte.
Aus der Geschichte
des orthodoxen Friedhofes
Nach dem Austritt aus der jüdischen Gemeinde sind die
orthodox Gesinnten auf der Suche nach einem Grundstück für einen eigenen
Friedhof (1876)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Oktober 1876: "Wiesbaden, 12. Oktober
(1876). Dem 'Frankfurter Journal' wird von hier geschrieben: Das Gesetz
über den Austritt aus einer Judengemeinde wird auch hier seine Wirkung
äußern, indem die sogenannte 'Israelitische Religionsgesellschaft', aus
Orthodoxen bestehend, in der nächsten Zeit ihren Austritt in Masse
erklären wird, indem sie sich darüber vergewissert hat, dass, solange
sie nicht in den Besitz eines neuen jüdischen (konfessionellen)
Friedhofes gekommen, ihre Toten auf dem seitherigen jüdischen Friedhofe
beerdigt werden müssen. Ein beim hiesigen Gemeinderat eingereichtes
Gesuch um käufliche Abtretung eines geeigneten Platzes zur Einrichtung
eines Friedhofes war mit dem Hinweis darauf angewiesen worden, dass es
keinem Anstande unterliege, die verstorbenen Orthodoxen auf dem
allgemeinen städtischen Friedhofe zu bestatten; da dies aber gegen die
jüdische Lehre verstößt, so verbleibt es vorerst bei der ferneren
Benutzung des alten jüdischen Friedhofs, und bei der zu erwartenden
Opposition des Vorstandes der Synagogengemeinde würde polizeilicher Zwang
eintreten müssen. In diesem Sinne ist nämlich eine Deputation der
hiesigen orthodoxen Israeliten von dem zur außerordentlichen
evangelischen Landessynode jüngst hier verweilenden Direktor im
Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zu Berlin, Dr. Förster,
beschieden worden, und danach sind, wie wir hören, auch die hiesigen
Lokalbehörden bereit, gegebenen Falles zu verfahren, sofern es feststeht,
dass es wirklich jüdisches Gesetz ist, Juden nur auf besonderen
Friedhöfen zu begraben; hierüber sind ernstliche Erhebungen im Gange.'
(Dass dies wirklich Gesetz ist, steht außer Zweifeln; wir werden diese
Frage nächstens ausführlich besprechen. Die Redaktion des
'Israelit')." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Oktober 1876: "Wiesbaden, 12. Oktober
(1876). Dem 'Frankfurter Journal' wird von hier geschrieben: Das Gesetz
über den Austritt aus einer Judengemeinde wird auch hier seine Wirkung
äußern, indem die sogenannte 'Israelitische Religionsgesellschaft', aus
Orthodoxen bestehend, in der nächsten Zeit ihren Austritt in Masse
erklären wird, indem sie sich darüber vergewissert hat, dass, solange
sie nicht in den Besitz eines neuen jüdischen (konfessionellen)
Friedhofes gekommen, ihre Toten auf dem seitherigen jüdischen Friedhofe
beerdigt werden müssen. Ein beim hiesigen Gemeinderat eingereichtes
Gesuch um käufliche Abtretung eines geeigneten Platzes zur Einrichtung
eines Friedhofes war mit dem Hinweis darauf angewiesen worden, dass es
keinem Anstande unterliege, die verstorbenen Orthodoxen auf dem
allgemeinen städtischen Friedhofe zu bestatten; da dies aber gegen die
jüdische Lehre verstößt, so verbleibt es vorerst bei der ferneren
Benutzung des alten jüdischen Friedhofs, und bei der zu erwartenden
Opposition des Vorstandes der Synagogengemeinde würde polizeilicher Zwang
eintreten müssen. In diesem Sinne ist nämlich eine Deputation der
hiesigen orthodoxen Israeliten von dem zur außerordentlichen
evangelischen Landessynode jüngst hier verweilenden Direktor im
Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zu Berlin, Dr. Förster,
beschieden worden, und danach sind, wie wir hören, auch die hiesigen
Lokalbehörden bereit, gegebenen Falles zu verfahren, sofern es feststeht,
dass es wirklich jüdisches Gesetz ist, Juden nur auf besonderen
Friedhöfen zu begraben; hierüber sind ernstliche Erhebungen im Gange.'
(Dass dies wirklich Gesetz ist, steht außer Zweifeln; wir werden diese
Frage nächstens ausführlich besprechen. Die Redaktion des
'Israelit')." |
Gemeinderatsbeschluss für die Anlegung eines
orthodoxen jüdischen Friedhofes (1876)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Dezember 1876: "Wiesbaden, 12. Dezember
(1876). Auf das Gesuch der israelitischen Religionsgesellschaft hatte der
Gemeinderat beschlossen, derselben einen Teil des städtischen
Grundstücks beim neuen Friedhof, und zwar den nach der Leichtweishöhle
hin gelegenen, käuflich abzutreten. Behufs Feststellung des Wertes des Areals
war das Gesuch an den Herrn Oberförster und das Feldgericht abgegeben
worden. Ersterer rät davon ab, das in Aussicht genommene Areal zum
Friedhof zu bestimmen, weil die Fläche eine stark nach dem Nerotal hin
abfallende Bergwand bilde und zur zum kleinsten Teile als Friedhof
angelegt werden könnte und weil überdies die kahle Totenhofsfläche das
hübsche landschaftliche Bild der Gegend zerstören würde. Der Herr
Oberförster empfiehlt, eine gleich große Fläche in demselben
städtischen Walddistrikte Höllkund, aber oben an der zweiten, von der
Platterstraße nach den Wiesen führenden Schneise gelegen, zu genanntem
Zwecke abzugeben; der Wert des dortigen Grund und Bodens veranschlagt die
Aufsichtsbehörde, vorbehaltlich der Verwertung des Gehölzes, auf 330
Mark per Morgen. Das Feldgericht schließt sich dieser Ansicht an und taxiert
den Wert dieses Areals auf 7 Mark, dagegen den Wert des zuerst in Aussicht
genommenen Platzes auf 9 Mark per Rute. Der Gemeinderat beschließt, 2-2
1/2 Morgen des zuerst in Aussicht genommenen Platzes, die Rute für 9
Mark, an die Petentin zu verkaufen, letztere muss die Fällung der Bäume
vornehmen lassen, das gewonnene Holz verbleibt Eigentum der Stadt, auch
wird Sicherheitsleistung dafür verlangt, dass Petentin die
Einfriedungsmauer in derselben Weise fortführen lässt, wie die des
christlichen Friedhofs ausgeführt ist; dabei soll der Petentin die
Benutzung der einen Mauer des christlichen Friedhofs gestattet
werden". Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Dezember 1876: "Wiesbaden, 12. Dezember
(1876). Auf das Gesuch der israelitischen Religionsgesellschaft hatte der
Gemeinderat beschlossen, derselben einen Teil des städtischen
Grundstücks beim neuen Friedhof, und zwar den nach der Leichtweishöhle
hin gelegenen, käuflich abzutreten. Behufs Feststellung des Wertes des Areals
war das Gesuch an den Herrn Oberförster und das Feldgericht abgegeben
worden. Ersterer rät davon ab, das in Aussicht genommene Areal zum
Friedhof zu bestimmen, weil die Fläche eine stark nach dem Nerotal hin
abfallende Bergwand bilde und zur zum kleinsten Teile als Friedhof
angelegt werden könnte und weil überdies die kahle Totenhofsfläche das
hübsche landschaftliche Bild der Gegend zerstören würde. Der Herr
Oberförster empfiehlt, eine gleich große Fläche in demselben
städtischen Walddistrikte Höllkund, aber oben an der zweiten, von der
Platterstraße nach den Wiesen führenden Schneise gelegen, zu genanntem
Zwecke abzugeben; der Wert des dortigen Grund und Bodens veranschlagt die
Aufsichtsbehörde, vorbehaltlich der Verwertung des Gehölzes, auf 330
Mark per Morgen. Das Feldgericht schließt sich dieser Ansicht an und taxiert
den Wert dieses Areals auf 7 Mark, dagegen den Wert des zuerst in Aussicht
genommenen Platzes auf 9 Mark per Rute. Der Gemeinderat beschließt, 2-2
1/2 Morgen des zuerst in Aussicht genommenen Platzes, die Rute für 9
Mark, an die Petentin zu verkaufen, letztere muss die Fällung der Bäume
vornehmen lassen, das gewonnene Holz verbleibt Eigentum der Stadt, auch
wird Sicherheitsleistung dafür verlangt, dass Petentin die
Einfriedungsmauer in derselben Weise fortführen lässt, wie die des
christlichen Friedhofs ausgeführt ist; dabei soll der Petentin die
Benutzung der einen Mauer des christlichen Friedhofs gestattet
werden". |
Landespolizeiliche Zustimmung zur Anlage des orthodoxen
Friedhofes (1877)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. März 1877: "Wiesbaden. Der israelitischen
Religionsgesellschaft wurde die landespolizeiliche Erlaubnis erteilt, im
Distrikt Hellkund einen Begräbnisplatz anzulegen. Der betreffende Platz
ist mit einer der Einfriedigung des angrenzenden allgemeinen Friedhofs
entsprechenden Einfriedigungsmauer zu versehen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. März 1877: "Wiesbaden. Der israelitischen
Religionsgesellschaft wurde die landespolizeiliche Erlaubnis erteilt, im
Distrikt Hellkund einen Begräbnisplatz anzulegen. Der betreffende Platz
ist mit einer der Einfriedigung des angrenzenden allgemeinen Friedhofs
entsprechenden Einfriedigungsmauer zu versehen." |
Die Einweihung des orthodoxen Friedhofes anlässlich
der Beisetzung von Amalie Hirsch (1877)
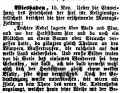 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. November 1877: "Wiesbaden, 15. November (1877).
Über die Einweihung des Friedhofes der hiesigen israelitischen
Religionsgesellschaft berichtet die hier erscheinende
Montags-Zeitung: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. November 1877: "Wiesbaden, 15. November (1877).
Über die Einweihung des Friedhofes der hiesigen israelitischen
Religionsgesellschaft berichtet die hier erscheinende
Montags-Zeitung:
'Dichter Nebel lagerte über Wald und Flur, und wo der Herbststurm hier
und da noch ein Blättchen an einem Baume oder Strauche vergessen hatte,
da glänzten gleich Tränen an den Wimpern, Wassertropfen, die raschelnd
auf das welke Laub niederfielen. Und ernste Bilder traten vor die Seele
des einsamen Wanderers bei dem Gedanken, wie bald, ach wie bald verweht
wohl auch dich der Herbststurm gleich einem welken Blatte, jede Spur
verwischend. Doch der Gedankengang wurde unterbrochen, wir waren am Ziele,
an dem Tore des neuen israelitischen Totenhofes angelangt, welcher heute
seine Weihe mit der Be- |
 erdigung
der Leiche der dahier verstorbenen Frau Amalie Hirsch erhalten
sollte. erdigung
der Leiche der dahier verstorbenen Frau Amalie Hirsch erhalten
sollte.
Die Mauer, die den neuen christlichen Friedhof umschließt, wurde über
den neuen israelitischen Totenhof hinaus verlängert (sodass nach Außen
hin die beiden Friedhöfe ein geschlossenes Ganzes bilden), nur trennt
innen die Umfassungsmauer des christlichen Totenhofes dieselben. Wir
traten ein durch das Gittertor, in dessen Nähe sich eine offene Halle
befindet, durchschritten den weiten Raum, der jeden Schmuckes entbehrt.
Ganz am oberen Ende deutete ein frisch aufgeworfener Erdhügel die Stelle
an, wo die irdischen Überreste einer braven Frau, einer liebenden und
geliebten, aber auch schwer geprüften Gattin und Mutter ausruhen sollte
nach langem, harten Kampfe.
Doch eben langt der Leichenkondukt an; der mit einem schwarzen Tuche
bedeckte, schmucklose Sarg wird auf einer Bahre durch die Halle
durchgetragen und nach dem Grabe zu abgestellt und Herr Dr. Cahn beginnt
in hebräischer Sprache einen Psalm abzusingen, in welchen die
Leidtragenden einstimmten und den er alsdann ins deutsche übersetzte.
Herr Dr. Cahn hielt eine ergreifende Rede, welche auf die Anwesenden einen
tiefen Eindruck machte. In heißem Gebete flehte der Redner die Gnade
Gottes herab auf Seine Majestät den Kaiser, das kaiserliche Haus, die
Staats- und städtischen Behörden, durch deren Mitwirken es allein
ermöglicht worden sei, dass der Humanität, der Toleranz ins o erhebender
Weise Rechnung getragen wurde durch die Herstellung eines Friedhofes, von
welchem Niemand ausgeschlossen werden könne. Tief ergriffen und tief
ergreifend schloss Herr Dr. Cahn seine feierliche Rede mit einem
inbrünstigen Gebete zu Gott, dass er alle, alle Menschen segnen möge,
auf dass wir noch lange, noch lange leben möchten mit unseren
Angehörigen, damit wir Zeit hätten, um Buße zu tun, um die Saat
auszustreuen des Guten, des Wahren, des Schönen und Gerechten; denn mit
dem Grabe höre die Saat aus, Saat zu sein, das sei die Zeit, wo sie
aufgehe und er Ernte entgegen reife, und im Jenseits würde Jeder ernten,
was er gesäet.
Wir wissen nicht, ob die herbstlich feuchte Luft, die grauen düsteren
Nebel, ringsum die ersterbende Natur auch auf uns und alle Anwesenden
ihren Einfluss geltend machte, doch wie an Ästen und Zweigen der Bäume
und Sträucher glänzte es plötzlich in aller Augen, und als der Redner
in fast schluchzendem Tone den Segen Gottes in dieser feierlichen Stunde
herabflehte auf den Friedhof, da er (Redner), ja die Macht nicht besitze,
einen Ort heilig zu sprechen, der erst durch die geheiligt werden müsse,
die in ihm zur ewigen |
 Ruhe
gebettet werde, da schwand jeder Standes- und Glaubensunterschied, jede Schranke
fiel., und wie alle Toten gleich schmuck- und prunklos auf einem und
denselben Friedhof begraben werden, ob Arm oder Reich, ob Hoch oder
Niedrig, da ja der Tod ohnedies Alles gleich macht, so fühlten wir uns
gleich mit unseren israelitischen Brüdern im Herzen. Und wenn unser
Wille, unsere Wünsche sich bewahrheite3n, so möchten wir, dass auch die
Christen in gleicher Weise begraben werden möchten - schmuck- und
prunklos, wie unsere israelitischen Brüder, was das Leben oft unmöglich
macht, wäre denn doch im Tode erfüllt. Unter den üblichen Zeremonien
wurde der erste Sarg in die stille Grube gesenkt; dumpf dröhnend rollte
Scholle um Scholle nieder auf den Sarg und ein heller Sonnenblick
durchbrach die dichten Nebel, das Auge Gottes strahlte freudig hernieder
auf den ihm geweihten Ort des Friedens. Ruhe
gebettet werde, da schwand jeder Standes- und Glaubensunterschied, jede Schranke
fiel., und wie alle Toten gleich schmuck- und prunklos auf einem und
denselben Friedhof begraben werden, ob Arm oder Reich, ob Hoch oder
Niedrig, da ja der Tod ohnedies Alles gleich macht, so fühlten wir uns
gleich mit unseren israelitischen Brüdern im Herzen. Und wenn unser
Wille, unsere Wünsche sich bewahrheite3n, so möchten wir, dass auch die
Christen in gleicher Weise begraben werden möchten - schmuck- und
prunklos, wie unsere israelitischen Brüder, was das Leben oft unmöglich
macht, wäre denn doch im Tode erfüllt. Unter den üblichen Zeremonien
wurde der erste Sarg in die stille Grube gesenkt; dumpf dröhnend rollte
Scholle um Scholle nieder auf den Sarg und ein heller Sonnenblick
durchbrach die dichten Nebel, das Auge Gottes strahlte freudig hernieder
auf den ihm geweihten Ort des Friedens.
Wir bedauerten herzlich, dass sich, so viel wir sahen, offiziell Niemand
an dieser erhebenden Feier beteiligte, weder von Behörden, noch von
Vertretern anderer Konfessionen. Uns erfüllt es mit gerechtem Stolz und
Freude, Zeuge eines Aktes sein zu dürfen, der im vollsten Sinne des
Wortes ein glänzender Sieg der Toleranz, der Humanität, der vom Staate
garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit ist, und mit Herrn Dr. Cahn
geben wir dem Wunsche Ausdruck, dass Gott unseren erhabenen Kaiser, dem es
vergönnt war wie noch keinem Sterblichen, dem teuren deutschen Vaterlande
nach außen Macht, Einfluss und Ansehen, nach Innen starken Schutz des
Rechtes, des Eigentums und der Gewissensfreiheit zu verleihen, noch lange,
noch recht lange erhalte, damit er die Früchte schaue von den Saaten, die
er gesäet!" |
Der neue jüdische Friedhof
Ein neuer
jüdischer Friedhof wurde seit 1891 belegt (erste Beisetzung und
Einweihung des Friedhofes am 4. Januar 1891 durch Rabbiner Dr.
Silberstein; beigesetzt wurde Dr. med. Pauly aus Posen). Bis 1943 sind 1.802 Beisetzungen
vorgenommen worden. Unter den Gräbern sind auch mehrere von Kurgästen, die in
Wiesbaden während der Kur verstarben.
Dieser Friedhof wird bis zur Gegenwart
als Begräbnisplatz der jüdischen Gemeinde der Stadt benutzt. Die
Friedhofsfläche umfasst 50,32 ar.
Aus der
Geschichte des neuen jüdischen Friedhofes
Einweihung des neuen Friedhofes (1891)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Januar 1891: "Wiesbaden, im Januar (1891). In der
hiesigen israelitischen Kultusgemeinde, deren Anfänge sich schon nach dem
Dreißigjährigen Kriege nachweisen lassen, wurden Anfangs die Toten auf
dem israelitischen Friedhofe der zum Rabbinatsbezirke Wiesbaden
gehörigen Gemeinde Wehen beerdigt. Später erwarb die hiesige Gemeinde in
Verbindung mit einer Anzahl benachbarter Gemeinden (Bierstadt,
Schierstein, Biebrich) einen auf der 'Schönen Aussicht' gelegenen
Friedhof, der allmählich vergrößert, 150 Jahre der Gemeinde als
Ruhestätte für ihre Toten gedient hat. Da in Folge des Anbaues
zahlreicher Villen die Stadt sich bis zum israelitischen Friedhofe
ausdehnte, so wurde die Schließung desselben, der auch nur noch wenig
Platz zur Beerdigung darbot, seitens des Herrn Ministers auf den 1. Januar
dieses Jahres angeordnet. Am 4. Januar fand nun aus Anlass der Beerdigung
eines fremden Glaubensgenossen (Dr. med. Pauly aus Posen) die Einweihung
des neuen Friedhofs, dessen Terrain der Gemeinde von den städtischen
Kollegien unentgeltlich dargeboten war, in feierlicher Weise durch den
Stadt- und Bezirksrabbiner, Herrn Dr. Silberstein hierselbst, statt. Wir
entnehmen über den Weiheakt den hiesigen Lokalblättern folgende
auszügliche Mitteilung. 'Dem warmen Dankgefühle des Vorstandes und der
Gemeinde für das durch die Überlassung des schön gelegenen Terrains
bezeugte Wohlwollen der städtischen Behörden gab die Weiherede des Herrn
Rabbiners beredten Ausdruck. Der Redner zeichnete unter Zugrundelegung der
mannigfachen Bezeichnungen, die dem israelitischen Friedhofe beigelegt
werden, in ergreifender Weise die tiefere Bedeutung desselben. Die Rede
wird wahrscheinlich durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht
werden.'" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Januar 1891: "Wiesbaden, im Januar (1891). In der
hiesigen israelitischen Kultusgemeinde, deren Anfänge sich schon nach dem
Dreißigjährigen Kriege nachweisen lassen, wurden Anfangs die Toten auf
dem israelitischen Friedhofe der zum Rabbinatsbezirke Wiesbaden
gehörigen Gemeinde Wehen beerdigt. Später erwarb die hiesige Gemeinde in
Verbindung mit einer Anzahl benachbarter Gemeinden (Bierstadt,
Schierstein, Biebrich) einen auf der 'Schönen Aussicht' gelegenen
Friedhof, der allmählich vergrößert, 150 Jahre der Gemeinde als
Ruhestätte für ihre Toten gedient hat. Da in Folge des Anbaues
zahlreicher Villen die Stadt sich bis zum israelitischen Friedhofe
ausdehnte, so wurde die Schließung desselben, der auch nur noch wenig
Platz zur Beerdigung darbot, seitens des Herrn Ministers auf den 1. Januar
dieses Jahres angeordnet. Am 4. Januar fand nun aus Anlass der Beerdigung
eines fremden Glaubensgenossen (Dr. med. Pauly aus Posen) die Einweihung
des neuen Friedhofs, dessen Terrain der Gemeinde von den städtischen
Kollegien unentgeltlich dargeboten war, in feierlicher Weise durch den
Stadt- und Bezirksrabbiner, Herrn Dr. Silberstein hierselbst, statt. Wir
entnehmen über den Weiheakt den hiesigen Lokalblättern folgende
auszügliche Mitteilung. 'Dem warmen Dankgefühle des Vorstandes und der
Gemeinde für das durch die Überlassung des schön gelegenen Terrains
bezeugte Wohlwollen der städtischen Behörden gab die Weiherede des Herrn
Rabbiners beredten Ausdruck. Der Redner zeichnete unter Zugrundelegung der
mannigfachen Bezeichnungen, die dem israelitischen Friedhofe beigelegt
werden, in ergreifender Weise die tiefere Bedeutung desselben. Die Rede
wird wahrscheinlich durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht
werden.'" |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Januar 1891: "Wiesbaden, 15. Januar (1891).
Der neue israelitische Friedhof an der Platter-Chausee, dessen age in des
Waldes Mitte romantischer nicht gewählt werden konnte, wurde gestern
Nachmittag anlässlich der ersten dort stattfindenden Beerdigung eines
hier verstorbenen auswärtigen Arztes, Dr. med. Julius Pauly, von
dem Bezirks-Rabbiner Herrn Dr. Silberstein im Beisein des
Vorstandes der Gemeinde und des Herrn Stadtbaumeister Israel, als
Vertreter der Stadt, feierlichst eingeweiht. 'Sei mir gegrüßt, du
freundliche Stätte der Gräber', so leitete Redner seine Weiherede ein,
'die Stätte, die fast 1 1/2 Jahrhundert der israelitischen Gemeinde wie
die Mitglieder der benachbarten Gemeinden als Ruhestätte für ihre Toten
gedient hätte, sei auf höhere Anordnung geschlossen worden. Die
mühevolle Arbeit der Führer der Gemeinde, einen würdigen Ruheplatz für
die Entschlafenen zu finden, habe ihnen das Wohlwollen und Entgegenkommen
der Stadt wesentlich erleichtert und dieses beweise, wie fest die
ursprünglich kleine jetzt zu so stattlicher Zahl herangewachsene Gemeinde
Wurzel in ihr geschlagen und bemüht sei, mitzuarbeiten an ihrem
Emporblühen.' Die wohldurchdachte Weiherede des Herrn Dr. Silberstein
gipfelte im Wesentlichen in der Bedeutung des Friedhofes als Stätte nicht
nur der Toten, sondern auch der Lebenden und der Ewigkeit. Die Beteiligung
an dem ersten Weiheakt war infolge des unfreundlichen Wetters leider nur
eine spärliche."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Januar 1891: "Wiesbaden, 15. Januar (1891).
Der neue israelitische Friedhof an der Platter-Chausee, dessen age in des
Waldes Mitte romantischer nicht gewählt werden konnte, wurde gestern
Nachmittag anlässlich der ersten dort stattfindenden Beerdigung eines
hier verstorbenen auswärtigen Arztes, Dr. med. Julius Pauly, von
dem Bezirks-Rabbiner Herrn Dr. Silberstein im Beisein des
Vorstandes der Gemeinde und des Herrn Stadtbaumeister Israel, als
Vertreter der Stadt, feierlichst eingeweiht. 'Sei mir gegrüßt, du
freundliche Stätte der Gräber', so leitete Redner seine Weiherede ein,
'die Stätte, die fast 1 1/2 Jahrhundert der israelitischen Gemeinde wie
die Mitglieder der benachbarten Gemeinden als Ruhestätte für ihre Toten
gedient hätte, sei auf höhere Anordnung geschlossen worden. Die
mühevolle Arbeit der Führer der Gemeinde, einen würdigen Ruheplatz für
die Entschlafenen zu finden, habe ihnen das Wohlwollen und Entgegenkommen
der Stadt wesentlich erleichtert und dieses beweise, wie fest die
ursprünglich kleine jetzt zu so stattlicher Zahl herangewachsene Gemeinde
Wurzel in ihr geschlagen und bemüht sei, mitzuarbeiten an ihrem
Emporblühen.' Die wohldurchdachte Weiherede des Herrn Dr. Silberstein
gipfelte im Wesentlichen in der Bedeutung des Friedhofes als Stätte nicht
nur der Toten, sondern auch der Lebenden und der Ewigkeit. Die Beteiligung
an dem ersten Weiheakt war infolge des unfreundlichen Wetters leider nur
eine spärliche." |
Ein christlicher Mann wird auf Grund seiner falschen
Angaben zunächst im jüdischen Friedhof beigesetzt (1895)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. Juli 1895: "Wiesbaden, 28. Juni (1895). Vor
einigen Tagen starb im hiesigen städtischen Krankenhause ein Mann, der
angegeben hatte, er heiße Willy Randow und sei Jude. Die Leiche
wurde daher auf dem israelitischen Friedhofe hier beerdigt. Kurze Zeit
später erschien ein Mann im Krankenhause, der sich nach seinem Sohne Karl
Braun aus Essen erkundigte. Ein solcher befand sich indessen nicht im Krankenhause.
Nach eingehenden Erörterungen ergab es sich, dass der als Willy Randow
beerdigte Mann kein anderer gewesen sein könne, als jener Karl Braun aus
Essen. Er war, ein verkommenes Subjekt, lange Jahre in der Welt
herumgeirrt, ohne daheim etwas von sich hören zu lassen. Neuerdings erst
hatten die Eltern von ihm die Nachricht erhalten, er sei zum Judentum
übergetreten und befinde sich im Krankenhause zu Wiesbaden. Gestern wurde
die Leiche ausgegraben und auf dem christlichen Friedhofe beigesetzt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. Juli 1895: "Wiesbaden, 28. Juni (1895). Vor
einigen Tagen starb im hiesigen städtischen Krankenhause ein Mann, der
angegeben hatte, er heiße Willy Randow und sei Jude. Die Leiche
wurde daher auf dem israelitischen Friedhofe hier beerdigt. Kurze Zeit
später erschien ein Mann im Krankenhause, der sich nach seinem Sohne Karl
Braun aus Essen erkundigte. Ein solcher befand sich indessen nicht im Krankenhause.
Nach eingehenden Erörterungen ergab es sich, dass der als Willy Randow
beerdigte Mann kein anderer gewesen sein könne, als jener Karl Braun aus
Essen. Er war, ein verkommenes Subjekt, lange Jahre in der Welt
herumgeirrt, ohne daheim etwas von sich hören zu lassen. Neuerdings erst
hatten die Eltern von ihm die Nachricht erhalten, er sei zum Judentum
übergetreten und befinde sich im Krankenhause zu Wiesbaden. Gestern wurde
die Leiche ausgegraben und auf dem christlichen Friedhofe beigesetzt."
|
Lage der Friedhöfe:
Der alte jüdische Friedhof liegt "auf dem
Kuhberg" nördlich des Stadtzentrums an der Straße "Schöne
Aussicht"/Hergenhahnstraße.
Der orthodoxe Friedhof liegt beim städtischen Nordfriedhof an der
Platter Straße.
Der neue jüdische Friedhof liegt neben dem städtischen Nordfriedhof an der Platter Straße.
Auf der Website der Stadt Wiesbaden findet sich ein Link zu einem Stadtplan, auf dem die Friedhöfe eingezeichnet sind.
Fotos
(Fotos des alten Friedhofes: Hahn, Aufnahmedatum 7.6.2012: Fotos
des orthodoxen und des neuen Friedhofes: Hahn, Aufnahmedatum: 10.8.2008:
Hinweis: Fotos des alten Friedhofes finden sich auch in einer Fotoseite von
Stefan Haas https://www.blitzlichtkabinett.de/friedhöfe/friedhöfe-in-hessen-ii/).
Fotos
des alten
jüdischen Friedhofes |
 |
 |
| |
Blick auf den
Friedhof von der
Straße "Schöne Aussicht" |
Das Eingangstor an der
Straße
"Schöne Aussicht" |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Hinweistafel |
Blick vom Eingangstor |
Blick in den
Friedhof von der
Hergenhahnstraße |
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| Fotos
des orthodoxen Friedhofes |
|
|
 |
 |
 |
Blick auf das
Eingangstor |
Blick auf den Friedhof vom
nichtjüdischen
Friedhofsteil, rechts das Eingangstor. |
Teilansicht |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Teilansichten des
Friedhofes |
| |
|
|
| |
|
|
Fotos
des neuen jüdischen Friedhofes -
Teil
des städtischen Nordfriedhofes |
|
|
 |
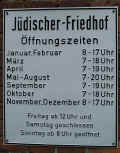 |
 |
| Das Eingangstor zum jüdischen
Friedhof |
Tafel mit den Öffnungszeiten |
Hinweis auf Feiertage |
| |
|
|
 |
 |
 |
Hinweis für Kopfbedeckung
der
Männer |
Blick zum Eingangstor
vom
Friedhof |
Die Friedhofshalle, die im
Sommer 2008 renoviert wird |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Im Bereich der
Friedhofsmauer beim Eingangstor im oberen Teil befinden sich einige monumentale
Familiengräber |
| |
 |
 |
 |
Großes Grabmal
der Familie Lieber |
Teilansicht |
Grabstätte des rumänischen
Ehepaares
Costiner (gest. Juli 1915) |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabplatte für Micha Golomb,
gest. März 1938 |
Teilansichten |
| |
|
Denkmal für die Gefallenen
des
Ersten Weltkrieges |
 |
 |
| |
"Den im
Weltkrieg 1914-1918 Gefallenen unserer Gemeinde zum Gedenken"
mit Namen und Lebensdaten |
| |
|
 |
 |
 |
| Teilansichten des
Friedhofes |
Grabstein für Adolf Strauss
(1842-1910)
und Laura geb. Kempner (1850-1917) |
| |
| |
|
 |
 |
 |
| Gräberfeld aus
den 1970er-Jahren; bei Familiengräbern erfolgen teilweise noch weitere
Beisetzungen |
| |
 |
 |
 |
Grabstein für Dr.
Friedrich Reichmann
(1899-1966), Vorsitzender der jüdischen
Gemeinde
Wiesbaden usw. mit
Gedenkinschriften für im Holocaust
umgekommene
Familienmitglieder |
Grabstein für
Kurt Magoniner
(1894-1972), Ehrenvorsitzender der
jüdischen Gemeinde
Wiesbaden und
Marga Margoniner (1903-1978) mit
"segnenden
Händen" der Kohanim |
Detail aus einem neueren
Grabmal:
"Dem Auge fern, dem
Herzen ewig nah" |
| |
| |
Gräber aus den 1990-Jahren
und
neueste Erweiterungsfläche |
 |
 |
|
Gräber aus den 1990er-Jahren,
dahinter
der ältere Teil des Friedhofes |
Gräber aus den 1990er-Jahren,
rechts der
Hecke die neueste Erweiterungsfläche |
| |
|
|
 |
 |
 |
Blick vom
Gräberfeld der 1990er-Jahre
auf die neueste Erweiterungsfläche
hinter
der Hecke |
Neuere Gräber
von 2007/2008 |
| |
| |
|
|
| |
|
|
Presseartikel zu den jüdischen Friedhöfe in Wiesbaden
| August 2009:
Kritischer Beitrag zum Pflegezustand des alten
Friedhofes |
 Foto
links von Friedhof Windolf/RMB: Der Komposthaufen gammelt vor sich
hin und verbreitet unschöne Gerüche. Foto
links von Friedhof Windolf/RMB: Der Komposthaufen gammelt vor sich
hin und verbreitet unschöne Gerüche.
Artikel von Birgit Emnet vom 6. August 2009 im "Wiesbadener
Kurier" (Artikel)
"WIESBADEN. Pietätlose Komposthalde: Auf altem jüdischen
Friedhof gammelt Grünschnitt vor sich hin.
'Pietätlos', meint Antje Laumann, Anwohnerin der Hergenhahnstraße 8 und somit direkte Anliegerin am alten jüdischen Friedhof im Komponistenviertel. Heute eine der ersten Adressen der Stadt und damals, 1747, noch draußen vor den Stadttoren liegt das Grundstück
'Auf dem Kuhberg", ein Kulturdenkmal. Und auf diesem stinkt's zum Himmel, denn seit Wochen, weiß Antje Laumann, ist im hinteren Teil des jüdischen Friedhofs eine Grünschnittdeponie eingerichtet, auf der wohl Grababraum und auch Sträucher und Hecken vermodern.
'Die Rotte deckt noch die letzten Grabstätten aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts", so die Anliegerin, und muffelt in die angrenzenden Häuser.
'Ein treffliches Beispiel für den Umgang der Stadt mit ihren Kulturgütern, insbesondere mit dem jüdischen
Erbe' sei's, meint sie. Denn Antje Laumann weiß, dass nach jüdischem Ritus ein Friedhof nicht angetastet werden darf, seine Grabmale für die Ewigkeit seien.
'Wir wissen nicht, ob das Grünflächenamt dafür verantwortlich ist", so die Auskunft von Rathaussprecher Florian Grösch. Aber das Amt werde für eine umgehende Beseitigung des Grünschnitts sorgen. Grundsätzlich sei die Stadt für die Pflege der Anlage verantwortlich, so Grösch weiter.
Der Friedhof 'Auf dem Kuhberg' lag früher an der Idsteiner Straße, heute Schöne Aussicht, und ist der erste jüdische, der in Wiesbaden angelegt wurde. Vorher, also vor 1747, mussten die Wiesbadener Juden ihre Toten in Wehen beerdigen. 1779 wurde eine erste Erweiterung fällig, 1850 folgte bereits die nächste. Der Friedhof wurde eingezäunt und noch bis 1891 genutzt. Danach wurden lediglich noch bis etwa 1935 gelegentlich Urnen in Familiengräbern beigesetzt.
Rund 520 Grabstätten wurden vom Hauptstaatsarchiv 1987 erfasst, die älteste von 1752. Stehende und liegende bemooste Grabsteine, meist Stelen aus rotem Mainsandstein und oft stark verwittert, sind auf dem fast 4700 Quadratmeter großen Areal verstreut. Der jüdischen Tradition folgend sind die Grabsteine nach Osten ausgerichtet. Jüdische Tradition ist auch, dass der Friedhof als solcher erhalten bleiben muss und die Totenruhe nicht gestört werden darf." |
| |
| |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
| Hinweis
auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde
Wiesbaden |
In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs
(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus
hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:
Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41
Zu Wiesbaden sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
HHStAW 365,915 Geburts-, Trau- und Sterberegister der Juden von
Wiesbaden 1832 - 1876 (Abschrift vom September 1943): enthält
jüdisches Geburtsregister 1833 - 1874, jüdisches Trauregister 1832 -
1874 und jüdisches Sterberegister 1834 - 1876; enthält auch
Angaben zu Personen aus Wiesbaden-Sonnenberg https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v1900022
HHStAW 365,949 Gräberliste des Friedhofs "Schöne
Aussicht" zu Wiesbaden (in alphabetischer Reihenfolge) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5496452
HHStAW 365,916 Gräberverzeichnis des jüdischen Friedhofs
Platterstraße in Wiesbaden 1891 - 1943: enthält ein Verzeichnis der
verstorbenen Juden mit Angaben zu Personenstandsdaten und zur Grablage,
dazu auch eine Begräbnis- und Friedhofsordnung für die israelitische
Kultusgemeinde Wiesbaden mit Situationsplan des Friedhofs Platterstraße
(Druck) von 1891; dazu auch ein Merkblatt für die Hinterbliebenen vom
Krematorium Berlin-Wilmersdorf (Druck)
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v4971266
HHStAW 365,917 Heiratsurkunden von Juden aus den Ortschaften der
Stadt- und Bezirksrabbinate Wiesbaden und Mainz 1908 - 1917:
Heiratsurkunden und Traubescheinigungen, überwiegend auf Hebräisch, zum
Teil auf Deutsch
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v1245121
HHStAW 365,918 Heiratsurkunden von Juden aus den Ortschaften der
Stadt- und Bezirksrabbinate Wiesbaden und Mainz 1928 - 1930:
Heiratsurkunden und Traubescheinigungen, überwiegend auf Hebräisch, zum
Teil auf Deutsch
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v3732275
HHStAW 365,943 Deportationsliste Wiesbadener Juden 1940 -
1942 https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v281127
|
Literatur / Medien:
 | Arnsberg II,384-402.
|
 | CD-Dokumentation des Verlages 1media.org: |



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
|