|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Hessen"
Zur
Übersicht "Jüdische Friedhöfe im Kreis Offenbach"
Seligenstadt (Kreis
Offenbach)
Jüdischer Friedhof
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
Siehe Seite zur Synagoge in Seligenstadt
(interner Link)
Zur Geschichte des Friedhofes
Der jüdische Friedhof
stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (angelegt um 1714). Er
wurde 1888 und 1926 erweitert. Bereits 1919 wurde der Friedhof geschändet. In
der NS-Zeit wurde der Friedhof von 1942 bis 1945 als Pferdeweide
missbraucht; die Grabsteine abgeräumt, zerschlagen und großenteils verbaut.
Die Friedhofsfläche umfasst 14,94 ar.
Nach 1945 wurde das Friedhofgrundstück - soweit noch möglich - wieder
hergerichtet. Es sind auch noch zwei Beisetzungen vorgenommen worden (1954 und
1965).
Die 1942 abgeräumten Grabsteine wurden teilweise zur Anlage des
Kellerfundamentes eines Gebäudes an der Einhardstraße zweckentfremdet. Im Herbst
2000 wurden sie beim Abbruch dieses Hauses gefunden (siehe Bericht unten).
Einige Grabsteine konnten zusammengesetzt und an der Friedhofsmauer aufgestellt
werden. Die übrigen Grabstein-Fragmente wurden als Denk- und Mahnmal auf dem
Friedhof zusammengelegt (siehe Fotos unten).
Nach Erinnerungen älterer Seligenstädter Einwohner wurde ein weiterer Teil der
Grabsteine des jüdischen Friedhofes bei anderen Baumaßnahmen verwendet,
vermutlich beim Bau einer Gartenmauer am ehemaligen Feuerwehrhaus sowie beim Bau
des Luftschutzbunkers unterhalb des Marktplatzes. Nach einem weiteren
vorliegenden Bericht hatten Jugendliche einen über Nacht abgestellten und mit
Grabsteinen beladenen Anhänger gesehen und einzelne Grabsteine vom Anhänger
herunter geworfen. Als Strafe hätten sie am Seligenstädter Bahnhof einen
Waggon mit Kohle über Nacht ausladen müssen.
Über die Auffindung und Rekonstruktion einzelner
Grabsteine des Friedhofes (2000/2001):
| Oktober 2000:
Auffindung der Grabsteine in einem Haus an der
Einhardstraße |
 Artikel
in der "Offenbach-Post" vom 10. Oktober 2000: "'Vermutlich
war der komplette Keller aus Grabmalen gemauert'. Weitaus mehr Funde
als erwartet ruhten in den Fundamenten des Abrisshauses. Artikel
in der "Offenbach-Post" vom 10. Oktober 2000: "'Vermutlich
war der komplette Keller aus Grabmalen gemauert'. Weitaus mehr Funde
als erwartet ruhten in den Fundamenten des Abrisshauses.
Seligenstadt (kai). Das Ausmaß der Schändung von Grabmälern, die
in der Nazizeit mutmaßlich vom jüdischen Friedhof in Seligenstadt
gestohlen, zertrümmert und als Mauerwerk verwendet wurden, ist weit
größer als bisher vermutet..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
| |
| Frühjahr/Sommer
2001: Grabsteinfragmente werden
zusammengesetzt |
Jüdische Geschichte als steinernes Puzzle
- Artikel von Claudia
Bucci in der Frankfurter Rundschau am 19. Juni 2001.
Bruchstücke von im Jahr 1942 zerstörten Grabsteinen setzen Wissenschaftler und Jugendliche auf dem jüdischen Friedhof in Seligenstadt (Kreis Offenbach) zusammen. Möglichst viele der Grabmale sollen rekonstruiert werden, zugleich ist ein Mahnmal geplant.
SELIGENSTADT. Ausgerüstet mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen machten sich Schülerinnen und Schüler der Hermann-Hesse-Gesamtschule in Obertshausen ans Werk. Sie sichteten und sortierten Grabsteinfragmente auf dem jüdischen Friedhof in Seligenstadt. Die Grabsteine seien um das Jahr 1942 zerschlagen und zum Bau eines Kellerfundaments zweckentfremdet worden, sagt Klaus Werner, der Initiator des Projekts. Als das Haus im Herbst vergangenen Jahres abgerissen wurde, sei knapp die Hälfte der Steine vor der endgültigen Zerstörung bewahrt worden.
Nach Augenmaß sortieren die Jugendlichen die Steine und hieven sie auf große Holzpaletten. "Man muss nun jeden Stein reinigen und sie dann wie ein Puzzle zusammenstellen", sagt die Judaistin Christa Wiesner, die für die Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen schon mehrfach hebräische Grabinschriften übersetzt hat. Während sie mit einer Bürste die eingemeißelten Schriftzeichen sorgfältig freilegt, schleppen zwei Jugendliche einen großen Stein herbei. Es ist das fehlende Puzzleteil zu einem Grabstein, der damit größtenteils wieder zusammengesetzt werden kann. (...) Nach den ersten Vermutungen der Judaistin handelt es sich um das Grabmal eines im Jahr 1849 gestorbenen Mannes. Noch drei weitere Steine können an diesem Nachmittag zumindest zur Hälfte wieder zu einem Teil zusammengefügt werden.
Sehr zufrieden mit diesem Ergebnis zeigt sich Klaus Werner, Professor für Politikwissenschaften am Fachbereich Polizei der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden. Er erwartet, dass nicht mehr als fünf Grabmale wiederhergestellt werden können. Seine Idee ist es, die rekonstruierbaren Grabsteine von einem Steinmetz zusammensetzen zu lassen und sie an der Friedhofsmauer entlang aufzustellen, sagt Werner, der zugleich der Berater für jüdische Friedhöfe des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen ist. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, so der Historiker, geplant sei eine solche Aktion jedoch für den Herbst. Aus den Steinfragmenten, die nicht wieder zusammengefügt werden können, soll ein Mahnmal auf dem Friedhof in Seligenstadt gestaltet werden, der Eigentum des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen ist.
"Etwas unheimlich" sei der Umgang mit den Grabsteinen schon, sind sich die Schülerinnen Lidia, Claudia und Daniela einig. Aber jetzt könnten sie sich viel besser vorstellen, wie ein solcher Friedhof früher aussah und sich ihr eigenes Bild machen, sagen sie. Sollte das Projekt fortgesetzt und ein Denkmal errichtet werden, wollen die Jugendlichen wieder mit von der Partie sein. (...) |
| |
| Text der Informationstafel am
Friedhofseingang: "Jüdischer Friedhof Seligenstadt.
Begräbnisstätte der Jüdischen Gemeinde Seligenstadt ab 1714. Während
der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geschändet durch
die Zerstörung von Grabsteinen sowie die Nutzung als Viehweide. Letzte
Beisetzung im Jahre 1965. Der Besuch an jüdischen Feiertagen und am
Sabbat ist untersagt. Der Schlüssel ist im Rathaus
erhältlich". |
Die Lage des Friedhofes
Der Friedhof liegt unmittelbar südlich der
Würzburger Straße / Ecke Einhardstraße (gegenüber
Matthias-Grünewald-Straße).
Fotos
(Neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 18.4.2008; Fotos zum
Friedhof auch in den Fotoseiten von Stefan Haas:
https://www.blitzlichtkabinett.de/friedhöfe/friedhöfe-in-hessen-ii/)
| Historisches Foto von 1930 |
 |
| |
Das Foto
wurde am 26. August 1930 von Hermann Laube erstellt und
freundlicherweise von Thomas Laube, Seligenstadt zugesandt. |
| |
|
|
| Neuere Fotos |
|
|
 |
 |
 |
| Blick auf die
Friedhofsmauer entlang der Einhardstraße |
Das Eingangstor |
| |
|
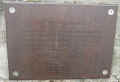 |
 |
 |
Informationstafel -
Texte
siehe oben |
Blick über den Friedhof
vom
Eingangstor |
Blick über den Friedhof von
der dem
Eingang gegenüberliegenden Seite |
| |
|
|
 |
 |
 |
Wenige erhaltene Grabsteine
aus
dem 18. Jahrhundert |
Grabstein für
Lissmann Oestreich
und Marianne geb. Sondhelm
(aus Kleinlangheim) mit
Gedenktafel für die
in der NS-Zeit ermordeten Kinder und Enkel
aus den
Familien Östreich und Nassauer |
Teilansicht
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Teilansicht |
Links Grabstein für
Moses
Hamburger
(geb. in Hörstein 1845, gest. 1935)
|
Die beiden letzten
Beisetzungen nach 1945:
Isaak Hamburger (1874-1965) und
Sally Hamburger
(1891-1954) |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Das Mahn- und
Denkmal aus Grabsteinfragmenten |
Grabsteinfragmente |
| |
|
 |
 |
|
Hebräischer Text
- Anfang des Totengebetes (Kaddisch): "Verherrlicht und geheiligt
werde Sein erhabener Name in der Welt,
die ER nach Seinem Ratschluss
geschaffen hat. Er lasse sein Reich kommen, sodass ihr alle mit dem ganzen
Haus Israel in unseren Tagen,
bald und in naher Zeit es erleben möget.
Darauf sprechet: Amen.
Ihre Seelen seien eingebunden in den Bund des Lebens." |
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
November 2019:
Schüler wollen sich um den
Friedhof kümmern
|
Artikel
von Markus Terharn in der "Offenbach-Post - op-online.de" vom
28. November 2019:
"Einhardgymnasium. Patenschaft für jüdischen Friedhof: Schüler-AG
will aufräumen und Schilder anbringen - Schüler des Einhardgymnasiums in
Seligenstadt wollen eine Patenschaft für den jüdischen Friedhof übernehmen.
Seligenstadt – Eine einmalige Angelegenheit sollte es sein, eine
einzigartige Sache ist es geworden: Im März 2018 trafen sich fünf
Seligenstädter Einhardschüler, um den Besuch des Holocaust-Überlebenden
Heinz Hesdörffer vorzubereiten. Inzwischen zählt die Gruppe zwölf
Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Ihr Ziel: 'Wir wollen eine
Patenschaft für den jüdischen Friedhof neben dem Gymnasium übernehmen',
erzählt Schülerin Marie. Kontakt zu Daniel Neumann, Präsident des
Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen mit Sitz in Frankfurt,
haben sie hergestellt. Nach Hesdörffers erschütterndem Bericht im Mai 2018
blieben viele Schüler dran. Einige waren dabei, als er vor einem Jahr das
Bundesverdienstkreuz erhielt. Just am 3. Mai dieses Jahres, als ein
Synagogenbesuch geplant war, starb er, 96 Jahre alt.
Neue Schüler stießen dazu, andere schieden nach dem Abitur aus. Mehr als 20
Mal trafen sie sich, meist in ihrer Freizeit. Aus dem Organisationskomitee
wurde die 'Arbeitsgemeinschaft jüdisches Leben in Seligenstadt'.
Versammlungsort ist mal die Schulbibliothek, mal das Zuhause von Gisela
Meutzner, bekannt durch ihre Stadtführungen auf Spuren jüdischer
Seligenstädter. Sie hatte den Kontakt zu Hesdörffer hergestellt, später zur
Auschwitz- und Buchenwald-Überlebenden Éva Fahidi, die kürzlich in der
Einhardstadt von ihren Leiden erzählte. Was plant die AG konkret? 'Zunächst
wollen wir den Friedhof allen Schülern und Lehrern bekannt machen', so die
Mitglieder. 'Sie sollen ihn besuchen und kennenlernen.' Viele wüssten
nämlich gar nicht, was sich hinter der Mauer verberge, die Hinweistafel an
der Ecke sei schlecht einsehbar, das Gemäuer trotz Halteverbots oft
zugeparkt. 'Außerdem wollen wir die Anlage von Müll befreien.' Was es da an
Müll gebe? 'Alles', fasst Moritz in einem Wort zusammen und zählt mit den
anderen auf: 'Autofelgen, volle oder leere Flaschen, Dosen oder
Verpackungen, Kleidung, Batterien, Feuerzeuge, Zeitungen', kurz alles, was
sich auch im Hausabfall finde. 'Einmal lagen 20 gute Äpfel da', erinnert
sich Meutzner. Ein andermal war's ein Unkrautvernichtungsmittel. Auch am
Synagogenplatz war die AG schon aktiv; auch dort wird viel weggeworfen,
wurden Tafeln beschädigt. Da setzt eine weitere Idee an: 'Wir wollen die
Namen derer feststellen, die auf dem Friedhof begraben sind, nach Bildern
und Lebensgeschichten suchen und nach Angehörigen forschen.' Die Namen der
Bestatteten sollen an der Mauer angebracht werden. Der Gefahr, dass auch
diese Beschilderung zerstört wird, sind sich die Aktivisten wohl bewusst.
'Dann sieht man wenigstens, was manche Leute so denken', meint Gisela
Meutzner achselzuckend. Zur Erreichung des Fernziels Patenschaft braucht es
einen langen Atem. Das ist allen klar, auch Lehrerin Barbara Koch, zuständig
für den Kontakt zwischen AG und Schule. Zwar hat sie ebenso wenig jüdische
Wurzeln wie Meutzner, doch sie betont: 'Das ist auch mein Thema.' In den
katholischen Religionsunterricht kann sie das einbringen. Ihr Urteil über
das Engagement der Einhardschüler: 'Tolle Geschichte!'."
Link zum Artikel
Anmerkung: zum Tod von Heinz Hesdörffer
https://zweitzeugen.de/aktuelles/nachruf-heinz-hesdoerffer
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Benno Szklanowski: Jüdischer Friedhof Seligenstadt
- hebräische Grabinschriften (Hrsg.: Magistrat der Stadt Seligenstadt).
Seligenstadt 1991. |



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
|