|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen im Saarland"
Merzig (Kreisstadt,
Kreis Merzig-Wadern)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Merzig sind Juden erstmals im 17. Jahrhundert
nachzuweisen. 1652 wird in einem Vogteigerichtsprotokoll "Roffel/Raphael
Jud" genannt. Es ist jedoch nicht sicher, ob er selbst in Merzig wohnte. 1683
wird erstmals die Familie des Moyses Hanau in Merzig genannt. Diese hatte
allerdings keine Beziehung mit dem genannten "Roffel Jud" (die oft zu
lesende Darstellung, dass sich die Nachkommen des Roffel Jud den Familiennamen
Hanau beilegten, ist nach Angaben von Annemarie Schestag, Heidelberg nicht
richtig). Die Herkunft des Moyses Hanau konnte bis jetzt noch nicht nachgewiesen
werden, eventuell aus Freistroff in der Grafschaft Bouzonville/Lothringen. Im 18. Jahrhundert zogen weitere
jüdische Familien in Merzig zu. 1768
und 1782 gab es fünf jüdische Familien in der Stadt, die überwiegend
vom Viehhandel lebten. Drei von ihnen waren allerdings nach einer Beschreibung
von 1782 "bettelarm". In letztgenanntem Jahr zählte die
jüdische Gemeinde, zu der auch die jüdischen Familien in den späteren
Filialgemeinden Brotdorf und
Hilbringen gehörten, etwa 12 Familien.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der jüdischen
Einwohner von 80 (1808/09) durch Zuwanderung von Dörfern der Umgebung zu auf
130 bis 140 Personen in den 1830er-Jahren (1846 Höchstzahl von 223
jüdischen Einwohnern, d.h. mehr als 6 % der Gesamtbevölkerung). "Geistliches Oberhaupt" der
Gemeinde war jahrzehntelang bis zu seinem Tod 1861 Moses Levy (auch Moses Merzig
genannt), ein in der weiten Umgebung bekannter und verehrter charismatischer Führer,
in dessen Jeschiwa auch auswärtige Schüler lernten. Er sorgte wesentlich dafür, dass um
1840 die neue Synagoge erbaut werden konnte (siehe unten). Auch eine
jüdische Elementarschule (jedoch als Privatschule, nicht als öffentliche
Schule) wurde 1823 mit der Einstellung des ersten Lehrers eröffnet, die bis 1876
bestand (Schule und Lehrerwohnung waren in der Rehstraße 10). Seitdem gingen die jüdischen Kinder in die katholische Elementarschule
und es bestand nur noch eine jüdische Religionsschule. Die jüdische Gemeinde
gehörte zum Bezirk des Trierer Oberrabbinates. Als 1840 die Wahl des
Oberrabbiners anstand, war Moses Levy ein Gegenkandidat zu Joseph Kahn. Die
jüdische Gemeinde Merzig hatte einen eigenen jüdischen Friedhof.
An jüdischen Vereinen
gab es in der Merziger Gemeinde: einen Armen-Verein (Unterstützung von Armen und Durchwanderern,
Mitglieder waren sämtliche Gemeindeglieder), eine Chewrath Bikkur Chaulim
(Wohltätigkeit, Krankenbesuche, Bestattungswesen), eine Chewrath Gemiluth
Chassodim, eine Chewrath Hanorim, eine Chewrath Mewaksche-Tow, den
Israelitischen Frauenverein, den Synagogenchorverein Chewras Meschaurarim, einen
Jüdischen Jugendverein und den "Verein Erholung").
Die
jüdischen Familien lebten im 18. Jahrhundert vor allem vom Handel mit Pferden,
Silber, Landesprodukten, Immobilien oder vom Geldverleih. Seit der 2. Hälfte
des 19.
Jahrhunderts waren jüdische Gewerbetreibende Inhaber von Konfektions- und Kolonialwarengeschäften,
aber auch weiterhin Vieh- und Pferdehändler sowie Metzger oder auch angesehene
Ärzte und Rechtsanwälte.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Sally
Hanau (geb. 11.7.1894 in Merzig, gef. 19.9.1915), Siegfried Hanau (geb. 8.3.1898
in Brotdorf, gef. 16.8.1917), Unteroffizier Edgar Herz (geb. 29.5.1892 in
Merzig, gef. 4.10.1914), Bernhard Heß (geb. 3.10.1893 in Merzig, gef.
6.9.1914), Leopold Israel (geb. 1.10.1895 in Alfter, gef. 26.11.1915), Alfred
Kaufmann (geb. 5.11.1892 in Merzig, gef. 6.7.1915), Michael Kaufmann (geb.
12.11.1894 in Hilbringen, gef. 20.8.1915). Walter Königsfeld (geb. 8.6.1892 in
Lüdenscheid, gef. 21.8.1917), Siegfried Salomon (geb. 21.9.1886 in Hilbringen,
gef. 28.9.1914), Gefreiter Moses Simon (geb. 28.12.1870 in Mörsdorf, gef.
24.10.1915), Arthur Tannenberg (geb. 11.9.1893 in Greifenberg - Sohn von Lehrer
Isaak Tannenberg, gef. 9.9.1914),
Adolf Wolfskohl (geb. 28.3.1882 in Nahbollenbach, gef.
2.8.1915).
Um 1925
waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde: Naftalie Hanau, A. Baum, M. Weil
und ein Herr Frank. Zur Repräsentanz gehörten die Herren Benny Cahn, David
Felsenthal, Theodor Herz, Julius Blum, Aron Sulzbacher, Aron Schnerb und Leo
Weil. Als Lehrer wirkte (bereits seit 1896, damals als Nachfolger von
Lehrer Levy Nußbaum) Isaak Tannenberg (siehe unten Artikel zu Lehrer Tannenberg
anlässlich seines Eintrittes in den Ruhestand 1926). 1932 war 1. Vorsitzender der
Gemeinde Aron Schnerb, 2. Vorsitzender Siegmund Kahn, 3. Vorsitzender Bernhard
Frenkel. Vorsitzender der Repräsentanz war Leo Weil. Als Lehrer und Kantor war
nun - nach der zwischenzeitlichen Tätigkeit von Lehrer Siegmund Friedmann
(1926-1930, wechselte nach Saarbrücken) - Max Jankelowitz tätig. Er erteilte im Schuljahr 1932/33 noch 17 Kindern den
Religionsunterricht. Der Nachfolger von Jankelowitz wurde im Spätherbst 1932
Sigfrid Levy aus Hersfeld. Zur jüdischen Gemeinde gehörten inzwischen auch die in
Hilbringen und Brotdorf wohnenden jüdischen Personen (1932 28 bzw. 26
Personen), nachdem die dortigen Gemeinden aufgelöst worden waren.
1933 lebten noch etwa 200 jüdische Personen in der Stadt (von insgesamt
etwa 10.000 Einwohner). Unter dem zunehmenden Druck der Entrechtung durch die
nationalsozialistische Politik konnte ein großer Teil der jüdischen Einwohner
in den folgenden Jahren auswandern beziehungsweise in andere Städte übersiedeln. Beim
Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört (s.u.).
Von den in Merzig geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leopold Baum (1876), Bella Berl (1888), Berthold Bonnem
(1925), Edith Bonnem (1927), Gustel Bonnem (1903), Marcel Bonnem (1902), Rebecca
Bonnem geb. Hanau (1863), Rudolf Bonnem (1929), Ella Daniel geb. Hayum (1894),
Erwin Felsenthal (1896), Julie (Julia) Frank geb. Weil (1860),
Clara Frenkel (1892), Dora (Sara) Frenkel geb.
Neuberger (1887), Julius Frenkel (1879), Justina Frenkel geb. Schwarz (1860),
Tilla Frenkel (1889), Alfred Hanau (1903), Bernhard Hanau (1865), Elsa Hanau
(1902), Marie Hanau (1875), Mella Hanau geb. Keller (1882), Ottilia (Ottilie) Hanau (1875),
Sara Klara Hanau geb. Mayer (1867, Foto des Grabsteines in Gurs siehe unten), Theresia Hayum (1901), Otto Herz (1877),
Sophronie Herz (1862), Edgar Kahn (1907), Edith Kahn (1924), Hedwig Kahn geb. Rauner
(1883), Hermann Kahn (1901), Ida Kahn geb. Kaufmann (1878), Johanna (Hana) Kahn
(1923), Joseph Kahn (1852), Julius Kahn (1867), Rosa Kahn (1897), Siegmund Kahn
(1894), Karl Kaufmann (1882), Lina Kaufmann geb. Hirsch (1879), Dr. Rafael Kaufmann (1871),
Frieda Koller geb. Benjamin (1900), Kamilla
Levy geb. Levy (1876), Mathilde Levy (1878), Rose (Rosa) Levy (1875), Siegmund
Levy (1865), Richard
Lilienfeld (1889), Julie Markus geb. Hanau (1876), Mina Marx (1868), Rosa Marx geb. Salomon (1897), Germaine
(Lilly) Mayer geb. Kahn (1913), Cécile Mühlstein geb. Berl (1876), Käte
Oppenheim (1909), Werner-Moritz Oppenheimer (1921), Frieda Reinheimer geb.
Grünberg (1884), Paul Reinheimer (1913), Adolf Salomon (1890), Ida Salomon geb.
Kahn (1886), Theodore Salomon (1893), Dr. Ferdinand
Samuels (1883), Isaak Tannenberg (1865), Max Tannenberg (1902), Amalie Tykoschinski geb. Kahn (1888), Mathilde (Tilde) Vredenburg geb. Weil
(1894), Alfred Carl Weil (1873), Hermann Weil (1864), Rosa Wolff geb. Lilienfeld
(1887).
Hinweis: die in einigen Listen genannte Susanne Felsenthal (1873) hat die
Deportation und den Holocaust überlebt. Sie kehrte 1946 nach Merzig zurück und
ist hier 1955 verstorben. Sie wurde auf dem jüdischen Friedhof in Merzig
beigesetzt (Auskunft von Bernd Schirra, Merzig vom 29.10.2013).
Am 20. November 2012 wurden in Merzig erstmals 17 "Stolpersteine"
zur Erinnerung an Opfer der NS-Zeit verlegt.
Eine weitere Verlegung von drei "Stolpersteinen" erfolgte am 22. Februar
2014, die dritte Verlegung in Merzingen am
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Zur Geschichte der
jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet und der
Kultusbeamten 1863 / 1872 / 1874 / 1875 / 1876 / 1886 / 1889 / 1892 / 1911 / 1925 /
1930 / 1932
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1863: "Vakanz. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1863: "Vakanz.
Die hiesige jüdische Gemeinde wünscht bis zum 1. November einen
Elementarlehrer zu engagieren. Fixer Gehalt 180-200 Taler. Zudem bietet
diese Stelle Gelegenheit durch Privatunterricht und Eidesabnahme den
Gehalt bedeutend zu vergrößern.
Darauf Reflektierende wollen ihre Zeugnisse baldigst an den
Unterzeichneten franko einsehen.
Merzig, den 3. September 1863. M. Felsenthal,
Schulvorstand." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1863:
"Die hiesige israelitische Gemeinde wünscht einen Elementarlehrer zu
engagieren, der gleich oder Ostern kommenden Jahres eintreten kann. Fixer
Gehalt 200 Taler, zudem bietet die Stelle Gelegenheit durch Eidesabnahme
und Privatunterricht den Gehalt bedeutend zu vergrößern. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1863:
"Die hiesige israelitische Gemeinde wünscht einen Elementarlehrer zu
engagieren, der gleich oder Ostern kommenden Jahres eintreten kann. Fixer
Gehalt 200 Taler, zudem bietet die Stelle Gelegenheit durch Eidesabnahme
und Privatunterricht den Gehalt bedeutend zu vergrößern.
Reflektanten wollen ihre Zeugnisse franco an den unterzeichneten
Schulvorstand einsenden.
Merzig, den 1. Dezember 1863. M. Felsenthal". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:
"Offene Lehrerstelle. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:
"Offene Lehrerstelle.
In der Synagogen-Gemeinde Merzig an der Saar
ist die Elementar- und Religionslehrerstelle sofort zu besetzen.
Fixer Gehalt 250 Taler. Nebenverdienste 100-120 Taler. Bei entsprechenden
Leistungen Gehaltserhöhung sicher. Bewerber wollen ihre Zeugnisse
einsenden an den Vorstand der Synagogengemeinde Merzig." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874:
"Da der zeitige Elementarlehrer von hier eine Berufung nach dem
Reichslande angenommen, so ist die hiesige Elementar- und
Religionslehrerstelle vakant und sofort zu besetzen. Fixer Gehalt 300
Taler pro anno. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874:
"Da der zeitige Elementarlehrer von hier eine Berufung nach dem
Reichslande angenommen, so ist die hiesige Elementar- und
Religionslehrerstelle vakant und sofort zu besetzen. Fixer Gehalt 300
Taler pro anno.
Zeugnisse umgehend erwünscht. Nebenverdienste je nach Leistungen.
Merzig, den 14. Mai 1874. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu
Merzig an der Saar." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November
1874: "Die Synagogen-Gemeinde zu Merzig Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November
1874: "Die Synagogen-Gemeinde zu Merzig
an der Saar sucht per sofort oder 1. Januar 1875 einen geprüften
Elementar- und Religionslehrer.
Gehalt 900 Mark per anno. Nebenverdienste nach Leistungen.
Der Schul-Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu Merzig a.d. Saar. J. M.
Levy". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1875:
"Die Synagogengemeinde zu Merzig an der Saar sucht einen geprüften,
praktisch und theoretisch gebildeten Elementar- und Religionslehrer.
Gehalt Mark 900. Nebenverdienste je nach Leistungen. Eintritt per 1.
Dezember dieses Jahres. Offerten sind portofrei an den Unterzeichneten
einzusenden. Der Vorstand. B. Salmon Sohn." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1875:
"Die Synagogengemeinde zu Merzig an der Saar sucht einen geprüften,
praktisch und theoretisch gebildeten Elementar- und Religionslehrer.
Gehalt Mark 900. Nebenverdienste je nach Leistungen. Eintritt per 1.
Dezember dieses Jahres. Offerten sind portofrei an den Unterzeichneten
einzusenden. Der Vorstand. B. Salmon Sohn." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1876:
"Die Lehrerstelle an der hiesigen israelitischen Schule ist vakant.
Die Besetzung kann sofort oder auch erst zu Ostern dieses Jahres erfolgen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1876:
"Die Lehrerstelle an der hiesigen israelitischen Schule ist vakant.
Die Besetzung kann sofort oder auch erst zu Ostern dieses Jahres erfolgen.
Bewerber um die Stelle wollen sich längstes in 4 Wochen von heute ab
unter Einsendung eines curriculum vitae, des Prüfungszeugnisses,
der Führungsatteste und der Ausweise über ihre Lehrtätigkeit in den
letzten Jahren an den Unterzeichneten wenden.
Der Gehalt der Stelle beträgt 900 Mark pro Jahr und bietet sich
Gelegenheit zu Nebenverdienst durch Erteilung von Privatunterricht.
Merzig an der Saar, 4. Januar 1876. Für den Schulvorstand: B.
Salmon Sohn." |
| |
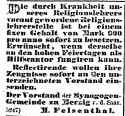 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1886:
"Die durch Krankheit unseres Religionslehrers vakant gewordene
Religionslehrerstelle ist bei einem fixen Gehalt von Mark 900 pro anno
sofort zu besetzen. Erwünscht, wenn derselbe an den hohen Feiertagen als
Hilfskantor fungieren kann. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1886:
"Die durch Krankheit unseres Religionslehrers vakant gewordene
Religionslehrerstelle ist bei einem fixen Gehalt von Mark 900 pro anno
sofort zu besetzen. Erwünscht, wenn derselbe an den hohen Feiertagen als
Hilfskantor fungieren kann.
Reflektierende wollen ihre Zeugnisse sofort an den unterzeichneten
Vorstand einsehenden.
Der Vorstand der Synagogengemeinde zu Merzig an der Saar. M. Felsenthal." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. April 1889: "Anzeigen.
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. April 1889: "Anzeigen.
Die Synagogen-Gemeinde Merzig an der Saar sucht per sofort einen tüchtigen
Religionslehrer,
unverheiratet. Gehalt 800 Mark per anno. Zeugnisse und curriculum vitae
einzusenden an den
Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu Merzig, B.M. Weil,
Vorsitzender." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:
"Da unser Kultusbeamter, welcher 38 Jahre hier tätig war, gestorben
ist, suchen wir einen streng religiösen Kantor, Religionslehrer und
Schochet, der einen geübten Chor leiten kann, musikalisch gebildet ist
und womöglich auch einen Vortrag halten kann, gegen ein Gehalt von 1.800
Mark und noch Nebenverdiensten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:
"Da unser Kultusbeamter, welcher 38 Jahre hier tätig war, gestorben
ist, suchen wir einen streng religiösen Kantor, Religionslehrer und
Schochet, der einen geübten Chor leiten kann, musikalisch gebildet ist
und womöglich auch einen Vortrag halten kann, gegen ein Gehalt von 1.800
Mark und noch Nebenverdiensten.
Offerten und Zeugnisse sind an den Unterzeichneten baldigst
einzusenden.
Der Vorsitzende des Vorstandes: Benzion Weil, Merzig a.d.
Saar." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juni 1911:
"Die hiesige Stelle eines Schochet und Synagogendieners ist
sofort zu besetzen. Gehalt Mark 800.-, außerdem die Einkünfte aus der
Schechitoh, welche bisher Mark 800 bis 1000 betrugen. Offerten von streng
religiösen inländischen Bewerbern, welche im Besitz einer Kaboloh von orthodoxen
Rabbinern sind, an den Vorstand der Synagogengemeinde Merzig an der
Saar. N. Hanau." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juni 1911:
"Die hiesige Stelle eines Schochet und Synagogendieners ist
sofort zu besetzen. Gehalt Mark 800.-, außerdem die Einkünfte aus der
Schechitoh, welche bisher Mark 800 bis 1000 betrugen. Offerten von streng
religiösen inländischen Bewerbern, welche im Besitz einer Kaboloh von orthodoxen
Rabbinern sind, an den Vorstand der Synagogengemeinde Merzig an der
Saar. N. Hanau." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1925:
"Gesucht für 1. September (1925). Seminaristisch gebildeten Kantor
und Religionslehrer, Musikalisch vorgebildet. Bewerber, welche eventuell
Chor leiten können, bevorzugt. Ferner Schochet und Hilfskantor. Vorstand
der Synagogen-Gemeinde Merzig (Saargebiet)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1925:
"Gesucht für 1. September (1925). Seminaristisch gebildeten Kantor
und Religionslehrer, Musikalisch vorgebildet. Bewerber, welche eventuell
Chor leiten können, bevorzugt. Ferner Schochet und Hilfskantor. Vorstand
der Synagogen-Gemeinde Merzig (Saargebiet)." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1925:
"Infolge Pensionierung des seit dreißig Jahren bei uns angestellten Kultusbeamten
suchen wir einen religiösen, seminaristisch gebildeten, stimmbegabten und
oratorisch befähigten Lehrer, Kantor und Schochet. Besoldung nach
den Tarifsätzen im Saargebiet, sowie erhebliche Nebeneinkommen und freie
Wohnung. Offerten mit Zeugnisabschriften, möglichst mit Bild
erbittet Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1925:
"Infolge Pensionierung des seit dreißig Jahren bei uns angestellten Kultusbeamten
suchen wir einen religiösen, seminaristisch gebildeten, stimmbegabten und
oratorisch befähigten Lehrer, Kantor und Schochet. Besoldung nach
den Tarifsätzen im Saargebiet, sowie erhebliche Nebeneinkommen und freie
Wohnung. Offerten mit Zeugnisabschriften, möglichst mit Bild
erbittet
Der Vorstand der Synagogengemeinde Merzig (Saargebiet) N. Hanau,
Vorsitzender." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930:
"Die Synagogengemeinde Merzig (Saar) sucht zum
baldmöglichsten Eintritt einen gesetzestreuen Chasen, Lehrer und
Vorbeter mit seminaristischer und musikalischer Ausbildung. Kabboloh
(= Zertifikat) von einem orthodoxen Rabbiner. Freie Dienstwohnung
vorhandne. Pensionsberechtigung. Offerten mit Bild und Gehaltsansprüchen
sind zu richten an den Vorstand, A. Schnerb." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930:
"Die Synagogengemeinde Merzig (Saar) sucht zum
baldmöglichsten Eintritt einen gesetzestreuen Chasen, Lehrer und
Vorbeter mit seminaristischer und musikalischer Ausbildung. Kabboloh
(= Zertifikat) von einem orthodoxen Rabbiner. Freie Dienstwohnung
vorhandne. Pensionsberechtigung. Offerten mit Bild und Gehaltsansprüchen
sind zu richten an den Vorstand, A. Schnerb." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1932:
"In unserer Gemeinde soll die Stelle eines Vorbeter, Lehrer und
Schochet per 1. Oktober 1932 neu besetzt werden. Es mögen sich
geeignete orthodoxe reichsdeutsche verheiratete Herren melden.
Musikalische Ausbildung erwünscht, aber nicht ausschlaggebend. Die Stelle
ist pensionsberechtigt. Gehalt nach Übereinkunft. Dienstwohnung
vorhanden. Offerten mit Lichtbild und lückenlosem Lebenslauf sind zu
richten an
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1932:
"In unserer Gemeinde soll die Stelle eines Vorbeter, Lehrer und
Schochet per 1. Oktober 1932 neu besetzt werden. Es mögen sich
geeignete orthodoxe reichsdeutsche verheiratete Herren melden.
Musikalische Ausbildung erwünscht, aber nicht ausschlaggebend. Die Stelle
ist pensionsberechtigt. Gehalt nach Übereinkunft. Dienstwohnung
vorhanden. Offerten mit Lichtbild und lückenlosem Lebenslauf sind zu
richten an
Verwaltung der Synagogengemeinde, Merzig - Saar. Aron
Schnerb." |
Zum Abschied von Lehrer E. S. Bonnem (1846, Lehrer in Merzig von 1838 von 1846)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1846: "Nachruf. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1846: "Nachruf.
Wenn jedem löblichen Verdienste seine Krone mit Recht geziemet, so darf
solche dem ernstlich treu beflissenen Jugendlehrer, dem Urbarmacher des
Bodens aller menschlichen Veredlung, dem Pfleger und Bildner des
jugendlichen Herzens und Geistes, wenn er reichlich mit Genie begabt,
treulich sein Amt versieht, gewiss nicht vorenthalten werden. Gebührender
Tribut ist es also, dem an hiesiger israelitischen Schule 8 Jahre lang
gestandenen, im Oktober verflossenen Jahres aus derselben geschiedenen,
nunmehr in Deutz bei Köln fungierenden, wackeren und geschickten
Jugendlehrer, Herrn E. S. Bonnem aus Neumagen an der Mosel, ein im
Interesse der Wahrheit gesprochenes, seinen Verdiensten in dem bereits
errungenen Bildungsgrad unserer zum Teil erwachsenen, teils aber noch
minderreifen Jugend, angemessenes und wohl geziemendes Belobungswort
nachzuschicken. – Von seinem strebsamen Eifer für alles Gemeinnützige,
Schöne und Gute kann die allgemeine Rührung bei seinem Abschiede und das
allseitige Bedauern bei seinem Amtsverlassen den besten Beweis geben. Von
seinen vorzüglichen Leistungen im Amte muss die völlige Zufriedenheit
seiner Schuloberen, welche seine Schule den anderen in unserer Nähe als
Muster anpreisen, das sprechendste Zeugnis liefern. Von seiner
eigentümlichen Kunst, sich bei den Schülern Liebe und Achtung zu
erwerben, zeigt die große Anhänglichkeit seiner ihm in wahrer
Kindesliebe zugetanen Zöglinge, die ihn gar nicht vergessen wollen.
Merzig, den 2. Januar 1846. Vom Schulvorstandsmitglied
Moses Levy." |
Lehrer G. Schnerb bietet für jüdische Schüler
Verpflegung und Unterbringung an (1871)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Auf
mehrseitiges Verlangen bin ich erbötig, wenn sich eine hinlängliche
Schülerzahl bei mir meldet, auswärtige junge Leute, welche hierorts Kost
und Logis haben können, in Bibel, (Tanach), Grammatik, Mischnajot,
Gemara usw. usw. zu unterrichten. Bei täglich 6 Stunden Unterricht
bleibt noch hinlänglich Zeit übrig, sich in anderen Lehrfächern zu
vervollkommnen, wozu die besten Gelegenheiten hier dargeboten sind.
Auskunft wird Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz gefälligst gern
erteilen. Merzig, 4. Juni 1871, 15. Siwan 5631. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Auf
mehrseitiges Verlangen bin ich erbötig, wenn sich eine hinlängliche
Schülerzahl bei mir meldet, auswärtige junge Leute, welche hierorts Kost
und Logis haben können, in Bibel, (Tanach), Grammatik, Mischnajot,
Gemara usw. usw. zu unterrichten. Bei täglich 6 Stunden Unterricht
bleibt noch hinlänglich Zeit übrig, sich in anderen Lehrfächern zu
vervollkommnen, wozu die besten Gelegenheiten hier dargeboten sind.
Auskunft wird Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz gefälligst gern
erteilen. Merzig, 4. Juni 1871, 15. Siwan 5631.
G. Schnerb, Kantor und Kultus-Beamter in Merzig a. Saar." |
Ende der jüdischen Elementarschule und Streit mit der bürgerlichen Gemeinde um
einen Raum für den Religionsunterricht (1878)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1878: "Berlin.
In dem soeben erschienenen sechsten Bericht der Kommission für das
Gemeindewesen über Petitionen erstattet der Abgeordnete Lammstein Bericht
über eine Petition der Vorstandes und des Repräsentantenkollegiums der
Synagogengemeinde zu Merzig in der Rheinprovinz. Dieselben führen an,
dass die Mitglieder der israelitischen Gemeinde daselbst früher eine
besondere Elementarschule aus eigenen Mitteln unterhalten hätten; diese
habe nicht die Rechte einer öffentlichen Schule genossen, sei vielmehr
als eine Privatschule behandelt. Da es der der Synagogengemeinde in
letzterer Zeit schwer geworden, qualifizierte Lehrer zu gewinnen und
dauernd zu erhalten, auch das israelitische Schullokal, welches
Privateigentum der jüdischen Gemeinde sei, den jetzigen Anforderungen
nicht mehr entsprochen und aus Sanitätsrücksichten habe geschlossen
werden müssen, so sei die jüdische Schule durch Verfügung der
Königlichen Regierung zu Trier am 21. März 1876 aufgelöst und seien die
Kinder in die städtischen Schulen verteilt. Da nun der israelitische
Religionsunterricht nicht unter die Elementarfächer aufgenommen sei, so
habe die Synagogengemeinde behufs Erteilung desselben einen Lehrer auf
eigene Kosten engagieren müssen. Gleichzeitig habe sich dieselbe an den
als Lokalschulinspektor fungierenden Bürgermeister der Stadt Merzig mit
dem Ersuchen gewandt, ihr in dem neu erbauten Kommunalschulhause für die
Zeit, wo Unterricht nicht erteilt werde, ein Lokal für den jüdischen
Religionsunterricht zur Disposition zu stellen. Unter dem 7. Juli 1876
habe die Synagogengemeinde den Bescheid erhalten, dass die
Stadtverordneten-Versammlung das Gesuch abgelehnt habe; Gründe seien für
diese Ablehnung nicht angegeben. Auf eine bei dem Landrat erhobene
Beschwerde habe die Königliche Regierung zu Trier den Lokalschulinspektor
beauftragt, der Synagogengemeinde ein Lokal in dem Sinne ihrer Eingabe
anzuweisen. Ein von den Stadtverordneten dagegen verfolgter Rekurs beim
Oberpräsidenten zu Koblenz habe die Aufhebung der Verfügung der
Königlichen Regierung zu Trier zur Folge gehabt. Die Synagogengemeinde
habe sich nunmehr rekurrierend an den Kultusminister gewandt, sei indessen
durch ein von diesem und dem Minister des Inneren gemeinschaftlich
erlassenes Reskript vom 14. Juli 1877 mit ihrem Antrage zurückgewiesen.
Die Petenten beantragen: Das Haus der Abgeordneten wolle das
Staatsministerium veranlassen, unter Aufgebung der Ministerialverfügung
vom 14. April dieses Jahres die israelitischen Einwohner von Merzig für
berechtigt zu erkören, dass der jüdische Religionsunterricht in dem der
Zivilgemeinde gehörigen öffentlichen Elementarschulgebäude erteilt
werde. - Die Kommission beantragte: Übergang zur Tagesordnung." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1878: "Berlin.
In dem soeben erschienenen sechsten Bericht der Kommission für das
Gemeindewesen über Petitionen erstattet der Abgeordnete Lammstein Bericht
über eine Petition der Vorstandes und des Repräsentantenkollegiums der
Synagogengemeinde zu Merzig in der Rheinprovinz. Dieselben führen an,
dass die Mitglieder der israelitischen Gemeinde daselbst früher eine
besondere Elementarschule aus eigenen Mitteln unterhalten hätten; diese
habe nicht die Rechte einer öffentlichen Schule genossen, sei vielmehr
als eine Privatschule behandelt. Da es der der Synagogengemeinde in
letzterer Zeit schwer geworden, qualifizierte Lehrer zu gewinnen und
dauernd zu erhalten, auch das israelitische Schullokal, welches
Privateigentum der jüdischen Gemeinde sei, den jetzigen Anforderungen
nicht mehr entsprochen und aus Sanitätsrücksichten habe geschlossen
werden müssen, so sei die jüdische Schule durch Verfügung der
Königlichen Regierung zu Trier am 21. März 1876 aufgelöst und seien die
Kinder in die städtischen Schulen verteilt. Da nun der israelitische
Religionsunterricht nicht unter die Elementarfächer aufgenommen sei, so
habe die Synagogengemeinde behufs Erteilung desselben einen Lehrer auf
eigene Kosten engagieren müssen. Gleichzeitig habe sich dieselbe an den
als Lokalschulinspektor fungierenden Bürgermeister der Stadt Merzig mit
dem Ersuchen gewandt, ihr in dem neu erbauten Kommunalschulhause für die
Zeit, wo Unterricht nicht erteilt werde, ein Lokal für den jüdischen
Religionsunterricht zur Disposition zu stellen. Unter dem 7. Juli 1876
habe die Synagogengemeinde den Bescheid erhalten, dass die
Stadtverordneten-Versammlung das Gesuch abgelehnt habe; Gründe seien für
diese Ablehnung nicht angegeben. Auf eine bei dem Landrat erhobene
Beschwerde habe die Königliche Regierung zu Trier den Lokalschulinspektor
beauftragt, der Synagogengemeinde ein Lokal in dem Sinne ihrer Eingabe
anzuweisen. Ein von den Stadtverordneten dagegen verfolgter Rekurs beim
Oberpräsidenten zu Koblenz habe die Aufhebung der Verfügung der
Königlichen Regierung zu Trier zur Folge gehabt. Die Synagogengemeinde
habe sich nunmehr rekurrierend an den Kultusminister gewandt, sei indessen
durch ein von diesem und dem Minister des Inneren gemeinschaftlich
erlassenes Reskript vom 14. Juli 1877 mit ihrem Antrage zurückgewiesen.
Die Petenten beantragen: Das Haus der Abgeordneten wolle das
Staatsministerium veranlassen, unter Aufgebung der Ministerialverfügung
vom 14. April dieses Jahres die israelitischen Einwohner von Merzig für
berechtigt zu erkören, dass der jüdische Religionsunterricht in dem der
Zivilgemeinde gehörigen öffentlichen Elementarschulgebäude erteilt
werde. - Die Kommission beantragte: Übergang zur Tagesordnung." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1878: "Merzig,
2. Juni (1878). In der gestrigen Sitzung des Stadtrates kam auf Ersuchen
Königlicher Regierung, die Angelegenheit der hiesigen Synagogengemeinde
um Überlassung eines Lokales im neuen, aus städtischen Mitteln erbauten
Schulhauses, zum Abhalten des jüdischen Religionsunterrichtes zur
Verhandlung. Die Stimmen waren gleich; da gab unser, erst seit circa 3/4
Jahre sich hier im Amte befindender Bürgermeister Herr Reuter, die
entscheidende Stimme zugunsten der hiesigen Synagogengemeinde und im Sinne
der an das Abgeordnetenhaus gerichteten Petition ab. Ich freue mich, Ihnen
hiervon Mitteilung machen zu können und zeichne, hochachtend L..y." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1878: "Merzig,
2. Juni (1878). In der gestrigen Sitzung des Stadtrates kam auf Ersuchen
Königlicher Regierung, die Angelegenheit der hiesigen Synagogengemeinde
um Überlassung eines Lokales im neuen, aus städtischen Mitteln erbauten
Schulhauses, zum Abhalten des jüdischen Religionsunterrichtes zur
Verhandlung. Die Stimmen waren gleich; da gab unser, erst seit circa 3/4
Jahre sich hier im Amte befindender Bürgermeister Herr Reuter, die
entscheidende Stimme zugunsten der hiesigen Synagogengemeinde und im Sinne
der an das Abgeordnetenhaus gerichteten Petition ab. Ich freue mich, Ihnen
hiervon Mitteilung machen zu können und zeichne, hochachtend L..y." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Juni 1878:
"In Merzig ist endlich jüngst das Gesuch der jüdischen
Gemeinde um die Erlaubnis, den Religionsunterricht ihrer Jugend im
städtischen Schulgebäude abhalten zu dürfen, von den Stadtverordneten
bejahend entschieden worden. Hierbei ist jedoch charakteristisch, dass die
Stimmen der Stadtverordneten in gleicher Zahl für Ja und für Nein
abgegeben wurden, sodass nur die Stimme des Vorsitzenden die günstige
Entscheidung herbeiführte." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Juni 1878:
"In Merzig ist endlich jüngst das Gesuch der jüdischen
Gemeinde um die Erlaubnis, den Religionsunterricht ihrer Jugend im
städtischen Schulgebäude abhalten zu dürfen, von den Stadtverordneten
bejahend entschieden worden. Hierbei ist jedoch charakteristisch, dass die
Stimmen der Stadtverordneten in gleicher Zahl für Ja und für Nein
abgegeben wurden, sodass nur die Stimme des Vorsitzenden die günstige
Entscheidung herbeiführte." |
Zum 70. Geburtstag von Lehrer Levy Nußbaum (bis 1896
Lehrer in Merzig)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Köln, 29.
März (1938). Am 3. April vollendete Lehrer i.R., L. Nussbaum, sein 70.
Lebensjahr. Der Jubilar war in Hegenheim im Elsass, in
Merzig und seit
1896 in Bocholt i.W. als Lehrer und Prediger tätig. Während seiner
Amtszeit hat er sich stets für die religiösen Belange eingesetzt und das
Banner der Tora und der Gottesfurcht allezeit hochgehalten. Sein
Erziehungsideal erblickte er darin, seine Schüler zu religiösen Juden zu
erziehen. Von heiligem Eifer für das jüdische Schrifttum beseelt,
widmete er sich täglich dem Talmudstudium. Bis zu seinem Wegzug nach
Köln leitete er die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Lehrer des
Niederrheins. In Verehrung und Dankbarkeit erinnern sich zahlreiche Lehrer
und Schüler seiner segensreichen Tätigkeit. Möge es ihm noch lange
vergönnt sein, in körperlicher und geistiger Frische für die Belange
des konservativen Judentums zu wirken. (Alles Gutes) bis 120." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Köln, 29.
März (1938). Am 3. April vollendete Lehrer i.R., L. Nussbaum, sein 70.
Lebensjahr. Der Jubilar war in Hegenheim im Elsass, in
Merzig und seit
1896 in Bocholt i.W. als Lehrer und Prediger tätig. Während seiner
Amtszeit hat er sich stets für die religiösen Belange eingesetzt und das
Banner der Tora und der Gottesfurcht allezeit hochgehalten. Sein
Erziehungsideal erblickte er darin, seine Schüler zu religiösen Juden zu
erziehen. Von heiligem Eifer für das jüdische Schrifttum beseelt,
widmete er sich täglich dem Talmudstudium. Bis zu seinem Wegzug nach
Köln leitete er die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Lehrer des
Niederrheins. In Verehrung und Dankbarkeit erinnern sich zahlreiche Lehrer
und Schüler seiner segensreichen Tätigkeit. Möge es ihm noch lange
vergönnt sein, in körperlicher und geistiger Frische für die Belange
des konservativen Judentums zu wirken. (Alles Gutes) bis 120." |
| Lehrer Levy Nußbaum
stammte aus Burghaun
bei Fulda (auf dortiger Seite ein weiterer Artikel zu ihm). |
25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer Isaak Tannenberg (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921: "Merzig
a.d. Saar, 3. Mai (1921). Herr Lehrer Isaak Tannenberg, der sich in allen
Kreisen der Bevölkerung großen Ansehens und großer Beliebtheit erfreut,
feierte am 1. April sein 25jähriges Jubiläum als Lehrer der hiesigen
jüdischen Gemeinde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921: "Merzig
a.d. Saar, 3. Mai (1921). Herr Lehrer Isaak Tannenberg, der sich in allen
Kreisen der Bevölkerung großen Ansehens und großer Beliebtheit erfreut,
feierte am 1. April sein 25jähriges Jubiläum als Lehrer der hiesigen
jüdischen Gemeinde." |
Lehrer Isaak Tannenberg geht in den Ruhestand (1926)
Anmerkung: Isaak Tannenberg (geb. 1865 in Schenklengsfeld
als Sohn des Viehhändlers Jonas Tannenberg und der Beile geb. Nussbaum,
umgekommen 1942 im Ghetto Theresienstadt): war von 1896 bis 1926 in Merzig als
Kantor, Schochet und Lehrer tätig. Hier erfüllte er auch die Funktionen eines
Rabbiners und Predigers, da die israelitische Gemeinde in Merzig keinem Rabbinat
unterstellt war. Er war zuletzt in Trier wohnhaft und wurde am 27. Juli 1942 von
Köln nach Theresienstadt deportiert. http://www.saarland-biografien.de/frontend/php/ergebnis_detail.php?id=2600
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1926: "Merzig
(Saargebiet), 15. März (1926). Vergangenen Schabbat veranstaltete
die hiesige Synagogengemeinde einen Festgottesdienst zu Ehren des Herrn
Lehrer Tannenberg, der sich nunmehr nach 40jähriger Dienstzeit in den
wohl verdienten Ruhestand zurückgezogen hat. Dreißig Jahre amtierte Herr
Tannenberg in der hiesigen Gemeinde und stets derselbe durch seine
unermüdliche Pflichttreue und Wohltätigkeit nicht nur innerhalb seiner
Gemeinde, sondern bei allen Mitbürgern unserer Stadt in hohem Ansehen.
Durch sein großes Gottvertrauen ist er uns für alle Zeiten ein
leuchtendes Vorbild. In ergreifender Rede richtete er an seine Gemeinde
die Mahnworte, stets treu zur Tora zu halten. Der nun aus dem Amt
Geschiedene beabsichtigt, seine weiteren Tage gänzlich dem Tora-Studium
zu widmen, und wünschen wir, dass ihm Gott dazu eine Fülle von
Jahren in ungetrübter Gesundheit spenden möge." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1926: "Merzig
(Saargebiet), 15. März (1926). Vergangenen Schabbat veranstaltete
die hiesige Synagogengemeinde einen Festgottesdienst zu Ehren des Herrn
Lehrer Tannenberg, der sich nunmehr nach 40jähriger Dienstzeit in den
wohl verdienten Ruhestand zurückgezogen hat. Dreißig Jahre amtierte Herr
Tannenberg in der hiesigen Gemeinde und stets derselbe durch seine
unermüdliche Pflichttreue und Wohltätigkeit nicht nur innerhalb seiner
Gemeinde, sondern bei allen Mitbürgern unserer Stadt in hohem Ansehen.
Durch sein großes Gottvertrauen ist er uns für alle Zeiten ein
leuchtendes Vorbild. In ergreifender Rede richtete er an seine Gemeinde
die Mahnworte, stets treu zur Tora zu halten. Der nun aus dem Amt
Geschiedene beabsichtigt, seine weiteren Tage gänzlich dem Tora-Studium
zu widmen, und wünschen wir, dass ihm Gott dazu eine Fülle von
Jahren in ungetrübter Gesundheit spenden möge." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1926: "Merzig,
21. März (1926). Eine eindrucksvolle Abschiedsfeier veranstaltete die
israelitische Gemeinde am verflossenen Samstag ihrem aus seinem Amte in
den Ruhestand tretenden Prediger und Religionslehrer Herrn Tannenberg.
Nach Schacharis (Morgengebet) richtete der Vorsitzende des Vorstandes,
Herr N. Hanau, eine längere, tief empfundene Ansprache an denselben. Er
schilderte in warmen Worten seine Verdienste um die Gemeinde während
seiner dreißigjährigen Tätigkeit und dankte ihm für sein segensreiches
Wirken im Namen der Gemeinde und wünschte ihm einen langen und
glücklichen Lebensabend. Hierauf führte er seinen Nachfolge, Herrn
Friedemann in sein Amt ein. Der Vorsitzende der Repräsentanten, Herr
Benny Cahn, feierte darauf Herrn Tannenberg in herzlicher Ansprache.
Sichtlich gerührt, dankte Herr Tannenberg den beiden Herren für die
Ehrung und die freundlichen Worte. Er hielt dann noch eine größere, zu
Herzen gehende Abschiedsrede, worin er besonders hervorhob, wie schwer ihm
das Scheiden aus seinem Amte werde. Er versprach, auch ferner in innigem
Verkehr mit seiner Gemeinde zu bleiben und wünschte ihr ein weiteres
Blühen und Gedeihen. Herr Friedemann, der nunmehr die Funktionen seines
Vorgängers übernommen hatte, hielt zum Schluss eine Antrittsrede, mit
welcher er den Beweis guter oratorischer Befähigung erbrachte." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1926: "Merzig,
21. März (1926). Eine eindrucksvolle Abschiedsfeier veranstaltete die
israelitische Gemeinde am verflossenen Samstag ihrem aus seinem Amte in
den Ruhestand tretenden Prediger und Religionslehrer Herrn Tannenberg.
Nach Schacharis (Morgengebet) richtete der Vorsitzende des Vorstandes,
Herr N. Hanau, eine längere, tief empfundene Ansprache an denselben. Er
schilderte in warmen Worten seine Verdienste um die Gemeinde während
seiner dreißigjährigen Tätigkeit und dankte ihm für sein segensreiches
Wirken im Namen der Gemeinde und wünschte ihm einen langen und
glücklichen Lebensabend. Hierauf führte er seinen Nachfolge, Herrn
Friedemann in sein Amt ein. Der Vorsitzende der Repräsentanten, Herr
Benny Cahn, feierte darauf Herrn Tannenberg in herzlicher Ansprache.
Sichtlich gerührt, dankte Herr Tannenberg den beiden Herren für die
Ehrung und die freundlichen Worte. Er hielt dann noch eine größere, zu
Herzen gehende Abschiedsrede, worin er besonders hervorhob, wie schwer ihm
das Scheiden aus seinem Amte werde. Er versprach, auch ferner in innigem
Verkehr mit seiner Gemeinde zu bleiben und wünschte ihr ein weiteres
Blühen und Gedeihen. Herr Friedemann, der nunmehr die Funktionen seines
Vorgängers übernommen hatte, hielt zum Schluss eine Antrittsrede, mit
welcher er den Beweis guter oratorischer Befähigung erbrachte." |
Hinweis auf den 1926 bis 1930 in Merzig tätigen Lehrer und Kantor Siegmund Friedemann (1902-1984)
 Über
den Lebenslauf von Kantor Siegmund Friedemann informiert ein
französischer Artikel von Joë Friedemann in judaisme.sdv.fr: Link
zu diesem Artikel (auch als
pdf-Datei eingestellt) Über
den Lebenslauf von Kantor Siegmund Friedemann informiert ein
französischer Artikel von Joë Friedemann in judaisme.sdv.fr: Link
zu diesem Artikel (auch als
pdf-Datei eingestellt)
Siegmund Friedemann ist am 3. April 1902 in Altstadt-Hachenburg geboren.
Er ließ sich am "Bildungsseminar für Jüdische Lehrer" in
Hannover ausbilden. Nach abgeschlossenem Studium war er in Camberg
tätig, anschließend in Wallau. 1926
trat er Stelle des Lehrers und Kantors in Merzig an. Hier heiratete
er Herta geb. Kahn. Seit 1930 war er in Saarbrücken tätig. Im Oktober
1936 trat er in den Dienst der Gemeinde von Saverne
(Zabern). Nach dem deutschen Einmarsch folgten Jahre, die durch
Internierung, Flucht und ständige Bedrohung geprägt waren. Seit 1946
wieder im Dienst von Gemeinden im Bereich Elsass-Lothringen: Sarrebourg,
Belfort und Sarreguemines. |
Aus
dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Zur Geschichte
des Synagogenchores s.u. bei der Geschichte der Synagoge
Gründung des Vereins "Talmud Thora" (1865)
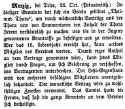 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Dezember 1865:
"Merzig, bei Trier, 26. Oktober (1865). In hiesiger Gemeinde hat sich
ein verein gebildet ‚Talmud Tora’, um durch wöchentliche Vorträge
aus der Tora und den Kommentaren den Inhalt der Tora jedem verständlich
zu machen und die in der Tora gewonnenen Kenntnisse zu befestigen und zu
erweitern. Wer das 16. Lebensjahr erreicht hat, kann aktives Mitglied des
Vereines werden. Damit reger Anteil an dem Vortrage genommen wird, kann
jedes Mitglied durch Fragen, um sich Belehrung zu verschaffen, den
Vortragenden unterbrechen. Der Lehr-Gegenstand wird von mehreren
befähigten Mitgliedern unentgeltlich behandelt. Der monatliche Betrag
wird zu wohltätigen Zwecken verwendet. Das Komitee hatte die Freude, dass
fast die ganze Gemeinde an dem Vereine sich beteiligte." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Dezember 1865:
"Merzig, bei Trier, 26. Oktober (1865). In hiesiger Gemeinde hat sich
ein verein gebildet ‚Talmud Tora’, um durch wöchentliche Vorträge
aus der Tora und den Kommentaren den Inhalt der Tora jedem verständlich
zu machen und die in der Tora gewonnenen Kenntnisse zu befestigen und zu
erweitern. Wer das 16. Lebensjahr erreicht hat, kann aktives Mitglied des
Vereines werden. Damit reger Anteil an dem Vortrage genommen wird, kann
jedes Mitglied durch Fragen, um sich Belehrung zu verschaffen, den
Vortragenden unterbrechen. Der Lehr-Gegenstand wird von mehreren
befähigten Mitgliedern unentgeltlich behandelt. Der monatliche Betrag
wird zu wohltätigen Zwecken verwendet. Das Komitee hatte die Freude, dass
fast die ganze Gemeinde an dem Vereine sich beteiligte." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
1840: in der Wahl der Oberrabbiners sprechen sich Gemeindevertreter von
Saarlouis für Joseph Kahn (Trier) und und gegen Moses Levy (Merzig) aus
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November 1840:
"Saarlouis, 6. Oktober
1840: [Nach unserem schon öfter ausgesprochenen Grundsatze, bei
vorkommenden Wahlen eines geistlichen Oberhauptes, so lange die Wahl noch
nicht festgestellt ist, angemessener Polemik Raum zu geben, um den
Interessenten über die Richtung der Kandidaten, sowie über die
Wichtigkeit der Besetzung ein Urteil zu schaffen, wo hingegen nach
geschehener Wahl nur Fakta zur Sprache kommen dürfen: gestatten wir auch
folgenden, uns zugekommenen Zeilen den Abdruck, Redaktion]. Nach dem
Konkurrenzausschreiben des israelitischen Konsistoriums hoffen wir auf
einen wissenschaftlichen Rabbinen, der den Bedürfnissen der Zeit
entspräche. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November 1840:
"Saarlouis, 6. Oktober
1840: [Nach unserem schon öfter ausgesprochenen Grundsatze, bei
vorkommenden Wahlen eines geistlichen Oberhauptes, so lange die Wahl noch
nicht festgestellt ist, angemessener Polemik Raum zu geben, um den
Interessenten über die Richtung der Kandidaten, sowie über die
Wichtigkeit der Besetzung ein Urteil zu schaffen, wo hingegen nach
geschehener Wahl nur Fakta zur Sprache kommen dürfen: gestatten wir auch
folgenden, uns zugekommenen Zeilen den Abdruck, Redaktion]. Nach dem
Konkurrenzausschreiben des israelitischen Konsistoriums hoffen wir auf
einen wissenschaftlichen Rabbinen, der den Bedürfnissen der Zeit
entspräche.
Diese Hoffnung steigerte sich noch mehr bei uns, als wir mehrere
Rabbinatskandidaten genauen kennen lernten, worunter sich besonders
Herr Kahn durch sein mehrmaliges Auftreten dahier bemerklich machte.
Allein zu unserem Leidwesen erfahren wir nun, dass mehrere Stimmen in
unserer Nähe, sowie in Trier sich zu Gunsten des Rabbinatskandidaten Moses
Levy in Merzig Moses
Levy in Merzig kund geben. Dagegen müssen wir in diesem trefflichen
Organe der israelitischen Angelegenheiten öffentlich protestieren. Denn
so bewanderte derselbe auch im Talmud ist und soweit er es auch in der
spitzfindigen Disputierkunst gebracht hat; so passt derselbe doch
keineswegs 1840 in Preußen an die Spitze der geistlichen Angelegenheiten
eines ganzen Regierungsbezirkes gestellt zu werden. Wie könnte auch ein
Mann, dem jede Sprache außer die des Talmuds, jede Wissenschaft, jede
Grammatik selbst die der hebräischen Sprache unbekannt sind, der daher
ganz folgerichtig neulich bei einer Unterredung mit einem hiesigen Bürger
diejenigen, welche glauben, dass unsere Erde sich um die Sonne bewege (das
kopernikanische System) Kofrim und Apikorsim (Ungläubige und Ketzer)
nannte und zu exkommunizieren kein Bedenken trug, berufen werden, unsere
Schulen zu inspizieren, die Lehrer zu überwachen und überhaupt unserer
Religion auch nur die Achtung erhalten, deren sie bereits schon gewürdigt
wird? Wir bitten daher im Interesse unserer heiligsten Angelegenheiten die
hochlöblichen Behörden, die Notabeln und alle die, welche bei der
bevorstehenden Wahl mitzuwirken imstande sind, sich wenigstens darüber zu
verständigen, dass wir von einer solchen Landplage befreit bleiben. x.y.z." |
Zum Tod von Rabbiner Moses ben Josef Jizchak Levi (Moses
Merzig, 1861)
 Artikel in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. November 1861: "Nachruf.
In Ihrem geschätzten Blatte Nr. 46, haben wir in unserer Chewrat
Gemiluth Chassodim (Wohltätigkeitsverein) am verflossenen Sabbat, den
Schluss der Lebensbeschreibung von unserem Meister und Lehrer Mosche
Sofer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - gelesen.
Unmöglich ist es uns zu sagen, wie diese Biographie uns interessierte,
besonders da wir erst vor 7 Wochen leider einen herben Verlust erlitten,
an unserem hochgeehrten Rabbiner, Vorsteher und Seelsorger, dem großen
Gelehrten, dem Licht Israels, unserem Lehrer und Meister Mosche Sohn des
Lehrers und Meisters (Rabbiner) Josef Jizchak Segal - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen. Tagtäglich empfinden wir immer mehr den
unersetzlichen Verlust - denn, solange der Gerechte in der Stadt ist, ist
er ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit, wenn er aber von dort
weggeht, - so weicht ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit (Raschis
Pentateuchkommentar zu 1. Mose 28,10). Ähnlich in seinem Leben dem in
Ihrem geschätzten Blatte so schön beschrieben Raschi Mosche Sofer - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - war auch sein Sterben, auf den
nämlichen Tag, und zwar am 25. Tschiri dieses Jahres in seinem 58. Jahre,
im Beisein der ganzen Gemeinde von Alt bis Jung. Sein Wirken war in
hiesiger Gemeinde nahe an 40 Jahre. Als Schüler Ihres seligen Vorgängers
und Verwandten, dem verstorbenen, dem großen Gelehrten, dem Ruhm
Israels, unser Meister und Lehrer Herz Schijar - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - des Vorstehers des Rabbinatsgerichtes und der
Jeschiwa der heiligen Gemeinde Mainz, G'tt möge sie beschützen, von
welchem er einer der bedeutendsten und geliebtesten Schüler gewesen (was
heutigen Tages sicher noch in Mainz bekannt sein wird), kam er zurück vollkommen
und kundig in der Tora. Er arbeitete sodann und vervollkommnete sich
auch in weltlichen Kenntnissen, sodass er bald weit und breit berühmt
ward. Viele Talmidim (Schüler), und mehrere die heutzutage (besonders in
Frankreich) auf dem Lehrstuhl sitzen (d.h. Rabbiner sind), wie auch
mehrere Privatgelehrte, haben sich bei ihm ausgebildet. Sie waren ihm wie
seine eigenen Kinder - all seine Söhne, die lernten und so
verehrten sie ihn auch fortwährend, wie bei ihrem Studium, als einen
liebenden Vater. Tag und Nacht war er beschäftigt, seinen Schülern zu
helfen und für die Bedürfnisse der Gemeinde zu sorgen, deren Vorsteher
er war, sogar standen alle Vereine unter seiner Leitung; Lehren
und Briefwechsel über Tora oder (rabbinische) Fragen und
Antworten nach allen Seiten hin; Mahnungen und Zurechtweisungen in
seiner Gemeinde und Umgebung (besser) offene Rüge als verheimlichte Liebe
nahmen den größten Teil seiner Zeit in Anspruch. Für all dieses nahm er
uneigennützig keine Bezahlung, ebenso wies er manche Geschenke zurück.
Edelmütig schlug er sogar Rabbinatsstellen aus, um desto besser seiner
Jeschiwa vorstehen zu können, kurz er war ein Schatz in jeder nur
wünschbaren Art. Gerade wie Reb Mosche Sofer war, auch er von Jugend auf
ein heiliger Mann, ein scharfsinniger, geradsinniger Kopf. Schreiber
dieses können bezeigen, dass er (ein Mann war), der keine vier Ellen
ging ohne Tora zu lernen oder über sie nachzusinnen. Sein Wahlspruch
war: was Du tust, sei zur Ehre des Himmels (G'ttes). Sie werden im
Univers. Isr. vom Monat November einen Nekrolog über ihn gefunden haben,
geschrieben von einem seiner Schüler (Privatmann), welcher 80 Stunden
weit herkam, um seiner Beerdigung beizuwohnen. Ebenso wurde in hiesiger,
wie in den meisten Gemeinden der Umgegend während seiner Krankheit,
Tehillim und Owinu Malkenu für den vielgeliebten und vielgerühmten Rabbi
Mosche Merzig. Kaum war der Tag nach Sukkot-Fest; welcher zugleich
Sabbat Bereschit war, zu Ende, als auch in der Nacht des heiligen
Schabbat, dem 25. Tischri, die ganze Gemeinde um sein Sterbebett
versammelt war. Schon seiner
Sprache Artikel in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. November 1861: "Nachruf.
In Ihrem geschätzten Blatte Nr. 46, haben wir in unserer Chewrat
Gemiluth Chassodim (Wohltätigkeitsverein) am verflossenen Sabbat, den
Schluss der Lebensbeschreibung von unserem Meister und Lehrer Mosche
Sofer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - gelesen.
Unmöglich ist es uns zu sagen, wie diese Biographie uns interessierte,
besonders da wir erst vor 7 Wochen leider einen herben Verlust erlitten,
an unserem hochgeehrten Rabbiner, Vorsteher und Seelsorger, dem großen
Gelehrten, dem Licht Israels, unserem Lehrer und Meister Mosche Sohn des
Lehrers und Meisters (Rabbiner) Josef Jizchak Segal - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen. Tagtäglich empfinden wir immer mehr den
unersetzlichen Verlust - denn, solange der Gerechte in der Stadt ist, ist
er ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit, wenn er aber von dort
weggeht, - so weicht ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit (Raschis
Pentateuchkommentar zu 1. Mose 28,10). Ähnlich in seinem Leben dem in
Ihrem geschätzten Blatte so schön beschrieben Raschi Mosche Sofer - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - war auch sein Sterben, auf den
nämlichen Tag, und zwar am 25. Tschiri dieses Jahres in seinem 58. Jahre,
im Beisein der ganzen Gemeinde von Alt bis Jung. Sein Wirken war in
hiesiger Gemeinde nahe an 40 Jahre. Als Schüler Ihres seligen Vorgängers
und Verwandten, dem verstorbenen, dem großen Gelehrten, dem Ruhm
Israels, unser Meister und Lehrer Herz Schijar - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - des Vorstehers des Rabbinatsgerichtes und der
Jeschiwa der heiligen Gemeinde Mainz, G'tt möge sie beschützen, von
welchem er einer der bedeutendsten und geliebtesten Schüler gewesen (was
heutigen Tages sicher noch in Mainz bekannt sein wird), kam er zurück vollkommen
und kundig in der Tora. Er arbeitete sodann und vervollkommnete sich
auch in weltlichen Kenntnissen, sodass er bald weit und breit berühmt
ward. Viele Talmidim (Schüler), und mehrere die heutzutage (besonders in
Frankreich) auf dem Lehrstuhl sitzen (d.h. Rabbiner sind), wie auch
mehrere Privatgelehrte, haben sich bei ihm ausgebildet. Sie waren ihm wie
seine eigenen Kinder - all seine Söhne, die lernten und so
verehrten sie ihn auch fortwährend, wie bei ihrem Studium, als einen
liebenden Vater. Tag und Nacht war er beschäftigt, seinen Schülern zu
helfen und für die Bedürfnisse der Gemeinde zu sorgen, deren Vorsteher
er war, sogar standen alle Vereine unter seiner Leitung; Lehren
und Briefwechsel über Tora oder (rabbinische) Fragen und
Antworten nach allen Seiten hin; Mahnungen und Zurechtweisungen in
seiner Gemeinde und Umgebung (besser) offene Rüge als verheimlichte Liebe
nahmen den größten Teil seiner Zeit in Anspruch. Für all dieses nahm er
uneigennützig keine Bezahlung, ebenso wies er manche Geschenke zurück.
Edelmütig schlug er sogar Rabbinatsstellen aus, um desto besser seiner
Jeschiwa vorstehen zu können, kurz er war ein Schatz in jeder nur
wünschbaren Art. Gerade wie Reb Mosche Sofer war, auch er von Jugend auf
ein heiliger Mann, ein scharfsinniger, geradsinniger Kopf. Schreiber
dieses können bezeigen, dass er (ein Mann war), der keine vier Ellen
ging ohne Tora zu lernen oder über sie nachzusinnen. Sein Wahlspruch
war: was Du tust, sei zur Ehre des Himmels (G'ttes). Sie werden im
Univers. Isr. vom Monat November einen Nekrolog über ihn gefunden haben,
geschrieben von einem seiner Schüler (Privatmann), welcher 80 Stunden
weit herkam, um seiner Beerdigung beizuwohnen. Ebenso wurde in hiesiger,
wie in den meisten Gemeinden der Umgegend während seiner Krankheit,
Tehillim und Owinu Malkenu für den vielgeliebten und vielgerühmten Rabbi
Mosche Merzig. Kaum war der Tag nach Sukkot-Fest; welcher zugleich
Sabbat Bereschit war, zu Ende, als auch in der Nacht des heiligen
Schabbat, dem 25. Tischri, die ganze Gemeinde um sein Sterbebett
versammelt war. Schon seiner
Sprache |
 beraubt,
zeigte er mit energisch erhobener Hand, man solle laut 'Schema Jisroel'
sagen; und seine Arme blieben aufrecht bis zum Sonnenaufgang...
Sein Bruder, Reb Jeschajahu, ein ein aufrechter und
geradsinniger Lehrer... ging ihm einige Tage voran zur Ruhe. Warum
soll ich beraubt werden eurer Beider an einem Tage? In seinem Testament
verbittet er sich jede Leichenrede, jedoch war der Leichenzug so
großartig, wie man selten einen in hiesiger Gegend erlebt. Aus weitester
Ferne, wohin die traurige Kunde zeitig gelangte, kamen Männer und Frauen
in Masse, um ihn zur Ruhestätte zu geleiten. Die hohen Behörden, sowie
die meisten unserer hiesigen Mitbürger aller Konfessionen gaben durch
Anschluss an den Leichenzug zu erkennen, wie hoch und angesehen dieser
bescheidene, schlichte und anspruchslose Mann bei ihnen war. Auch er
lehrte während seiner Krankheit seine Umgebung täglich Worte der Tora
und Musar (Ethik). Am Fest Simchat Tora, sogar noch am Sabbat
Bereschit, dem 25. Tischri, lehrte er, leider zum letzten Male
über den Wochenabschnitt und schloss mit den Worten. Mose unser
Meister verdiente es, von Angesicht zu Angesicht mit dem göttlichen Geist
(Schechina) zwischen den zwei Kerubim zu sprechen. Die meisten seiner
Manuskripte musste gemäß seinem Testament zu ihm ins Grab gelegt werden.
Ein kleiner Teil jedoch, welchen er nicht dazu bestimmt hatte, ist, Gott
sei Dank, noch vorhanden. Am Schlusse seines Testamentes heißt er wörtlich:
'Meine Kinder sollen zwei Sachen von sich weisen diese heißen:
Unverschämtheit (Chuzpe) und Eitelkeit. Unverschämtheit und Eitelkeit
sind G'tt ein Gräuel. Bescheidenheit und Ehrfurcht führen zu einer Lobpreisung,
diese Worte charakterisieren hinlänglich diesen tiefbetrauerten Mann.
Viele gute und zweckmäßige Einrichtungen haben wir ihm zu verdanken und
unsere spätesten Nachkommen noch werden daran erkennen, welch großer
Mann hier gelegt und gewirkt hatte. Mosche war selbst verdienstvoll und
er führte die Vielen zum Verdienst, daher wird das Verdienst der Menge
ihm beigelegt, wie es heißt: die Gerechtigkeit G'ttes hat er ausgeübt,
und seine Recht waren mit Israel. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens. beraubt,
zeigte er mit energisch erhobener Hand, man solle laut 'Schema Jisroel'
sagen; und seine Arme blieben aufrecht bis zum Sonnenaufgang...
Sein Bruder, Reb Jeschajahu, ein ein aufrechter und
geradsinniger Lehrer... ging ihm einige Tage voran zur Ruhe. Warum
soll ich beraubt werden eurer Beider an einem Tage? In seinem Testament
verbittet er sich jede Leichenrede, jedoch war der Leichenzug so
großartig, wie man selten einen in hiesiger Gegend erlebt. Aus weitester
Ferne, wohin die traurige Kunde zeitig gelangte, kamen Männer und Frauen
in Masse, um ihn zur Ruhestätte zu geleiten. Die hohen Behörden, sowie
die meisten unserer hiesigen Mitbürger aller Konfessionen gaben durch
Anschluss an den Leichenzug zu erkennen, wie hoch und angesehen dieser
bescheidene, schlichte und anspruchslose Mann bei ihnen war. Auch er
lehrte während seiner Krankheit seine Umgebung täglich Worte der Tora
und Musar (Ethik). Am Fest Simchat Tora, sogar noch am Sabbat
Bereschit, dem 25. Tischri, lehrte er, leider zum letzten Male
über den Wochenabschnitt und schloss mit den Worten. Mose unser
Meister verdiente es, von Angesicht zu Angesicht mit dem göttlichen Geist
(Schechina) zwischen den zwei Kerubim zu sprechen. Die meisten seiner
Manuskripte musste gemäß seinem Testament zu ihm ins Grab gelegt werden.
Ein kleiner Teil jedoch, welchen er nicht dazu bestimmt hatte, ist, Gott
sei Dank, noch vorhanden. Am Schlusse seines Testamentes heißt er wörtlich:
'Meine Kinder sollen zwei Sachen von sich weisen diese heißen:
Unverschämtheit (Chuzpe) und Eitelkeit. Unverschämtheit und Eitelkeit
sind G'tt ein Gräuel. Bescheidenheit und Ehrfurcht führen zu einer Lobpreisung,
diese Worte charakterisieren hinlänglich diesen tiefbetrauerten Mann.
Viele gute und zweckmäßige Einrichtungen haben wir ihm zu verdanken und
unsere spätesten Nachkommen noch werden daran erkennen, welch großer
Mann hier gelegt und gewirkt hatte. Mosche war selbst verdienstvoll und
er führte die Vielen zum Verdienst, daher wird das Verdienst der Menge
ihm beigelegt, wie es heißt: die Gerechtigkeit G'ttes hat er ausgeübt,
und seine Recht waren mit Israel. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens.
Merzig, den 21. November 1861. 18. Kislew (5)622.
(Von den geehrten Einsendern aufgefordert, zu konstatieren, ob der zu
früh Verstorbene sich hier noch eines lebhaften Andenkens erfreue und ob
es war sei, dass sein hochberühmter Lehrer, R. Herz Scheuer - das
Andenken des Gerechten und des Heiligen ist zum Segen - vor mehr als
40 Jahren an demselben Tage gestorben, bestätigen wir beides. Die
Redaktion." |
Zum Tod von Moses Weil sen. (1881)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1881: "Merzig
an der Saar. Die hiesige Gemeinde hat durch den Tod des Herrn Moses Weil
sen., der am Montag den 18. vorigen Monats erfolgte, einen schweren
Verlust erlitten. Derselbe, im Alter von 75 Jahren stehend, entstammte
noch jener Zeit, in welcher gewissenhafte Eltern für ihre Kinder nicht
besser sorgen zu können glaubten, als wenn sie dieselben mit einer
gründlichen Torakenntnis ausstattete. Dem entsprechend besuchte der
Verblichene als Jüngling die Jeschiwa zu Straßburg im Elsass und setzte
auch als gereifter Mann sein Torastudium bei R. Moscheh Levy seligen
Andenkens dahier fort. – Jede Mußestunde, die er seiner geschäftlichen
Tätigkeit abgewinnen konnte, war dem Studium unserer heiligen Tora
gewidmet, und selbst in den letzten Jahren seiner Lebens, in welchen ihn
eine langwierige Krankheit ans Haus fesselte, war die Beschäftigung mit
dem Gottesworte sein Trost und seine Freude. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1881: "Merzig
an der Saar. Die hiesige Gemeinde hat durch den Tod des Herrn Moses Weil
sen., der am Montag den 18. vorigen Monats erfolgte, einen schweren
Verlust erlitten. Derselbe, im Alter von 75 Jahren stehend, entstammte
noch jener Zeit, in welcher gewissenhafte Eltern für ihre Kinder nicht
besser sorgen zu können glaubten, als wenn sie dieselben mit einer
gründlichen Torakenntnis ausstattete. Dem entsprechend besuchte der
Verblichene als Jüngling die Jeschiwa zu Straßburg im Elsass und setzte
auch als gereifter Mann sein Torastudium bei R. Moscheh Levy seligen
Andenkens dahier fort. – Jede Mußestunde, die er seiner geschäftlichen
Tätigkeit abgewinnen konnte, war dem Studium unserer heiligen Tora
gewidmet, und selbst in den letzten Jahren seiner Lebens, in welchen ihn
eine langwierige Krankheit ans Haus fesselte, war die Beschäftigung mit
dem Gottesworte sein Trost und seine Freude.
Sein langjähriger Freund und Verwandter, Herr Kantor Schnerb, hielt auf
Grund letztwilliger Bestimmung des Verblichenen die Grabrede, welche der
Bedeutung des Heimgegangenen in beredter, tief empfundener Weise Ausdruck
gab. Sodann sprach Herr Dr. Ehrmann, Rabbiner in Trier, über die
Bedeutsamkeit eines solchen Verlustes gerade in unserer Zeit und unserer
Gegend und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Hinterbliebenen im Sinne
des Verblichenen weiter leben und wirken mögen, und so der Geist des
Heimgegangenen auch nach dessen Tode noch bei den Seinen weiter fortlebe.
- Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Rabbi Chajim Gerson Schnerb (1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892: "Merzig a.
Saar. Soeben geht uns die betrübende Mitteilung von dem Hinscheiden des
Rabbi Chajim Gerson Schnerb – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen – zu. Wir werden in nächster Nummer – so Gott will – die
Verdienste dieses großen Gerechten und Gelehrten eingehend zu würdigen
versuchen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892: "Merzig a.
Saar. Soeben geht uns die betrübende Mitteilung von dem Hinscheiden des
Rabbi Chajim Gerson Schnerb – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen – zu. Wir werden in nächster Nummer – so Gott will – die
Verdienste dieses großen Gerechten und Gelehrten eingehend zu würdigen
versuchen." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1892: "Merzig
an der Saar. Tischa be Aw (9. Aw). Unsere Gemeinde hat am Mittwoch,
den 3. Aw einen Verlust erlitten, für dessen Größe es vielleicht keinen
besseren Maßstab gibt, als der heutige Tag, an dem die ganze jüdische
Diaspora das Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems und des
Tempelheiligtums fastend und trauernd begeht. Rabbi Chajim Gerson Schnerb
(das Andenken an den Gerechten ist zum Segen), ist uns durch den Tod
entrissen worden. Wird doch das Hinscheiden der Gerechten mit der
Einäscherung unseres Nationalheiligtums wiederholt gleichgestellt. Und
wahrlich ein solcher Gerechter war es, den wir, die ganze Gemeinde, die
ganze Gegend und der weit über ihr Weichbild hinausreichende weite Kreis
seiner Freunde und Verehrer verloren. Der Verblichene stammte aus
Lothringen, wenn wir nicht irren, aus Toul – und kam schon als
13jähriger Knabe hierher, um die Jeschiwa des berühmten R.
Moscheh Levy (bekannter unter dem Namen: R. Moscheh-Merzig, Schüler von
R. Herz Scheuer – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen) zu
besuchen. Der Verblichene war ein Urenkel von Rabbi Gerschon Koblenz –
das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – und Enkel von Rabbi Jakob
Koblenz, Verfasser des Sefer Kirjat Hanna. Im 26. Jahre wurde der
Heimatgegangene als Chasan (Vorbeter) der hiesigen Gemeinde angestellt,
und verwaltete dieses Amt 38 Jahre bis zu seinem Ableben mit einer
Hingebung und Meisterschaft, die ihn hoch über das Niveau erhob, auf dem
viele seiner Kollegen stehen. Mit herrlichen Stimmmitteln, mit
gründlichen musikalischen Kenntnissen ausgestattet, besonders aber von
einer innigen Gottesfurcht erfüllt, riss er mit seiner Begeisterung die
Hörer in einer Weise hin, die man selbst miterlebt haben muss, um sie
richtig würdigen zu können. Vieles hat er selbst mit der ihm eigenen
Virtuosität komponiert, und seine Kompositionen haben weit über den
engen kreis seiner Gemeinde hinaus die verdiente Anerkennung gefunden.
Sein Vorbeterdienst war ihm Gegensatz fortgesetzten Studiums, und mit den
Werken unserer synagogalen Tonmeister, wie Naumburg, Sulzer u.a. hatte er
die innigste Vertrautheit. Er hat einen Synagogenchor ins Leben gerufen
und ihn unter unsäglichen Bemühungen zu einer Entwicklung gebracht, die
der größten Gemeinde zur Ehre gereichen würde. Herr Moses Schnerb, der
zweite Sohn des Verblichenen, der zurzeit als Dirigent eines
Synagogenchors fungiert, verdankte seine Ausbildung der väterlichen
Anregung und Leitung. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1892: "Merzig
an der Saar. Tischa be Aw (9. Aw). Unsere Gemeinde hat am Mittwoch,
den 3. Aw einen Verlust erlitten, für dessen Größe es vielleicht keinen
besseren Maßstab gibt, als der heutige Tag, an dem die ganze jüdische
Diaspora das Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems und des
Tempelheiligtums fastend und trauernd begeht. Rabbi Chajim Gerson Schnerb
(das Andenken an den Gerechten ist zum Segen), ist uns durch den Tod
entrissen worden. Wird doch das Hinscheiden der Gerechten mit der
Einäscherung unseres Nationalheiligtums wiederholt gleichgestellt. Und
wahrlich ein solcher Gerechter war es, den wir, die ganze Gemeinde, die
ganze Gegend und der weit über ihr Weichbild hinausreichende weite Kreis
seiner Freunde und Verehrer verloren. Der Verblichene stammte aus
Lothringen, wenn wir nicht irren, aus Toul – und kam schon als
13jähriger Knabe hierher, um die Jeschiwa des berühmten R.
Moscheh Levy (bekannter unter dem Namen: R. Moscheh-Merzig, Schüler von
R. Herz Scheuer – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen) zu
besuchen. Der Verblichene war ein Urenkel von Rabbi Gerschon Koblenz –
das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – und Enkel von Rabbi Jakob
Koblenz, Verfasser des Sefer Kirjat Hanna. Im 26. Jahre wurde der
Heimatgegangene als Chasan (Vorbeter) der hiesigen Gemeinde angestellt,
und verwaltete dieses Amt 38 Jahre bis zu seinem Ableben mit einer
Hingebung und Meisterschaft, die ihn hoch über das Niveau erhob, auf dem
viele seiner Kollegen stehen. Mit herrlichen Stimmmitteln, mit
gründlichen musikalischen Kenntnissen ausgestattet, besonders aber von
einer innigen Gottesfurcht erfüllt, riss er mit seiner Begeisterung die
Hörer in einer Weise hin, die man selbst miterlebt haben muss, um sie
richtig würdigen zu können. Vieles hat er selbst mit der ihm eigenen
Virtuosität komponiert, und seine Kompositionen haben weit über den
engen kreis seiner Gemeinde hinaus die verdiente Anerkennung gefunden.
Sein Vorbeterdienst war ihm Gegensatz fortgesetzten Studiums, und mit den
Werken unserer synagogalen Tonmeister, wie Naumburg, Sulzer u.a. hatte er
die innigste Vertrautheit. Er hat einen Synagogenchor ins Leben gerufen
und ihn unter unsäglichen Bemühungen zu einer Entwicklung gebracht, die
der größten Gemeinde zur Ehre gereichen würde. Herr Moses Schnerb, der
zweite Sohn des Verblichenen, der zurzeit als Dirigent eines
Synagogenchors fungiert, verdankte seine Ausbildung der väterlichen
Anregung und Leitung.
Dabei war der Verblichene ein großer Talmudgelehrter, der jede frei
Mußestunde der Beschäftigung mit unserer heiligen Tora widmete. Man
konnte ihn nicht sehen und sprechen ohne herrliche Goldkörner aus dem
reichen Schatze seines Wissens mit fortzunehmen. Derselbe hatte dabei eine
so Herzgewinnende, klare und fassliche Art der Mitteilung, dass er auch
den Unkundigen für das zu erwärmen vermöchte, was in heller Glut in
seinem Geiste lebte. Noch vor kurzer Zeit hat der Schreiber dieses den
nunmehr uns Entrissenen ersucht, seine herrlichen Bemerkungen und
Erklärungen der Tora niederzuschreiben und sie so der Vergessenheit zu
entreißen. Vieles ist in hebräischen Zeitungen, im Libanon und Hamagid
von ihm erschienen; erst in der jüngsten Pessachnummer des ‚Israelit’,
habe ich von ihm die Erklärung einer schwierigen Stelle aus dem Machsor
schal Pessach veröffentlicht. Derselbe war ein ganz seltener Meister
in der Handhabung der heiligen Sprache, sodass nicht nur der kernige
Gehalt seiner Gedanken, sondern ebenso sehr die vollendete Form der
Darstellung in jeder Zeile den tiefen Denker und vollendeten Stilisten
bekundeten.
Dabei war er Schochet, Lehrer, Mohel (Beschneider), und hatte für alles
Zeit, Sinn, Begabung und Hingebung, und bewährte sich als genialer
Meister, in allem, was er in seine Hand nahm. Die Heiterkeit, die |
 Lebensfreude
und die selbstlose Bescheidenheit, an diese und an unzählige Vorzüge des
Geistes und Herzens, die den edlen Mann auszeichneten, kann man nicht
denken, ohne in den Klageruf auszubrechen… Lebensfreude
und die selbstlose Bescheidenheit, an diese und an unzählige Vorzüge des
Geistes und Herzens, die den edlen Mann auszeichneten, kann man nicht
denken, ohne in den Klageruf auszubrechen…
Es bedarf nicht erst der Versicherung, wie die Würdigung und Anerkennung
desselben Mannes, den wir verloren, sich nicht auf die hiesige Gemeinde
beschränkte. Die ‚Merziger Zeitung’ berichtet darüber: ‚Heute
Nachmittag wird einer der geachtetsten Bürger unserer Stadt in den
kühlen Schoß der Erde gebettet. Herr G. Schnerb war seit 1854 Kantor der
israelitischen Gemeinde Merzig und hat seine 38-jährige Amtszeit in Demut
und Bescheidenheit verbracht. Er war in seiner Herzensgüte und edlen
Gesinnung der Freund, Ratgeber und Helfer so manches Bedrängten und hat
sich durch seine Opferwilligkeit und Mildtätigkeit große Liebe und
Achtung wohl all seiner Mitbürger, wes Glaubens sie auch sein mögen,
erworben. Die Teilnahme an dem Leichenzuge wird dies gewiss bestätigen.
Der Heimgegangene ruhe in ewigem Frieden!’
’Wohl selten hat unsere Stadt ein solches Trauergefolge gesehen, als
gestern bei der Beerdigung des allverehrten Kantors Herrn G. Schnerb, der,
wie bereits in voriger Nummer mitgeteilt, im Alter von 64 Jahren uns durch
den Tod entrissen wurde. Genoss der Verewigte durch seine Leutseligkeit
die Liebe und Hochachtung aller Derer, die ihn kennen und schätzen
gelernt, so fand diese ihnen unerkennbaren Ausdruck erst recht in der
allgemeinen Teilnahme an dem Leichenbegängnis; denn ohne Unterschied des
Bekenntnisses eilte Jeder in dem Gefühle herbei, dass er einen Mann zu
Grabe geleite, dem gleich es heute nur wenige gibt. Wie sehr der
Verblichene geehrt wurde, beweist der Umstand, dass alle seine
Glaubensgenossen in hiesiger Stadt während des Leichenbegängnisses ihre
Läden geschlossen hielten. In bewegten Worten, seiner Rührung kaum
mächtig, sprach als erster am grabe, im Auftrage der Gemeinde, Herr Dr.
Bassfreund, Rabbiner zu Trier. Nach ihm sprachen noch die Herren Michael
Levy und Dr. Blumenstein aus Luxemburg, als langjährige Freunde des
Verewigten. Seine zahlreichen Verehrer werden ihm ein dankbares Andenken
bewahren.’
Der Verblichene hinterlässt eine tief trauernde Gattin, die Tochter
seines großen Lehrers, welche in 37jähriger, überaus glücklicher Ehe
mit ihm verbunden war, sowie 4 Söhne und Töchter, die sämtlich würdige
Kinder des heimgegangenen, unvergesslichen Vaters sind und es gewiss für
alle Zeit bleiben werden. Der Name ihres teueren Vaters, den sie in Ehren
tragen, wird ihnen ein Geleitsbrief an die Teilnahme und Achtung aller
braven Menschen sein. Möge der himmlische Vater der trauernden Familie
Trost, der Gemeinde einen würdigen Ersatz und dem Verblichenen den
himmlischen Frieden für sein reiches Leben und Wirken gewähren! Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zur Goldenen Hochzeit von Moses Weil und Karoline geb.
Lion (1895)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1895: "Merzig,
23. Juni (1895). Am gestrigen Schabbat, Paraschat Korach, feierte das hier
sehr geachtete und beliebte Ehepaar Moses Weil und Karoline geb. Lion das
seltene Fest seines 50jährigen Ehejubiläums in körperlicher und
geistiger Frische und blühender Gesundheit. Obwohl sich die greisen
Eheleute in bescheidener Weise jede offizielle Feier verbeten, erschienen
dennoch alle ihre Kinder nebst Familien aus Nah und Fern, um persönlich
Glückwünsche und Geschenke zu überreichen. Ihnen schlossen sich eine
große Anzahl von Freunden und Bekannten innerhalb der jüdischen Gemeinde
an. Um 11 Uhr erschienen der Landrat und der Bürgermeister, um im Namen
Seiner Majestät dem Ehepaare die silberne Jubiläumsmedaille nebst einem
Begleitschreiben aus dem Zivilkabinett des Kaisers zu überreichen.
Nachdem Herr Landrat diesen allerhöchsten Auftrag in feierlichster und
wahrhaft herzlichster Weise ausgeführt hatte, dankte Herr Weil, sichtlich
gerührt, für die seiner Gattin und ihm erwiesene hohe Ehre und brachte
ein begeisterte Hoch auf Seine Majestät aus. Hierauf hielt der Lehrer der
jüdischen Gemeinde, Herr Nußbaum, eine beifällig aufgenommene
Ansprache, in welcher er das Paar als Muster echt jüdischer,
gottesfürchtiger, fleißiger und rechtschaffener Eheleute kennzeichnete
und ihm die besten Wünsche namens der jüdischen Gemeinde, deren Stolz
das Jubelpaar ist, entgegenbrachte. Er hob ferner hervor, dass Herr M.
Weil trotz seiner 78 Jahre keinen Gottesdienst weder an Sabbaten und
Feiertagen noch an Werktagen versäumt, dass er während einer langen
Reihe von Jahren in uneigennützigster Weise die Interessen der Gemeinde
als Vorsteher gewahrt und sich bei Hoch und Niedrig einen guten Ruf und
einen ehrwürdigen Namen zu verschaffen gewusst hat. Darum ist aber auch
seine Familie eine von Gott besonders begnadete. Einzig dastehen dürfte
wohl die Tatsche, dass die Mutter der Jubilarin noch lebt (in Spiesen bei
Neunkirchen, ist über 100 Jahre alt), dass Herr Weil trotz seines Alters
ohne Augenglas geläufig liest und dass es seinen Kindern, Enkeln und
Urenkeln ohne Ausnahme gut geht. Redner schloss mit dem Wunsche ‚noch in
hohem Alter mögen sie kräftig sein, frisch und grün wie die Palme’,
möge es den greisen Eheleuten vergönnt sein, in gleicher Jugendfrische
das Fest der diamantenen Hochzeit zu feiern. Das walte Gott!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1895: "Merzig,
23. Juni (1895). Am gestrigen Schabbat, Paraschat Korach, feierte das hier
sehr geachtete und beliebte Ehepaar Moses Weil und Karoline geb. Lion das
seltene Fest seines 50jährigen Ehejubiläums in körperlicher und
geistiger Frische und blühender Gesundheit. Obwohl sich die greisen
Eheleute in bescheidener Weise jede offizielle Feier verbeten, erschienen
dennoch alle ihre Kinder nebst Familien aus Nah und Fern, um persönlich
Glückwünsche und Geschenke zu überreichen. Ihnen schlossen sich eine
große Anzahl von Freunden und Bekannten innerhalb der jüdischen Gemeinde
an. Um 11 Uhr erschienen der Landrat und der Bürgermeister, um im Namen
Seiner Majestät dem Ehepaare die silberne Jubiläumsmedaille nebst einem
Begleitschreiben aus dem Zivilkabinett des Kaisers zu überreichen.
Nachdem Herr Landrat diesen allerhöchsten Auftrag in feierlichster und
wahrhaft herzlichster Weise ausgeführt hatte, dankte Herr Weil, sichtlich
gerührt, für die seiner Gattin und ihm erwiesene hohe Ehre und brachte
ein begeisterte Hoch auf Seine Majestät aus. Hierauf hielt der Lehrer der
jüdischen Gemeinde, Herr Nußbaum, eine beifällig aufgenommene
Ansprache, in welcher er das Paar als Muster echt jüdischer,
gottesfürchtiger, fleißiger und rechtschaffener Eheleute kennzeichnete
und ihm die besten Wünsche namens der jüdischen Gemeinde, deren Stolz
das Jubelpaar ist, entgegenbrachte. Er hob ferner hervor, dass Herr M.
Weil trotz seiner 78 Jahre keinen Gottesdienst weder an Sabbaten und
Feiertagen noch an Werktagen versäumt, dass er während einer langen
Reihe von Jahren in uneigennützigster Weise die Interessen der Gemeinde
als Vorsteher gewahrt und sich bei Hoch und Niedrig einen guten Ruf und
einen ehrwürdigen Namen zu verschaffen gewusst hat. Darum ist aber auch
seine Familie eine von Gott besonders begnadete. Einzig dastehen dürfte
wohl die Tatsche, dass die Mutter der Jubilarin noch lebt (in Spiesen bei
Neunkirchen, ist über 100 Jahre alt), dass Herr Weil trotz seines Alters
ohne Augenglas geläufig liest und dass es seinen Kindern, Enkeln und
Urenkeln ohne Ausnahme gut geht. Redner schloss mit dem Wunsche ‚noch in
hohem Alter mögen sie kräftig sein, frisch und grün wie die Palme’,
möge es den greisen Eheleuten vergönnt sein, in gleicher Jugendfrische
das Fest der diamantenen Hochzeit zu feiern. Das walte Gott!" |
Zum Tod von Moses Weil jun. (1904)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1904: "Merzig, 6.
Dezember (1904). Durch das Hinscheiden des Herrn Moses Weil dahier, ist
unsere Gemeinde von einem schweren Verluste betroffen worden. Anlässlich
des Todes dieses Biedermanns schreibt das hiesige Kreisblatt: ‚Herr
Rentner Moses Weil, einer der ältesten und geachtetsten Bürger unserer
Kreisstadt, ist gestern in die Ewigkeit abberufen worden. Die seelische
Empfindung über den kürzlichen Verlust seiner geliebten Gattin, mit
welcher er viele lange Jahre Leid und Freud geteilt, hat den alten Herrn
aufs Sterbelager gebracht. Das nun in Gott ruhende Ehepaar Weil feierte im
Jahre 1895 seine goldene Hochzeit, wobei ihm durch den Herrn Landrat die
goldene Ehejubiläums-Medaille überreicht wurde. Im Juni nächsten Jahres
sollte das noch seltenere Fest der diamantenen Hochzeit gefeiert werden.
Gott hat es anders gewollt.’ Der Dahingeschiedene erfreute sich in allen
Schichten der Bevölkerung allgemeiner Achtung und Beliebtheit durch sein
freundliches, zuvorkommendes Wesen gegen Jedermann, durch sein strenges,
von ihm stets betätigtes Rechtlichkeitsgefühl. Mit dem Tode des
Verblichenen, der sich durch echte, ungeheuchelte Frömmigkeit
auszeichnete, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Zierde unserer
Gemeinde, deren Vorsteher er 24 Jahre war, ins Gab gesunken. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. T." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1904: "Merzig, 6.
Dezember (1904). Durch das Hinscheiden des Herrn Moses Weil dahier, ist
unsere Gemeinde von einem schweren Verluste betroffen worden. Anlässlich
des Todes dieses Biedermanns schreibt das hiesige Kreisblatt: ‚Herr
Rentner Moses Weil, einer der ältesten und geachtetsten Bürger unserer
Kreisstadt, ist gestern in die Ewigkeit abberufen worden. Die seelische
Empfindung über den kürzlichen Verlust seiner geliebten Gattin, mit
welcher er viele lange Jahre Leid und Freud geteilt, hat den alten Herrn
aufs Sterbelager gebracht. Das nun in Gott ruhende Ehepaar Weil feierte im
Jahre 1895 seine goldene Hochzeit, wobei ihm durch den Herrn Landrat die
goldene Ehejubiläums-Medaille überreicht wurde. Im Juni nächsten Jahres
sollte das noch seltenere Fest der diamantenen Hochzeit gefeiert werden.
Gott hat es anders gewollt.’ Der Dahingeschiedene erfreute sich in allen
Schichten der Bevölkerung allgemeiner Achtung und Beliebtheit durch sein
freundliches, zuvorkommendes Wesen gegen Jedermann, durch sein strenges,
von ihm stets betätigtes Rechtlichkeitsgefühl. Mit dem Tode des
Verblichenen, der sich durch echte, ungeheuchelte Frömmigkeit
auszeichnete, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Zierde unserer
Gemeinde, deren Vorsteher er 24 Jahre war, ins Gab gesunken. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. T." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember
1904: "Merzig a. Saar. Hier verschied der Rentner Moses Weil, ein
Mann, der sich durch echte Frömmigkeit auszeichnete und allgemein die
höchste Wertschätzung genoss. Er war während eines Zeitraumes von 24
Jahren der Vorsteher der jüdischen Gemeinde. 1895 hatte er das Glück,
seine goldene Hochzeit zu feiern." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember
1904: "Merzig a. Saar. Hier verschied der Rentner Moses Weil, ein
Mann, der sich durch echte Frömmigkeit auszeichnete und allgemein die
höchste Wertschätzung genoss. Er war während eines Zeitraumes von 24
Jahren der Vorsteher der jüdischen Gemeinde. 1895 hatte er das Glück,
seine goldene Hochzeit zu feiern." |
Anzeige zum Tod von Sigismund Mokrauer
(1922)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1922: "Nachruf.
Verspätet erreicht uns die Trauerkunde von dem Ableben des teueren Herrn
Sigismund Mokrauer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen -.
Fern der lieben Heimat hat er uns jüdischen Soldaten in seinem gastlichen
Hause im Verein mit seinen Lieben eine zweite Heimat gewährt. -
Unvergesslich sind uns die Stunden, insbesondere die Feiertage, die uns
auch in Feindesland den echt jüdischen Geist nicht missen ließen. In
Dankbarkeit werden wir dem verblichenen weit über das Grab hinaus ein
dauerndes Andenken bewahren. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Mai 1922: "Nachruf.
Verspätet erreicht uns die Trauerkunde von dem Ableben des teueren Herrn
Sigismund Mokrauer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen -.
Fern der lieben Heimat hat er uns jüdischen Soldaten in seinem gastlichen
Hause im Verein mit seinen Lieben eine zweite Heimat gewährt. -
Unvergesslich sind uns die Stunden, insbesondere die Feiertage, die uns
auch in Feindesland den echt jüdischen Geist nicht missen ließen. In
Dankbarkeit werden wir dem verblichenen weit über das Grab hinaus ein
dauerndes Andenken bewahren.
Im Auftrage vieler jüdischer Kameraden: Aron Rauner, Merzig an der
Saar - Ernst Kaufmann, Merzig an der Saar - Ludwig Strauß - Edenkoben
(Pfalz)." |
Todesanzeige für Isaac Rauner (1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. April 1925:
"Heute entschlief nach kurzem Leiden, unerwartet, mein lieber Gatte,
unser guter Vater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel Herr Isaac
Rauner im 70. Lebensjahre. Die trauernden Hinterbliebenen in deren
Namen Mirjam Rauner geb. Schnerb. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. April 1925:
"Heute entschlief nach kurzem Leiden, unerwartet, mein lieber Gatte,
unser guter Vater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel Herr Isaac
Rauner im 70. Lebensjahre. Die trauernden Hinterbliebenen in deren
Namen Mirjam Rauner geb. Schnerb.
Merzig (Saar), 21. April 1925." |
Über Dr. Martin Cohn (geb. 1897 in Merzig, seit 1930
Gemeindeverwalter in Stuttgart)
Anmerkung: der 1897 in Merzig geborene Dr. Martin Cohn war seit 1930
zunächst "Stellvertretender Gemeindepfleger", seit 1931
Gemeindepfleger (= Gemeindeverwalter) der jüdischen Gemeinde in Stuttgart.
Vgl. Stuttgarter Passakten http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2636198
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1930: "Stuttgart. Von den 44
Bewerbern um die Stelle des leitenden Beamten unserer Gemeindeverwaltung
waren zwei derselben in engste Wahl gekommen. Nachdem die Verhandlungen
mit dem zunächst in Aussicht genommenen Bewerber sich zerschlagen haben,
vereinigten sich alle Stimmen des Vorsteheramts auf Dr. phil. Martin
Cohn in Saarbrücken Dr. Cohn ist am 20. Juni 1897 zu Merzig
a.d.Saar geboren. Mit dem Reifezeugnis der Oberrealschule in Bochum
trat er 1916 in den Heeresdienst und war bis zum Schluss des Krieges im
Feld. Hierauf studierte er in Münster und Breslau neue Sprachen,
Hebräisch und Philosophie. 1922 promovierte er an der Universität
Breslau zum Dr.phil., besuchte dann noch ein Jahr lang die Handelshochschule
Berlin und betätigte sich hierauf bis zum Jahr 1925 im kaufmännischen
Geschäft seines Vaters. Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1930: "Stuttgart. Von den 44
Bewerbern um die Stelle des leitenden Beamten unserer Gemeindeverwaltung
waren zwei derselben in engste Wahl gekommen. Nachdem die Verhandlungen
mit dem zunächst in Aussicht genommenen Bewerber sich zerschlagen haben,
vereinigten sich alle Stimmen des Vorsteheramts auf Dr. phil. Martin
Cohn in Saarbrücken Dr. Cohn ist am 20. Juni 1897 zu Merzig
a.d.Saar geboren. Mit dem Reifezeugnis der Oberrealschule in Bochum
trat er 1916 in den Heeresdienst und war bis zum Schluss des Krieges im
Feld. Hierauf studierte er in Münster und Breslau neue Sprachen,
Hebräisch und Philosophie. 1922 promovierte er an der Universität
Breslau zum Dr.phil., besuchte dann noch ein Jahr lang die Handelshochschule
Berlin und betätigte sich hierauf bis zum Jahr 1925 im kaufmännischen
Geschäft seines Vaters.
Seit 1925 ist Dr. Cohn in der Leitung des statistischen Amts der
Regierungskommission des Saargebiets tätig.
Dr. Cohn wird sein Amt am 4. Juni dieses Jahres antreten. Er ist
vorläufig auf ein Probejahr angestellt und führt während dieser Zeit
die Amtsbezeichnung 'Stellvertretender Gemeindepfleger'.
Möge die Wahl unserer Gemeinde zum Segen gereichen!" |
Zum Tod der Frau von Daniel Weil (1926)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Merzig,
20. Dezember (1926). Am zweiten Chanukka-Tage wurde hier im hohen Alter
von 94 ½ Jahren die älteste Einwohnerin unserer Stadt, die verwitwete
Frau Daniel Weil, zu Grabe getragen. Trotz ihres hohen Alters erfreute sie
sich einer selten geistigen und körperlichen Rüstigkeit. Sie versah
ihren religiösen Haushalt in mustergültiger Weise und verstand es durch
ihre selbstlose Gastfreundschaft, ihr Haus zum Kulminationspunkt unserer Kehillo
(Gemeinde) zu machen. Ihr Tod hinterlässt, außer bei ihren Kindern, auch
in unserer Gemeinde eine große Lücke. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Merzig,
20. Dezember (1926). Am zweiten Chanukka-Tage wurde hier im hohen Alter
von 94 ½ Jahren die älteste Einwohnerin unserer Stadt, die verwitwete
Frau Daniel Weil, zu Grabe getragen. Trotz ihres hohen Alters erfreute sie
sich einer selten geistigen und körperlichen Rüstigkeit. Sie versah
ihren religiösen Haushalt in mustergültiger Weise und verstand es durch
ihre selbstlose Gastfreundschaft, ihr Haus zum Kulminationspunkt unserer Kehillo
(Gemeinde) zu machen. Ihr Tod hinterlässt, außer bei ihren Kindern, auch
in unserer Gemeinde eine große Lücke. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Moses Schnerb (gest. 1937 in Frankfurt)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1937 (der
Artikel ist in unteren Drittel über mehrere Zeilen nicht vollständig
lesbar):
"Moses Schnerb
– das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen. Eine markante und ungemein
populäre Persönlichkeit schied aus unserem Kreise im Alter von bald 74
Jahren mit Moses Schnerb. Wenn er auch in den letzten Jahren vom Geschäft
und von der Öffentlichkeit zurückgezogen lebte, behielt doch der Name
Moses Schnerb seinen guten alten Klang, und wer ihn besuchte und mit dem
vielfach und fein gebildeten Manne sich unterhielt, ging bereichert von
dannen. Aus Merzig kam Moses Schnerb, einer Gelehrtenfamilien entstammend,
in ganz jungen Jahren hierher und fand in der S.R. Hirsch – Gemeinde
bald seine geistige Heimat. Viele Jahrzehnte war er Teilhaber des Münzengeschäftes
der Firma Leo Hamburger und er erreichte mit seinen natürlichen Gaben und
seinem wissenschaftlichem Interesse bald den Ruf eines hervorragenden
Sach- und Fachkenners auf diesem gebiete. Er war in der Währungs- und Münzengeschichte
der alten Welt so bewandert, dass die von ihm an Interessenten erteilten
Auskünfte sich zuweilen unter der Hand zu erschöpfenden Referaten
ausbauten. Aber der Kunstverständige und Kaufmann, der Torakundige und
der gehämmerte Jehudi besaß auch hervorragende musikalische Kenntnisse,
die er in den Dienst seiner Gemeinde und seiner Synagoge stellte. Lange
Jahre führte er ehrenamtlich den Dirigentenstab im Synagogenchore der
Israelitischen Religionsgesellschaft, und er komponierte eine Reihe von
Synagogengesängen zum Preise Gottes, die sich durch Harmonie und Inbrunst
auszeichnen und in unserer Synagoge sowohl wie auch in anderen Gemeinden
bald heimisch wurden. Aus einer harmonischen Seele kam all das, war Moses
Schnerb gab und tat, auch die liebenswürdige Art, mit den Menschen
umzugehen und all das, was wir an ihm so schätzten. …
das er mit der gleich gearteten, ihm schon vor Jahren in den Tod
vorangegangenen Gattin … wuchsen Kinder in einer feingeistigen und …
Atmosphäre heran (der ältere Sohn praktiziert als Arzt in Frankfurt und
der jüngere betätigt sich als Chemiker in Erez Israel), die das geistige
Erbe der Eltern hüten und mehren. Viele durften Moses Schnerb ihren
Freund nennen, und wir alle werden ihm ein liebes und ehrenvolles Andenken
bewahren. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1937 (der
Artikel ist in unteren Drittel über mehrere Zeilen nicht vollständig
lesbar):
"Moses Schnerb
– das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen. Eine markante und ungemein
populäre Persönlichkeit schied aus unserem Kreise im Alter von bald 74
Jahren mit Moses Schnerb. Wenn er auch in den letzten Jahren vom Geschäft
und von der Öffentlichkeit zurückgezogen lebte, behielt doch der Name
Moses Schnerb seinen guten alten Klang, und wer ihn besuchte und mit dem
vielfach und fein gebildeten Manne sich unterhielt, ging bereichert von
dannen. Aus Merzig kam Moses Schnerb, einer Gelehrtenfamilien entstammend,
in ganz jungen Jahren hierher und fand in der S.R. Hirsch – Gemeinde
bald seine geistige Heimat. Viele Jahrzehnte war er Teilhaber des Münzengeschäftes
der Firma Leo Hamburger und er erreichte mit seinen natürlichen Gaben und
seinem wissenschaftlichem Interesse bald den Ruf eines hervorragenden
Sach- und Fachkenners auf diesem gebiete. Er war in der Währungs- und Münzengeschichte
der alten Welt so bewandert, dass die von ihm an Interessenten erteilten
Auskünfte sich zuweilen unter der Hand zu erschöpfenden Referaten
ausbauten. Aber der Kunstverständige und Kaufmann, der Torakundige und
der gehämmerte Jehudi besaß auch hervorragende musikalische Kenntnisse,
die er in den Dienst seiner Gemeinde und seiner Synagoge stellte. Lange
Jahre führte er ehrenamtlich den Dirigentenstab im Synagogenchore der
Israelitischen Religionsgesellschaft, und er komponierte eine Reihe von
Synagogengesängen zum Preise Gottes, die sich durch Harmonie und Inbrunst
auszeichnen und in unserer Synagoge sowohl wie auch in anderen Gemeinden
bald heimisch wurden. Aus einer harmonischen Seele kam all das, war Moses
Schnerb gab und tat, auch die liebenswürdige Art, mit den Menschen
umzugehen und all das, was wir an ihm so schätzten. …
das er mit der gleich gearteten, ihm schon vor Jahren in den Tod
vorangegangenen Gattin … wuchsen Kinder in einer feingeistigen und …
Atmosphäre heran (der ältere Sohn praktiziert als Arzt in Frankfurt und
der jüngere betätigt sich als Chemiker in Erez Israel), die das geistige
Erbe der Eltern hüten und mehren. Viele durften Moses Schnerb ihren
Freund nennen, und wir alle werden ihm ein liebes und ehrenvolles Andenken
bewahren. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1937: "Heute
verschied nach langem, geduldig getragenem Leiden, unser lieber Vater Herr
Moses Schnerb – das Andenken
an den Gerechten ist zum Segen – im 74. Lebensjahre. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1937: "Heute
verschied nach langem, geduldig getragenem Leiden, unser lieber Vater Herr
Moses Schnerb – das Andenken
an den Gerechten ist zum Segen – im 74. Lebensjahre.
Frankfurt am Main, Röderbergweg 93, Jerusalem, den 25. Adar 5697 / 8. März
1937.
Im Namen der in Trauer Hinterbliebenen: Dr. med. G. Schnerb." |
Erinnerung an die Deportationen in der NS-Zeit in das
südfranzösische Internierungslager in Gurs - Grabstein für Sara Hanau geb.
Mayer aus Merzig
 Grabstein
im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für Grabstein
im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für
Sara Hanau geb. Mayer,
geb. am 22. September 1867 in Laufersweiler, später wohnhaft in
Merzig;
am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert, wo sie am 31. Dezember 1940
umgekommen ist. |
Anzeigen jüdischer
Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Lehrlingsgesuch von Metzger B. Benjamin (1872)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1872: "Ich
suche einen aus guter Familie stammenden, gesunden und kräftigen Lehrling
(Israelit) in mein am Sabbat und an Feiertagen geschlossenes
Metzgerei-Geschäft. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1872: "Ich
suche einen aus guter Familie stammenden, gesunden und kräftigen Lehrling
(Israelit) in mein am Sabbat und an Feiertagen geschlossenes
Metzgerei-Geschäft.
Merzig a.d. Saar, 26. Januar 1872. B.
Benjamin". |
Matzenmaschine zu verkaufen (1873)
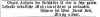 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. September
1873: Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. September
1873:
"Wegen Aufgabe des Geschäftes ist eine in sehr gutem Zustande
befindliche Matzenmaschine zu verkaufen.
Näheres bei Witwe Israel Berl, Merzig a. Saar". |
Lehrlingssuchen des Kolonial-Waren-Geschäfts M. Weil jr. (1885 / 1890 / 1897 / 1901)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. April
1885: "Lehrlingsgesuch. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. April
1885: "Lehrlingsgesuch.
Ein junger Mann mit guten Schulkenntnissen und guter Handschrift, findet
sofort Stelle unter sehr günstigen Bedingungen in dem Kolonialwarengeschäft
en gros und en detail von
M. Weil jun., Merzig a. Saar, Rheinpreußen." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Dezember 1890: "Lehrlings-Gesuch. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Dezember 1890: "Lehrlings-Gesuch.
Ein tüchtiger, junger Mann aus guter Familie, mit guter Schulbildung
versehen, kann sofort unter günstigen Bedingungen als Lehrling bei mir
eintreten. Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im
Hause.
M. Weil jr. Kolonial-Waren en gros. Merzig a.d.
Saar." |
| |
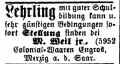 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1897: "Lehrling
mit guter Schulbildung kann unter sehr günstigen Bedingungen sofort
Stellung finden bei Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1897: "Lehrling
mit guter Schulbildung kann unter sehr günstigen Bedingungen sofort
Stellung finden bei
M. Weil junior,
Kolonial-Waren En-gros, Merzig an der Saar." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Mai 1901: "Lehrling
aus guter Familie mit guten Schulzeugnissen für sofort gesucht.
Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis frei im Hause. M.
Weil junior, Kolonialwaren-Engros, Merzig a.d. Saar,
Rheinland." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Mai 1901: "Lehrling
aus guter Familie mit guten Schulzeugnissen für sofort gesucht.
Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis frei im Hause. M.
Weil junior, Kolonialwaren-Engros, Merzig a.d. Saar,
Rheinland." |
Anzeige des Manufaktur-, Konfektions- und Kolonialwarengeschäftes M. Felsenthal
Söhne (1898)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1898: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1898:
"Für unser Manufaktur-, Konfektions- und
Kolonialwarengeschäft suchen wir per sofort oder später einen
Lehrling
bei freier Station im Hause.
M. Felsenthal Söhne, Merzig a.
Saar." |
Anzeige der Mazzenbäckerei H. Rauner (1900)
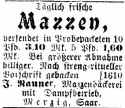 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1900:
"Täglich frische
Mazzen,
versendet in Probepaketen 10 Pfd. 3,10 Mark, 5 Pfr. 1,60 Mark. Bei
größerer Abnahme billiger. Nach streng-ritueller Vorschrift
gebacken.
J. Rauner, Mazzenbäckerei mit Dampfbetrieb, Merzig, Saar." |
Stellengesuch von Sally Levy für seine Schwestern (1900)
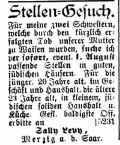 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juli 1900: "Stellengesuch. Für meine
zwei Schwestern, welche durch den kürzlich erfolgten Tod unserer Mutter
zu Waisen wurden, suche ich per sofort, eventuell 1. August passende
Stellen in guten, jüdischen Häusern. Für die jüngere, 20 Jahre alt, im
Geschäft und Haushalt, die ältere 23 Jahre alt, in kleinem, jüdischen
soliden Haushalt und Küche. Gefälligst baldigste Offerten erbitte
an Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juli 1900: "Stellengesuch. Für meine
zwei Schwestern, welche durch den kürzlich erfolgten Tod unserer Mutter
zu Waisen wurden, suche ich per sofort, eventuell 1. August passende
Stellen in guten, jüdischen Häusern. Für die jüngere, 20 Jahre alt, im
Geschäft und Haushalt, die ältere 23 Jahre alt, in kleinem, jüdischen
soliden Haushalt und Küche. Gefälligst baldigste Offerten erbitte
an
Sally Levy, Merzig an der Saar." |
Anzeige von Sophie Moses (1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1901:
"Suche für meinen nur aus einer Person bestehenden Haushalt ein Mädchen,
das vormittags die Hausarbeit versieht und Nachmittags im Geschäft mit
tätig sein kann.
Sophie Moses, Merzig an der Saar." |
Anzeige des Warenhauses A. Kahn (1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1904:
"Für
unser Manufaktur-, Mode-, Schuhwaren- und Konfektionsgeschäft suchen
wir zum sofortigen Eintritt, eventuell nach Ostern
zwei Lehrlinge.
Warenhaus, A. Kahn, Merzig a.d. Saar." |
Das Lebensmittel - en Gros - Geschäft von J. Rauner sucht einen Buchhalter
(1915)
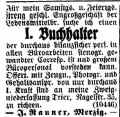 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1915:
"Für mein Samstags und Feiertags streng geschlossenes en Gros-Geschäft
der Lebensmittelbranche suche ich einen I. Buchhalter, der durchaus
bilanzsicher perfekt in allen Büroarbeiten stenographisch gewandter
Korrespondent ist und großem Büropersonal vorstehen kann. Offerten mit
Zeugnissen, Fotografien und Gehaltsanspruch von nur durchaus I. Kraft sind
an meine Zweigniederlassung Trier, Nagelstraße 35, zur richten.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1915:
"Für mein Samstags und Feiertags streng geschlossenes en Gros-Geschäft
der Lebensmittelbranche suche ich einen I. Buchhalter, der durchaus
bilanzsicher perfekt in allen Büroarbeiten stenographisch gewandter
Korrespondent ist und großem Büropersonal vorstehen kann. Offerten mit
Zeugnissen, Fotografien und Gehaltsanspruch von nur durchaus I. Kraft sind
an meine Zweigniederlassung Trier, Nagelstraße 35, zur richten.
J. Rauner, Merzig." |
Verlobungsanzeige von Hedwig Kahn und Aron Rauner
(1922)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. August 1922: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. August 1922:
"Statt Karten:
Hedwig Kahn - Aron Rauner - Verlobte.
Freudenburg (Rheinland) - Trier, Saarstraße 58 / Merzig (Saar)." |
Verlobungsanzeige von Lisbeth Weil und Silli Kahn
(1928)
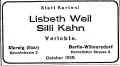 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 12. Oktober 1928: Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 12. Oktober 1928:
"Statt Karten!
Lisbeth Weil - Silli Kahn. Verlobte.
Merzig (Saar) Schankstraße 2 - Berlin-Wilmersdorf
Darmstädter Straße 4.
Oktober 1928." |
Verlobungs-
und Hochzeitsanzeige
von Anna Salomon und Bezirksrabbiner Dr. Max Köhler (1930)
Anmerkung: Rabbiner Dr. Max Köhler (geb. 1899 in Kassel, gest. 1987 in
Jerusalem): nach Schulbesuch in Kassel 1919 bis 1925 Studium in Berlin, Halle,
Berlin und Marburg; Lehrtätigkeit an mehreren Religionsschulen; 1928/29 Leiter
der Talmud-Tora-Schule in Frankfurt am Main; seit Januar 1930 Bezirksrabbiner in
Borken, Westfalen; seit Mai 1934 Bezirksrabbiner in Schweinfurt;
nach dem Novemberpogrom 1938 im KZ Dachau; im Februar 1939 nach London
emigriert, 1984 nach Israel.
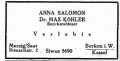 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni
1930:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni
1930:
"Anna Salomon - Dr. Max Köhler.
Bezirksrabbiner.
Merzig/Saar Bismarckstraße 2 - Borken in
Westfalen / Kassel.
Siwan 5690." |
| |
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Juni 1930: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Juni 1930:
ähnlich wie im "Israelit" siehe oben. |
| |
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Oktober 1930: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Oktober 1930:
"Anna Salomon Merzig - Saar
Bezirksrabbiner Dr. Max Köhler Borken i.W.
beehren sich, ihre Vermählung anzuzeigen.
Trauung: Mittwoch, den 22. Oktober 1930, 2 Uhr nachmittags in Trier,
Moselloge." |
Zum Tod
der aus Merzig stammenden Anna Köhler geb. Salomon, der Frau
von Rabbiner Dr. Max Köhler (1937)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juli
1937: "Schweinfurt, 5. Juli (1937). In tiefe Trauer
versetzt wurde unsere Gemeinde und der ganze Bezirk durch den unerwarteten
Heimgang der Frau Anna Köhler, der Gemahlin unseres verehrten
Rabbiners Dr. M. Köhler. Am 19. Tammus (= 28. Juni 1937) hauchte diese
edle Frau bei der treuen Erfüllung ihrer Mutterpflichten ihr junges Leben
aus. Nach kaum siebenjähriger, überaus glücklicher Ehe schenkte sie
einem dritten Kinde das Leben und gab das ihre dafür. Mit ihr verlor der
Gatte die treueste Lebensgefährtin, die dem Rabbinerhause Schönheit und
Glanz verlieh, verloren die unmündigen Kinder die fürsorgendste Mutter.
In tiefer Erschütterung teilen weite Kreise den Schmerz der Familie. Die
herzliche Anteilnahme kam ergreifend bei der Beerdigung im Beth-chajim
(Friedhof) zu Würzburg zum Ausdruck, wobei die Herren Rabbiner Dr.
Hanover, Würzburg, Dr. Munk, Burgpreppach
und Lehrer Reiter, Gerolzhofen, ein
treues Lebensbild der edlen Heimgegangenen zeichneten. Möge der
Allgütige den schwergeprüften Gatten Trost in den hohen Pflichten seines
heiligen Amtes finden lassen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juli
1937: "Schweinfurt, 5. Juli (1937). In tiefe Trauer
versetzt wurde unsere Gemeinde und der ganze Bezirk durch den unerwarteten
Heimgang der Frau Anna Köhler, der Gemahlin unseres verehrten
Rabbiners Dr. M. Köhler. Am 19. Tammus (= 28. Juni 1937) hauchte diese
edle Frau bei der treuen Erfüllung ihrer Mutterpflichten ihr junges Leben
aus. Nach kaum siebenjähriger, überaus glücklicher Ehe schenkte sie
einem dritten Kinde das Leben und gab das ihre dafür. Mit ihr verlor der
Gatte die treueste Lebensgefährtin, die dem Rabbinerhause Schönheit und
Glanz verlieh, verloren die unmündigen Kinder die fürsorgendste Mutter.
In tiefer Erschütterung teilen weite Kreise den Schmerz der Familie. Die
herzliche Anteilnahme kam ergreifend bei der Beerdigung im Beth-chajim
(Friedhof) zu Würzburg zum Ausdruck, wobei die Herren Rabbiner Dr.
Hanover, Würzburg, Dr. Munk, Burgpreppach
und Lehrer Reiter, Gerolzhofen, ein
treues Lebensbild der edlen Heimgegangenen zeichneten. Möge der
Allgütige den schwergeprüften Gatten Trost in den hohen Pflichten seines
heiligen Amtes finden lassen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
NS-Zeit: die
jüdische Gemeinde löst sich auf (1937)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Februar 1937: "Die
saarländischen Synagogengemeinden Merzig und
Neunkirchen, die einst
bedeutende Gemeinden waren, sind heute fast gänzlich aufgelöst. Nur noch
einige Mitglieder sind zurückgeblieben. Dank der finanziellen Hilfe des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden kann die Gemeinde
Illingen, die zur zweitgrößten Gemeinde im Saarland geworden ist, ihren
Kantor und Lehrer weiter behalten. Die Gemeinde betreut die Juden in den
Orten Herchweiler, St. Wendel, Ottweiler und
Neunkirchen. Der Anschluss
der Gemeinden Merzig und Neunkirchen ist beschlossen worden und bedarf nur
noch der behördlichen Genehmigung. Der Anschluss anderer Gemeinden an die
Gemeinde Illingen wird erstrebt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Februar 1937: "Die
saarländischen Synagogengemeinden Merzig und
Neunkirchen, die einst
bedeutende Gemeinden waren, sind heute fast gänzlich aufgelöst. Nur noch
einige Mitglieder sind zurückgeblieben. Dank der finanziellen Hilfe des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden kann die Gemeinde
Illingen, die zur zweitgrößten Gemeinde im Saarland geworden ist, ihren
Kantor und Lehrer weiter behalten. Die Gemeinde betreut die Juden in den
Orten Herchweiler, St. Wendel, Ottweiler und
Neunkirchen. Der Anschluss
der Gemeinden Merzig und Neunkirchen ist beschlossen worden und bedarf nur
noch der behördlichen Genehmigung. Der Anschluss anderer Gemeinden an die
Gemeinde Illingen wird erstrebt." |
Zur Geschichte der Synagoge
Im Haus oder auf dem Grundstück des Moyses Hanau (Hannau) befand sich im 18. Jahrhundert (bereits vor 1729)
ein Betsaal (genannt am 5. Dezember 1729). Moyses Hanau hatte ihn
allerdings ohne Erlaubnis der Behörden eingerichtet und wurde daher von der
Obrigkeit zu einer hohen Geldstrafe verurteilt und verpflichtet, sie wieder zu
beseitigen beziehungsweise abzureißen. Erst ein halbes Jahrhundert später (um
1780) durfte eine neue Synagoge erbaut beziehungsweise eingerichtet werden.
Dabei handelte sich vermutlich noch um den Betsaal,
über den aus dem Jahr 1832 folgende Beschreibung vorliegt: "Die
hiesigen Israeliten besitzen in Merzig ein Haus, worin sich im oberen Stock die
Synagoge befindet; dasselbe hat aber noch vier andere Zimmer". Das Haus mit
dem Betsaal stand im Bereich der heutigen Querstraße (Grundstücke der heutigen
Häuser Querstraße 5-7). Die Häuser des 18. Jahrhunderts wurden im Bereich der
Querstraße 5-7 in den 1980er-Jahren abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.
Ende der 1830er-Jahre reichte der alte Betsaal nicht mehr aus, um die
Gottesdienste der Gemeinde abzuhalten. 1838 wurde mit den Planungen für
eine neue Synagoge begonnen. An der damaligen Rehstraße/Ecke Neustraße konnte
ein Grundstück erworben werden. Die Synagoge wurde 1841/42 erbaut und
konnte am 21. und 22. Juli 1842 feierlich eingeweiht werden. Über die
Einweihung liegt ein ausführlicher Bericht in der Zeitschrift "Allgemeine
Zeitung des Judentums" vom 10. September 1842 vor:
Einweihung der Synagoge in Merzig (1842)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. September
1842: "Merzig, 31. Juli. Das Bedürfnis eines neuen
Gotteshauses hatte sich hier schon seit einigen Jahren fühlbar gemacht. Den
unermüdlichen und uneigennützigen Bestrebungen des in unserer Mitte wohnenden
endlichen gelehrten Herrn Moses Lövy gelang er denn auch, die Gemeinde zum
Neubau einer Synagoge zu bewegen und der Plan hierzu ward alsbald entworfen.
Eben so rasch ging es auch mit der Ausführung vonstatten und durch die
musterhafte Einigkeit unserer wackeren Gemeinde sehen wir jetzt den Wunsch, der
seit langem schon die Herzen aller beseelte, erfüllt, und eine neue prachtvolle
und würdige Synagoge steht jetzt auf einem freien geräumigen, eigens dazu erkauften
Platze. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. September
1842: "Merzig, 31. Juli. Das Bedürfnis eines neuen
Gotteshauses hatte sich hier schon seit einigen Jahren fühlbar gemacht. Den
unermüdlichen und uneigennützigen Bestrebungen des in unserer Mitte wohnenden
endlichen gelehrten Herrn Moses Lövy gelang er denn auch, die Gemeinde zum
Neubau einer Synagoge zu bewegen und der Plan hierzu ward alsbald entworfen.
Eben so rasch ging es auch mit der Ausführung vonstatten und durch die
musterhafte Einigkeit unserer wackeren Gemeinde sehen wir jetzt den Wunsch, der
seit langem schon die Herzen aller beseelte, erfüllt, und eine neue prachtvolle
und würdige Synagoge steht jetzt auf einem freien geräumigen, eigens dazu erkauften
Platze.
Die Einweihung fand am 21. und 22. dieses Monats statt. Eingeladen waren unser
verehrter Herr Landrat und die übrigen Honoratioren der Stadt, welche sämtlich
erschienen, außer der Geistlichkeit, und eine Masse Fremden strömte von nah
und ferne herbei. Alles war belebt in dem Städtchen, und selbst der Himmel
schien auf einmal sich zu entwölken und mild herabzulächeln auf die
versammelte Menge. Nachdem um 12 Uhr unser würdiger Geistlicher Herr Lövy in
der alten Synagoge noch einige ergreifende Worte des Abschiedes gesprochen, |
 die
Gemeinde noch einmal zu ferneren Einigkeit wie bisher ermahnt hatte, und das Mincha
und Lechu neran'nu verrichtet war, begab sich der Herr Lehrer Bonnem mit
der Schuljugend in geordnetem Zuge aus dem Schullokal zum neuen Synagogenhof, wo
das gedrängt versammelte Volk ihrer harrte. Eine feierliche Musik begann, nach
deren Beendigung der Schlüssel zur neuen Synagoge dem Herrn Landrat überreicht
wurde.
die
Gemeinde noch einmal zu ferneren Einigkeit wie bisher ermahnt hatte, und das Mincha
und Lechu neran'nu verrichtet war, begab sich der Herr Lehrer Bonnem mit
der Schuljugend in geordnetem Zuge aus dem Schullokal zum neuen Synagogenhof, wo
das gedrängt versammelte Volk ihrer harrte. Eine feierliche Musik begann, nach
deren Beendigung der Schlüssel zur neuen Synagoge dem Herrn Landrat überreicht
wurde.
Nach Empfang des Schlüssels erwiderte Herr Landrat in sehr passenden
Ausdrücken und versicherte die Gemeinde seines ferneren Schutzes; worauf der
mit einer kräftigen und angenehmen Tenorstimme begabte Vorsänger Herr C. Dahl
aus Koblenz den 100sten Psalm vortrug, bei dessen viertem Verse die Tore des
Hauses geöffnet wurden. Die Einweihungsweise war die gewöhnliche. Zuerst
predigte Herr Oberrabbiner Kahn; sein lebhafter Blick, sein glänzendes
Auge, die Begeisterung, die sich auf dem Antlitze deutlich kund gab, seine edle
Haltung trugen nur dazu bei, das inbrünstige, höchst rührende Gebet nach I.
Buch Könige Kap. 8 noch ergreifender zu machen. Die Weihepredigt selbst
behandelte das Thema: "über den Sinn des vierten Verses im 27. Psalm, dass
nämlich das Gotteshaus die ganze Umgebung des Menschen zu einem solchen
umschaffen müsse, so dass wir uns im Geiste immer in demselben befänden":
und es wurde darin streng wissenschaftlich entwickelt und gezeigt, wie nach den
Bestandteilen unserer Gottesverehrung und nach dem Geistes, der unsere
verschiedenen Gebete durchwebt, das Gotteshaus ein Haus der Erhebung, des
Dankes, der Beruhigung und des Trostes, der Demut und Buße, der Wahrheit und
Aufrichtigkeit, der Liebe und des Friedens und endlich ein Haus der Belehrung
sei, und wie dasselbe so auf das ganze eben und die Umgebung des Israeliten eine
große Wirkung habe. Dieser viva voce und mit Feuer gesprochene, trefflich
durchgeführte Vortrag, an dessen Schlusse der Redner die Gemeinde noch darauf
aufmerksam machte, dass nun auch der Gottesdienst verbessert, und Predigt und
Chorgesang für immer eingeführt werden müssten, damit das Innere dem
Äußeren entspräche, brachte einen auf allen Gesichtern sich unverkennbar
abspiegelnden tiefen Eindruck hervor.
Hieran schloss sich nun eine zweite Rede des Herrn Lövy an; seine mit aller
Liebe und Herzlichkeit eines treuen Seelsorgers gesprochenen, zum Gemüte und
Herzen gesprochenen und tief ergreifenden Worte, in welchen man den edlen und
biederen Charakter des Mannes so ganz erkennen konnte, verherrlichten in der Tat
die Feier. |
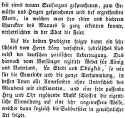 Auf die beiden Predigten folgte dann ein sehr schönes, von Herrn Lövy
verfasstes, hebräisches Lied nebst der deutschen poetischen Übertragung. Das
hiernach vom Vorsänger rezitierte Gebet für König und Vaterland, für Stadt
und Obrigkeit, sowie für die Gemeinde und die ganze Versammlung, in dessen Amen
alle Anwesenden ohne Unterschied des Glaubens mit einstimmten, und eine sehr
passende, Herz und Ohr ergötzende Musik schloss die eigentliche Einweihung auf
eine sehr angemessene Weise, welcher dann sogleich sie Sabbatfeier in
gewöhnlicher Art folgte." Auf die beiden Predigten folgte dann ein sehr schönes, von Herrn Lövy
verfasstes, hebräisches Lied nebst der deutschen poetischen Übertragung. Das
hiernach vom Vorsänger rezitierte Gebet für König und Vaterland, für Stadt
und Obrigkeit, sowie für die Gemeinde und die ganze Versammlung, in dessen Amen
alle Anwesenden ohne Unterschied des Glaubens mit einstimmten, und eine sehr
passende, Herz und Ohr ergötzende Musik schloss die eigentliche Einweihung auf
eine sehr angemessene Weise, welcher dann sogleich sie Sabbatfeier in
gewöhnlicher Art folgte." |
Aus der Predigt von Oberrabbiner Kahn bei der
Einweihung der Synagoge (1842)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" des 19. Jahrhunderts" vom 30.
Oktober 1842: "Desgleichen ermahnte der würdige Oberrabbiner Kahn aus
Trier bei der Einweihung der neuen Synagoge in Merzig die Gemeinde, nun
auch den Gottesdienst zu verbessern und Predigt und Chorgesang für immer
einzuführen…" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" des 19. Jahrhunderts" vom 30.
Oktober 1842: "Desgleichen ermahnte der würdige Oberrabbiner Kahn aus
Trier bei der Einweihung der neuen Synagoge in Merzig die Gemeinde, nun
auch den Gottesdienst zu verbessern und Predigt und Chorgesang für immer
einzuführen…" |
Bei der Merziger Synagoge handelte es sich um einen einfachen Saalbau auf
rechteckigem Grundriss unter einem flach geneigten Satteldach. Das Gebäude war
von der Neustraße etwas zurückgesetzt. Hohe Rundbogenfenster zur Neustraße
hin und entlang der Rehstraße zeigten den besonderen Charakter des Gebäudes
an. Der Gemeinde lag sehr an einer würdigen Gestaltung des Gottesdienstes. Dem
entsprach auch die von Moses Lövy (Levy) bei der Einweihung der Synagoge 1842
angesprochene Gründung eines Synagogenchores (nach orthodoxer Tradition
nur mit Männern und Knaben besetzt) im Sommer 1846. Auf Grund dieses
Chores waren die Gottesdienst in Merzig in der weiten Umgebung bekannt und
wurden viel gelobt, wie man einem Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" vom 20. November 1854 über die Verhältnisse in den jüdischen
Gemeinden im Rabbinatsbezirk Trier entnehmen kann:
 "Merzig,
ein schönes Gotteshaus mit einem ausgezeichneten geregelten Gottesdienst; Herr
M. Levy versieht die Stelle eines Rabbiners - aber gratis - und benutzt jede
Gelegenheit und Veranlassung, um die Gemeinde mit seinen gediegenen Reden zu
erbauen; auch die Schule ist gut, wie zu erwarten unter der Aufsicht eines
solchen uneigennützigen, echten Juden." "Merzig,
ein schönes Gotteshaus mit einem ausgezeichneten geregelten Gottesdienst; Herr
M. Levy versieht die Stelle eines Rabbiners - aber gratis - und benutzt jede
Gelegenheit und Veranlassung, um die Gemeinde mit seinen gediegenen Reden zu
erbauen; auch die Schule ist gut, wie zu erwarten unter der Aufsicht eines
solchen uneigennützigen, echten Juden." |
Einweihung einer Torarolle in der Synagoge (1864)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Januar 1864: "Trier,
im Dezember (1864). In unserem Regierungsbezirke wurde am 4. dieses Monats
eine neue Synagoge in Tholey und am
Sabbat-Chanukka eine Torarolle zu Merzig, welche der dortige Gesangverein
gewidmet, feierlichst eingeweiht. Beide gottesdienstliche Festlichkeiten
machten auf alle Anwesende, unter denen auch die Spitzen der Behörden,
tiefen Eindruck und wurden durch gediegene Predigten des Oberrabbiners
Kahn gehoben und verherrlicht." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Januar 1864: "Trier,
im Dezember (1864). In unserem Regierungsbezirke wurde am 4. dieses Monats
eine neue Synagoge in Tholey und am
Sabbat-Chanukka eine Torarolle zu Merzig, welche der dortige Gesangverein
gewidmet, feierlichst eingeweiht. Beide gottesdienstliche Festlichkeiten
machten auf alle Anwesende, unter denen auch die Spitzen der Behörden,
tiefen Eindruck und wurden durch gediegene Predigten des Oberrabbiners
Kahn gehoben und verherrlicht." |
25-jähriges Jubiläum des Synagogenchores (1871)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Oktober 1871: "Merzig
(Regierungsbezirk Trier), 10. Oktober. Es herrscht noch bei vielen das
Vorurteil, dass die neueren gottesdienstlichen Veranstaltungen, namentlich
in den kleineren Gemeinden, wo die Mittel so leicht erschöpft werden,
sich nur einer vergänglichen Dauer zu erfreuen haben. Da allerdings
mancherlei Vorkommnisse diese Meinung hervorgerufen haben, so müssen auch
Tatsachen dazu dienen, sie zu widerlegen und den Beweis zu führen, dass
es an Eifer und Ausdauer nicht fehlt, wo eine gute Führung vorhanden ist.
Deshalb sein eines schönes Festes erwähnt, welches am 8. dieses Monats
hier gefeiert wurde, nämlich des 25-jährigen Bestehens unseres
Synagogenchors. Treffliche Gesänge, eine geistvolle Ansprache des
Vereinsvorstehers Kantors Schnerb, eine eindrucksvolle Festpredigt des
Oberrabbiners Herrn Kahn und ein heiteres Festmahl vereinigten sich, um
die Feier zu einer ebenso erhebenden wie erfreulichen zu machen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Oktober 1871: "Merzig
(Regierungsbezirk Trier), 10. Oktober. Es herrscht noch bei vielen das
Vorurteil, dass die neueren gottesdienstlichen Veranstaltungen, namentlich
in den kleineren Gemeinden, wo die Mittel so leicht erschöpft werden,
sich nur einer vergänglichen Dauer zu erfreuen haben. Da allerdings
mancherlei Vorkommnisse diese Meinung hervorgerufen haben, so müssen auch
Tatsachen dazu dienen, sie zu widerlegen und den Beweis zu führen, dass
es an Eifer und Ausdauer nicht fehlt, wo eine gute Führung vorhanden ist.
Deshalb sein eines schönes Festes erwähnt, welches am 8. dieses Monats
hier gefeiert wurde, nämlich des 25-jährigen Bestehens unseres
Synagogenchors. Treffliche Gesänge, eine geistvolle Ansprache des
Vereinsvorstehers Kantors Schnerb, eine eindrucksvolle Festpredigt des
Oberrabbiners Herrn Kahn und ein heiteres Festmahl vereinigten sich, um
die Feier zu einer ebenso erhebenden wie erfreulichen zu machen." |
Mitwirkung des Synagogenchores von Merzig bei der
Einweihung der Synagoge in Sierk / Lothringen (1885)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1885: "Sierk
(Lothringen). Der Bericht über die hiesige Synagogen-Einweihung in Nummer
17 des ‚Israelit’ lässt einige Notizen vermissen, die zum Teil gerade
von besonderem gemeinnützigen Interesse sind. Sierk ist nur eine kleine,
nicht bemittelte Gemeinde, welche nicht in der Lage gewesen wäre, ihr
baufällig gewordenes Gotteshaus durch ein so schönes, neues Gebäude zu
ersetzen, wenn ihr nicht von vielen Seiten beträchtliche Unterstützungen
zugeflossen wären. So hat die Kommune 2.000 Mark und die Regierung 2.800
Mark für den Bau bewilligt. Ferner gestattete der Oberpräsident die
Abhaltung einer Lotterie, welche einen ansehnlichen Beitrag abwarf. Von
den zahlreichen jüdischen Spendern sei Herr Anatol Levy ans Nancy
erwähnt, der 1.100 Francs zum bau der Synagoge beisteuerte und dem die
dankbare Gemeinde eine Votivtafel errichtete. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1885: "Sierk
(Lothringen). Der Bericht über die hiesige Synagogen-Einweihung in Nummer
17 des ‚Israelit’ lässt einige Notizen vermissen, die zum Teil gerade
von besonderem gemeinnützigen Interesse sind. Sierk ist nur eine kleine,
nicht bemittelte Gemeinde, welche nicht in der Lage gewesen wäre, ihr
baufällig gewordenes Gotteshaus durch ein so schönes, neues Gebäude zu
ersetzen, wenn ihr nicht von vielen Seiten beträchtliche Unterstützungen
zugeflossen wären. So hat die Kommune 2.000 Mark und die Regierung 2.800
Mark für den Bau bewilligt. Ferner gestattete der Oberpräsident die
Abhaltung einer Lotterie, welche einen ansehnlichen Beitrag abwarf. Von
den zahlreichen jüdischen Spendern sei Herr Anatol Levy ans Nancy
erwähnt, der 1.100 Francs zum bau der Synagoge beisteuerte und dem die
dankbare Gemeinde eine Votivtafel errichtete.
Was die Einweihungsfeierlichkeit selbst betrifft, so bildeten neben den
trefflichen Reden des Herrn Rabbiner Weil von Pfalzburg die Leistungen des
Synagogen-Gesang-Chores von Merzig den Glanzpunkt der ganzen Festlichkeit.
Die Mitglieder dieses in der ganzen Gegend mit Recht berühmten Chors
waren mit ihrem bewährten Meister, Herrn Kantor Schnerb, hierher kommen
und haben durch ihre meisterhaften Leistungen einen wahren Beifallssturm
entfesselt. Die Vollendung und Präzision, mit welcher die einzelnen
Piecen vorgetragen wurden, und besonders das Mussaphgebet des Herrn Kantor
Schnerb, fanden allgemeine, anerkennende Bewunderung. Gäste aus Nancy,
Metz und Paris versicherten, dass diese künstlerische Leistung selbst in
ihren großen Gemeinden unerreicht bleibt. – Da die verehrten Sänger
ihre Mitwirkung in uneigennützigster Weise geleistet und nicht einmal
eine Vergütung ihrer Reisekosten angenommen hatten, so spreche ich gewiss
im Sinne aller zahlreichen Festgäste, wenn ich hiermit den innigsten Dank
für diesen seltenen Genuss öffentlich abstatte." |
38 Jahre lang wurde der Synagogenchor durch den Schwiegersohn von Moses
Lövy, Herrn Godcheaux Schnerb
geleitet, danach von dessen Sohn Isaac Schnerb. Am 14. August 1896 konnte
das 50-jährige Jubiläum des Synagogenchores gefeiert werden. Die Zeitschrift
"Der Israelit" berichtete über die Jubiläumsfeier:
 Merzig a.d. Saar, 28. August. Ein Fest bisher seltener
Art wurde kürzlich hierselbst gefeiert. Der hiesige Synagogen-Chor (Männer und
Knaben) beging am Schabbat mit der Lesung Schofetim das Fest eines
50jährigen Bestehens. Gegründet unter der Ägide des rühmlichst bekannten Herrn
Mosche Merzig Sechor Zadik Liwracha (gemeint Mose Lövy, "das Andenken
des Gerechten sei zum Segen"), stand der Chor 38 Jahre unter Führung
seines vor vier Jahren verstorbenen Schwiegersohnes, Herrn Godcheaux Schnerb Sechor
Zadik Liwracha ("das Andenken des Gerechten sei zum Segen"),
dessen wahrhaft hervorragende Eigenschaften als Lamdan, Chasan (Lehrer,
Kantor) und als Mensch seiner Zeit in diesen Blättern eingehend gewürdigt
wurden. Seit dieser Zeit füllt ein Sohn desselben, Herr Isaac Schnerb, den
Dirigentenposten aus, und zwar auf dem ihm überlieferten streng orthodoxen
Basis und in einer Weise, von der die jüngst stattgehabten Feierlichkeiten ein
glänzendes Zeugnis ablegten. Merzig a.d. Saar, 28. August. Ein Fest bisher seltener
Art wurde kürzlich hierselbst gefeiert. Der hiesige Synagogen-Chor (Männer und
Knaben) beging am Schabbat mit der Lesung Schofetim das Fest eines
50jährigen Bestehens. Gegründet unter der Ägide des rühmlichst bekannten Herrn
Mosche Merzig Sechor Zadik Liwracha (gemeint Mose Lövy, "das Andenken
des Gerechten sei zum Segen"), stand der Chor 38 Jahre unter Führung
seines vor vier Jahren verstorbenen Schwiegersohnes, Herrn Godcheaux Schnerb Sechor
Zadik Liwracha ("das Andenken des Gerechten sei zum Segen"),
dessen wahrhaft hervorragende Eigenschaften als Lamdan, Chasan (Lehrer,
Kantor) und als Mensch seiner Zeit in diesen Blättern eingehend gewürdigt
wurden. Seit dieser Zeit füllt ein Sohn desselben, Herr Isaac Schnerb, den
Dirigentenposten aus, und zwar auf dem ihm überlieferten streng orthodoxen
Basis und in einer Weise, von der die jüngst stattgehabten Feierlichkeiten ein
glänzendes Zeugnis ablegten.
Von Nah und Fern strömten am Freitag, den 14. August die Gäste herbei und versammelten
sich um 6 Uhr in der festlich geschmückten Synagoge, wo die Feier mit einer
Lewandowsky'schen Komposition: Ma towu ("wie lieblich..")*
gesungen vom Synagogenchor ihren Anfang nahm. Herr Cantor Tanneberg bestieg
hierauf die Kanzel und beleuchtete in eienr glänzenden Festrede die bisherige
Geschichte des Synagogenchores, der so eng mit der Gemeinde verwachsen ist, dass
man seine Schilderung als einen Teil der Geschichte der Merziger
Synagogengemeinde bezeichnet darf. Besonders dem langjährigen Führer der
Gemeinde und des Chores Herrn G. Schnerb Sechor Zadik Liwracha ("das
Andenken des Gerechten sei zum Segen") widmete er warme Worte der
Bewunderung und des Dankes und schloss mit einem Gebete für Kaiser und
Vaterland.
Nach einer vollendeten Wiedergabe des 36ten Psalms seitens des Chores, nahm der Maariw-Gottesdienst
(Abend-Gottesdienst) seinen Anfang und zeigte ebenso wie der Morgengottesdienst
am folgenden Tage durch die Auswahl und Ausführung der Gesänge ein festliches
Gepräge. Ein geselliges Beisammensein der ganzen Gemeinde am Nachmittage, ein
Bankett am Abend und ein Festessen am Abende des folgenden Tages bildeten den
Schluss des in allen Teilen, glänzend und würdig verlaufenen Festes. Das
Präsidium bei der Schlussfeier führte der Präses des Chores, Herr Michael
Lilienfeld, dessen Tischrede, sowie die einer Anzahl anderer Herren Zeugnis
davon ablegten, wie tief und ernst die Aufgabe des Chores in den Mitgliedern
wurzelt und wie das Bewusstsein zum Allgemeingut derselben geworden, dass sie
eine "Versammlung zur Erhöhung des Himmels", welche die Jugend zur Awoda
("Dienst", "Gottesdienst") heranzieht und die Erwachsenen
darin zusammenhält, indem sie das Beste, was sie durch gemeinsames Wirken zu
leisten vermag, den veredelten und veredelnden BiM'kehalot (mit Chören)
in den Dienst der Awoda (des Gottesdienstes) stellt.
Humoristische Vorträge und Szenen bildeten den Schluss des abends und zeigten,
dass auch auf diesem Gebiete einzelne Mitglieder und deren Angehörige
Ausgezeichnetes zu leisten vermögen.
Mit besonderer Befriedigung erfüllte es, dass nicht nur die Häuser der
jüdischen Bevölkerung an den Festtagen beflaggt waren, sondern auch die einer
großen Anzahl christlicher Mitbürger und dass unter den reichlich
eingelaufenen Glückwunsch-Adressen und Telegrammen sich auch solche vom
Bürgermeister und Dechant der Stadt befanden, ein schöner und hoch anzuerkennender
Beweis der Duldsamkeit und des dort bestehenden konfessionellen Friedens. |
| * Zu Louis Lewandowski vgl. Website
louis-lewandowski-festival.de bzw. Wikipedia-Artikel
"Louis Lewandowski" |
| Hinweis auf ein Gruppenfoto des
Synagogenchores Merzig, entweder anlässlich des 50-jährigen Jubiläums oder
des 75-jährigen Jubiläums (siehe unten) entstanden (Sammlung des Jüdischen
Museums Berlin):
http://objekte.jmberlin.de/view/objectimage.seam?uuid=jmb-obj-471521&cid=2128904
. |
Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Synagoge mehrfach renoviert. Die
Inneneinrichtung und die rituellen Gegenstände gingen teilweise auf Spenden und
Stiftungen von Gemeindegliedern zurück. So wurde im Herbst 1894 eine wertvolle
Torakrone von Edmund Hanau, der nach Rio de Janeiro ausgewandert war, gespendet.
Er und sein Vater Feist Hanau (gest. 1890), hatte der Gemeinde zur
Verschönerung der Synagoge bereits zahlreiche Geschenke gemacht. In der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Oktober 1894 war zu lesen:
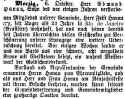 Merzig, 6.
Oktober (1894). Herr Edmund Hanau, Sohn des vor
einigen Jahren verstorbenen Mitgliedes unserer Gemeinde, Herr Feist Hanau Alijo
Haschalom (Friede sei mit ihm), seit länger als 23 Jahre in Rio de Janeiro
(Brasilien) wohnhaft, hat uns nach seinen bereits seit Jahren überreichten
vielen Geschenken zur Verschönerung unserer Synagoge eine weitere Überraschung
bereitet. Vor einigen Wochen sandte er uns von Paris aus eine schwere, echt
vergoldete Krone mit Edelsteinen besetzt, ein wahres Meisterwerk der
Goldschmiedekunst. Merzig, 6.
Oktober (1894). Herr Edmund Hanau, Sohn des vor
einigen Jahren verstorbenen Mitgliedes unserer Gemeinde, Herr Feist Hanau Alijo
Haschalom (Friede sei mit ihm), seit länger als 23 Jahre in Rio de Janeiro
(Brasilien) wohnhaft, hat uns nach seinen bereits seit Jahren überreichten
vielen Geschenken zur Verschönerung unserer Synagoge eine weitere Überraschung
bereitet. Vor einigen Wochen sandte er uns von Paris aus eine schwere, echt
vergoldete Krone mit Edelsteinen besetzt, ein wahres Meisterwerk der
Goldschmiedekunst.
Vorstand und Repräsentanten der Gemeinde ernannten Herrn Hanau zum
Ehrenmitgliede, und als uns Herr und Frau Hanau zum Neujahrsfeste mit ihrem
Besuche beehrten, wurden ihnen seitens der Gemeindevertretung und
Gemeindemitglieder eine großartige Ovation bereitet. |
Im 20. Jahrhundert erfuhr die Merziger Synagoge noch einige Modernisierungen.
So wurden 1921/22 Giebelfenster durch den Trierer Maler Max Lazarus (geb.
1892 in Trier, gest. 1962 in Denver/USA), der auch eine
farbige Ausmalung des Raumes vornahm, in expressionistischen Formen gestaltet.
1922
konnte der Synagogenchor sein 75-jähriges Bestehen feiern. In diesem Artikel
wird auch von der Ausmalung der Synagoge durch Max Lazarus berichtet:
Zum 75-jährigen Bestehen des
Synagogenchores und Ausmalung der Synagoge durch den Trierer Maler Max Lazarus (1922)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1922: "Merzig, 13.
August (1922). Es ist heilsam zu erkennen, dass gerade so wie die
Verwurzelung des Einzelnen in seiner Familie eine Sicherung seines
Lebensaufbaues bedeutet wie auch für die Familie selbst eine Erhöhung
ihres Zweckes und Wertes, dass ebenso die Beziehung der jüdischen Familie
zur jüdischen Gemeinde einen Grundpfeiler des jüdischen Zusammenlebens
und einen Träger der Erhaltung des Judentums in sich schließt. Nach
dieser Richtung hat die Merziger Gemeinde von jeher eine im Verhältnis zu
ihrer Größe besondere Stellung im Kreise der jüdischen Gemeinden
West-Deutschlands eingenommen. Sicherlich ist dies zum Teil den
hervorragenden Männern zuzuschreiben, die hier wirkten. Da ist vor allem
der bekannte Reb Mosche Merzig, der dort vor 100 Jahren lebte und dessen
Bild man noch heute in sehr vielen Familien des Saarlandes findet. Zu ihm
pilgerten Schüler von nah und fern, aus Deutschland und Frankreich. Einer
seiner bekanntesten Schüler war ein Godchaux Schnerb aus Toul, der sein
Schwiegersohn wurde. Er gründete vor 75 Jahren den jüdischen
Synagogenchor und führte ihn zu großer Blüte. Er schenkte dem
synagogalen Gesang viele neue Weisen, die noch heute – so auch in
Frankfurt am Main – gesungen werden. Dieser Synagogenchor wuchs sich zu
einer besonderen Bedeutung für die Merziger Gemeinde aus. Ihm anzugehören,
galt als eine Ehre. Und so finden wir noch heute hervorragende, ergraute Männer
neben Knaben als tätig Mitwirkende. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1922: "Merzig, 13.
August (1922). Es ist heilsam zu erkennen, dass gerade so wie die
Verwurzelung des Einzelnen in seiner Familie eine Sicherung seines
Lebensaufbaues bedeutet wie auch für die Familie selbst eine Erhöhung
ihres Zweckes und Wertes, dass ebenso die Beziehung der jüdischen Familie
zur jüdischen Gemeinde einen Grundpfeiler des jüdischen Zusammenlebens
und einen Träger der Erhaltung des Judentums in sich schließt. Nach
dieser Richtung hat die Merziger Gemeinde von jeher eine im Verhältnis zu
ihrer Größe besondere Stellung im Kreise der jüdischen Gemeinden
West-Deutschlands eingenommen. Sicherlich ist dies zum Teil den
hervorragenden Männern zuzuschreiben, die hier wirkten. Da ist vor allem
der bekannte Reb Mosche Merzig, der dort vor 100 Jahren lebte und dessen
Bild man noch heute in sehr vielen Familien des Saarlandes findet. Zu ihm
pilgerten Schüler von nah und fern, aus Deutschland und Frankreich. Einer
seiner bekanntesten Schüler war ein Godchaux Schnerb aus Toul, der sein
Schwiegersohn wurde. Er gründete vor 75 Jahren den jüdischen
Synagogenchor und führte ihn zu großer Blüte. Er schenkte dem
synagogalen Gesang viele neue Weisen, die noch heute – so auch in
Frankfurt am Main – gesungen werden. Dieser Synagogenchor wuchs sich zu
einer besonderen Bedeutung für die Merziger Gemeinde aus. Ihm anzugehören,
galt als eine Ehre. Und so finden wir noch heute hervorragende, ergraute Männer
neben Knaben als tätig Mitwirkende.
Unter diesen Umständen ist es begreiflich, dass die Merziger Gemeinde den
Wunsch hatte, den Tag des 75-jährigen Bestehens des Chores festlich zu
begehen. Aus fernsten Ländern, aus Brasilien, dann auch aus der Schweiz,
aus Luxemburg und aus vielen Teilen Deutschlands waren geborene Merziger
herbeigeströmt, und die drei hierfür angesetzten Tage, der 16., 17. und
18. Juni wurden zu wahren Festtagen. Im vorigen Jahre war durch den
Trierer Maler, Max Lazarus, die Synagoge in einer so eigenartigen Weise
ausgemalt worden, dass man hier von einem Wendepunkt in der künstlerischen
Behandlung derartiger Aufgaben sprechen kann. Die Merziger Gemeinde ist
eine Sehenswürdigkeit geworden.
Die Feier begann mit dem Freitagabend-Festgottesdienst, an dem der unter
der trefflichen Leitung des Sohnes des Gründers, Herr Isaak Schnerb
stehende Chor zeigte, dass er auch heute noch auf einer für die Verhältnisse
ungewöhnlichen Höhe steht. Die Feier fand ihre Fortsetzung in dem
Festgottesdienst am Samstagmorgen. Hier ist die seltene Tatsache
hervorzuheben, dass über 100.000 Mark geschnodert wurden. Ein Herr Edmund
Hanau stiftete den Fonds zur Gründung eines jüdischen Altersheimes, das
zu Ehren des großen Lehrers und Gründers des Synagogenchores den Namen
Godchaux Schnerb-Stiftung erhielt. Die Feier fand erst Sonntagabend ihren
Abschluss in Festspielen aus der Geschichte der Gemeinde, deren
hervorragende theatralische Darbietungen jenseits jedes Dilettantismus
standen. Wir könnten es nur als ein Glück bezeichnen, wenn die
Geschlossenheit des Merziger Gemeindelebens befruchtend auf andere jüdische
Gemeinden wirken würde. Die Merziger Gemeinde aber und ihrem
Synagogenchor: Ad bias hamoschiach! (sie mögen bestehen bis zum Kommen des
Messias!)." |
Die Merziger Synagoge blieb Mittelpunkt der Merziger Gemeinde bis zu ihrer
Inbrandsetzung durch Nationalsozialisten beim Novemberpogrom 1938. Die
Ruine der Synagoge wurde 1939/40 komplett abgetragen und an gleicher Stelle eine
Baracke mit einem Kindergarten der NSDAP errichtet. Bei einem Luftangriff wurde
das gesamte Areal um das Synagogengebäude und das bis dahin noch stehende
jüdische Schulhaus mit der Wohnung des Lehrers/Kantors zerstört.
1961 wurde eine Gedenktafel angebracht. 1975 wurde die
Rehstraße auf Beschluss des Stadtrates in Synagogenstraße umbenannt. 1976
erfolgte die Anbringung einer neuen Gedenktafel mit der Aufschrift:
"Hier stand das im November 1938 beschädigte und im November 1944
zerstörte ehrwürdige Gotteshaus der Israelitischen Gemeinde Merzig". Das
nicht mehr bebaute Synagogengrundstück wurde als Gedenkstätte gestaltet. Da
die Inschrift der Gedenktafel von 1976 nicht ganz den historischen Tatsachen
entspricht, wurde der Text am 30. März 2005 korrigiert. Auf der
Rückseite ist nun die Inschrift zu lesen: "Die Synagoge wurde in der
Pogromnacht im November 1938 zerstört und die Ruine später abgerissen. Das
Haus des Kantors fiel einem Bombenangriff im November 1944 zum
Opfer."
Hinweis auf einen Presseartikel zur Synagogengeschichte in Merzig von Alfred
Diwersy in der "Saarbrücker Zeitung" vom 28. Juni 2012: "Merzig.
Juden und Christen lebten einträchtig zusammen..."
Informationen zu den Zerstörungen von 1944 im Blog von Johannes Nagel: "Merzig
1944"
Adresse/Standort der Synagoge: Synagogenstraße (früher: Ecke
ehemalige Rehstraße/Ecke Neustraße)
Fotos / Darstellungen
| Historische Fotos
(Quelle: Buch des Landesamtes s. Lit.
S. 447, bzw. Stadtmuseum Simeonstift Trier) |
|
 |
 |
 |
Historische Aufnahme der
Synagoge
in Merzig, von der Neustraße gesehen. |
Die
1938 ausgebrannte Synagoge
von
der Rehstraße (heute
Synagogenstraße) aus gesehen. |
Innenansicht der
Synagoge
um 1923 |
| |
|
| |
|
|
Hinweis
auf das schon oben genannte Gruppenfoto des Synagogenchores Merzig von 1896
oder 1922 im Bestand des Jüdischen Museums Berlin:
http://objekte.jmberlin.de/view/objectimage.seam?uuid=jmb-obj-471521&cid=2128904.
|
| |
|
|
Die Gedenkstätte am Synagogenplatz
im
Frühjahr 2006
(Fotos: Hahn,
Aufnahmedatum 17.4.2006
Fotos von 2012: Quelle Archiv Regler) |
 |
 |
| |
Straßenschild
"Synagogenstraße" |
Weg zum Denkmal |
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Das Denkmal für
die 1938 zerstörte Synagoge |
Neue
Informationstafel am
Synagogengrundstück (Juli 2012) |
| |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| November 2011:
Neuerscheinung und Veranstaltung zum 150.
Todestag von Reb Mosche Merzig |
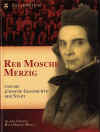 Neuerscheinung:
Alfred Diwersy & Hans Herkes (Hrsg.): Neuerscheinung:
Alfred Diwersy & Hans Herkes (Hrsg.):
Reb Mosche Merzig und die Jüdische Geschichte der Stadt
208 Seiten, gebunden, mit zahlreichen zeitgenössischen Fotos und Dokumenten
ISBN: 978-3-86390-000-7 19,90 €
Gollenstein Verlag Merzig. Vertrieb über den Buchhandel.
Zum Inhalt: Im 19. Jahrhundert lebte in Merzig der jüdische Gelehrte Moise Isack Levy. Er war ein charismatischer, verehrter Rabbiner, denn von weither kamen Schüler in seine Thoraschule. Bekannt wurde er unter dem Ehrennamen Reb Mosche Merzig. Sein 150. Todestag wurde nun zum Anlass genommen, von ihm, der jüdischen Gemeinde und ihrem Leben zu berichten. Familien- und Einzelschicksale sowohl von Ermordeten wie auch von Geretteten ergänzen das Buch. Auch von versöhnlichen Begegnungen nach dem Zweiten Weltkrieg und den lebenden Nachfahren wird erzählt. Begleitet werden die Texte durch Dokumente und Fotos, teils aus Privatbesitz und bislang größtenteils unveröffentlicht.
Die "Arbeitsgruppe Jüdische Geschichte der Stadt Merzig" zeichnet verantwortlich für die Publikation
Mit Textbeiträgen von Hans Adler, Richard Bermann, Traudl Brenner, Alfred
Diwersy, Hans Herkes, Manfred Horf, Dr. Martin Kaiser, Annemay
Regler-Repplinger, Martin-Peter Scherzinger, Prof. Paul Schneider, Dr. Bärbel Schulte, Uwe Schwarz, Marcel
Wainstock.
Buchvorstellung in der "Saarbrücker Zeitung" von 29.
November 2011: Link
zum Artikel - auch eingestellt
als pdf-Datei.
Bericht über eine Veranstaltung zu dem Buch: "Ein Abend für
Reb Mosche Merzig" in der "Saarbrücker Zeitung" vom 18.
Januar 2012
(Link
zum Artikel; auch eingestellt
als pdf-Datei). |
| |
 Die
Arbeitsgruppe Jüdische Geschichte der Stadt Merzig lud aus Anlass des 150. Todestages von Reb Mosche Merzig
zusammen mit der Synagogengemeinde Saar, der Christlichen Erwachsenenbildung Merzig, dem Gustav-Regler-Zentrum und der Stadt
Merzig Die
Arbeitsgruppe Jüdische Geschichte der Stadt Merzig lud aus Anlass des 150. Todestages von Reb Mosche Merzig
zusammen mit der Synagogengemeinde Saar, der Christlichen Erwachsenenbildung Merzig, dem Gustav-Regler-Zentrum und der Stadt
Merzig
zu einer Gedenkveranstaltung am Sonntag, den 6. November 2011 um 14.30
Uhr ein.
Ablauf der Veranstaltung: Begrüßung durch Manfred Horf an der
Synagogengedenkstätte Ecke Neustraße/Synagogenstraße - Gedenken auf dem
jüdischen Friedhof durch Kantor Benjamin Chait
- Fahrt zum Gustav-Regler-Zentrum (Trierer Straße 148) - Feierstunde zur 150. Jahrzeit von Reb Mosche Merzig
- Fahrt zur Wagnerstraße, Enthüllung einer Schrifttafel vor dem ehemaligen
Wohnhaus (siehe Foto links).
Programm der Feierstunde zur 150. Jahrzeit Reb Mosches Merzig im Gustav-Regler-Zentrum Merzig
Begrüßung durch den Vorsitzender des Gustav-Regler-Zentrums Dr. Martin Kaiser
- Grußwort des Oberbürgermeisters Dr. Alfons Lauer, vertreten
durch Herrn Bürgermeister Manfred Horf - Ansprache des Vorsitzenden der Synagogengemeinde
Saar Richard Bermann - Vorstellung des Buches "Reb Mosche Merzig und die jüdische Geschichte der
Stadt" Alfred Diwersy.
Musikalische Gestaltung durch Vera Völker, Sopran und Francesca Tortora,
Klavier.
 Bericht
über die Veranstaltung (eingestellt als
pdf-Datei). Bericht
über die Veranstaltung (eingestellt als
pdf-Datei).
Foto links: Gedenkstunde auf dem jüdischen Friedhof Merzig mit dem
Kantor der Synagogengemeinde Saar Benjamin Chait.
Zusätzlich eingestellt: Psalmgebet
und Kaddisch, gesprochen von Kantor Benjamin Chait für Reb Mosche
Herzig (pdf-Datei) |
Juni/Juli 2012:
Presseartikel - Erinnerungen an den 170. Jahrestag der Einweihung
der Synagoge in Merzig
Die pdf-Dateien wurden freundlicherweise von der "Saarbrücker
Zeitung" zu Verfügung gestellt. |
Artikel in der "Saarbrücker
Zeitung" vom 21. Juni 2012: "Nachsinnen im Tempel Gottes.
Vor 170 Jahren, im Juli 1842, wurde die neue Merziger Synagoge an der Ecke der damaligen Rehstraße/Neustraße feierlich eingeweiht. Dieses Jubiläum nimmt die "Arbeitsgruppe Jüdische Geschichte der Stadt Merzig" erneut zum Anlass, in diverser Form auf das jüdische Leben vormals aufmerksam zu machen..."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als pdf-Datei |
Weiterer Artikel von Alfred Diwersy
(Fortsetzung des obigen Artikel) in der "Saarbrücker Zeitung"
vom 28. Juni 2012: "Juden und Christen lebten einträchtig
zusammen. Bereits vor annähernd 300 Jahren muss es in Merzig eine
erste Synagoge oder ein Bethaus gegeben haben; denn in einem
Gerichtsurteil vom 5. Dezember 1729 heißt es...."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als pdf-Datei |
Weiterer Artikel von Hans Herkes in der
"Saarbrücker Zeitung" vom 5. Juli 2012: "Mittelpunkt
des jüdischen Lebens.
Der Pfarrer wohnt im Schatten des Kirchturms; das Pfarrhaus steht in der Nähe der Kirche. Oft gehört ein drittes Gebäude dazu mit Funktionsräumen für die Bedürfnisse einer Gemeinde: Gruppenräume, ein Festsaal, ein Probenraum für den Chor, die Pfarrbücherei. So ist es uns geläufig in den katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden. In den jüdischen Gemeinden war es ganz ähnlich..."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als pdf-Datei |
Weiterer Artikel von Annemay
Regler-Repplinger in der "Saarbrücker Zeitung" vom 10. Juli
2012: "Von dreisten Raben unter Tauben
Viele Namen sah ich eingeschrieben, die dir gestehen voll Zärtlichkeit, dass sie dich unaussprechlich lieben, von nun an bis in Ewigkeit. Nun rat, wer in dein Reich von Tauben, sich hier als dreister Rabe schleicht?" Es war Gustel Kahn, die diese Zeilen 1911 ihrer Mitschülerin und Freundin Marianne Regler in deren Poesiealbum schrieb..."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als pdf-Datei |
Weiterer Artikel von Annemay
Regler-Repplinger in der "Saarbrücker Zeitung" vom 12. Juli
2012: "Der herabstürzende Bach des Lebens und die Hoffnung.
Kehren wir zu weiteren Anwohnern und Geschäften der Merziger Poststraße und der anliegenden Sträßchen zurück. Neben dem Lebensmittelladen von Bonnem folgten die Konfektionsgeschäfte von D. Stern, Isidor Weil und gegenüber das von Benzin Weil. Unser Spaziergang führt dann vorbei am Süßwaren- und Lebensmittelgeschäft Rauner, der dort nicht nur Matzen verkaufte, sondern auch solche herstellte..."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als pdf-Datei |
Weiterer Artikel von Annemay
Regler-Repplinger in der "Saarbrücker Zeitung" vom 19. Juli
2012: "Gegen das Vergessen.
Auf den Spuren des Nazi-Regimes wird man im Saarland durchaus fündig, wenn man denn suchen und sehen will. Es sei erinnert an den "Platz des Unsichtbaren Mahnmals" vor dem Saarbrücker Schloss..."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als pdf-Datei |
Juli 2012: Veranstaltung aus Anlass des 170. Jahrestages der Einweihung der Synagoge
in Merzig am 22. Juli 2012
(veranstaltet von der Kreisstadt Merzig und der Arbeitsgruppe Jüdische
Geschichte der Stadt Merzig) |
 Am
21. und 22. Juli 1842 wurde die neue Merziger Synagoge Ecke
Rehstraße und Neustraße feierlich eingeweiht. Die Arbeitsgruppe
Jüdische Geschichte der Stadt Merzig nimmt dies zum Anlass, zusammen mit
der Stadt Merzig und der Synagogengemeinde Saar zu einer kleinen
Feierstunde einzuladen am Sonntag, den 22. Juli 2012 um 15.00 Uhr. Am
21. und 22. Juli 1842 wurde die neue Merziger Synagoge Ecke
Rehstraße und Neustraße feierlich eingeweiht. Die Arbeitsgruppe
Jüdische Geschichte der Stadt Merzig nimmt dies zum Anlass, zusammen mit
der Stadt Merzig und der Synagogengemeinde Saar zu einer kleinen
Feierstunde einzuladen am Sonntag, den 22. Juli 2012 um 15.00 Uhr.
Treffpunkt ist der Platz der ehemaligen Synagoge in der heutigen
Synagogenstraße. In kurzen Ansprachen und Erläuterungen will man
Historie lebendig werden lassen. Daran schließt sich der Gang zum
jüdischen Friedhof an den Ort, wo neben vielen jüdischen Mitbürgern
auch der berühmte Talmudlehrer Moses Isack Levy, genannt Reb Mosche
Merzig, nach seinem Tod am 29. September 1861 beerdigt wurde. Eine Gedenkplatte
soll dort künftig an ihn und sein Wirken erinnern.
Neben dem Gedenkstein für Moses Isack Levy im Park der Andersdenkenden,
den Professor Paul Schneider 2004 gestaltet hat, der Benennung einer
Straße nach ihm, der Plakette bei seinem Haus in der Wagnerstraße und
der Veröffentlichung seiner Biographie im November 2011, stellt dies die
Abrundung der Darstellung dieser Persönlichkeit aus unserer Sicht
dar.
Zum Ausklang bei einem Ehrenwein und Getränken und weiteren Gesprächen
sind alle Teilnehmer der Veranstaltung herzlich eingeladen ins Vereins,
Merzig, Propsteistraße.
Die
Einladung zur Veranstaltung als pdf-Datei. |
| |
Dazu Artikel von Wolf Porz in der
"Saarbrücker Zeitung" vom 23. Juli 2012:
"Erinnerung an jüdisches Leben in Merzig.
Merzig. Zum Glück ist nicht alles vernichtet worden, was an
jüdisches Leben in Deutschland erinnert. Dazu gehören gottlob die
Archive jüdischer Publikationen wie der 'Allgemeinen Zeitung des
Judentums' . So konnte Richard Bermann, der Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, gestern am Gedenkstein der jüdischen Synagoge Merzig anhand der Berichterstattung von damals schildern, wie sich die zweitägige Eröffnung des Gotteshauses in Merzig abgespielt hat - exakt 170 Jahre zuvor. Das Wetter war wie gestern sommerlich, war es zuvor wohl sehr wechselhaft gewesen. In feierlicher Prozession war die Tora von der bisherigen Synagoge in der heutigen Querstraße zur neuen Synagoge Ecke Neustraße/Rehstraße
gebracht worden..."
Link
zum Artikel Artikel
eingestellt als
pdf-Datei |
| |
| November 2012:
Die ersten 17 "Stolpersteine" werden in
Merzig verlegt |
Artikel in der "Saarbrücker
Zeitung" vom 19. November 2012 (Link
zum Artikel): "Stolpersteine sollen 'Menschen ein Gesicht
geben'.
Merzig. Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Es handelt sich um Gedenktafeln in Form von Pflastersteinen. Mit ihnen soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert oder in den Suizid getrieben wurden. Sie sollen jeweils an dem letzten freiwillig gewählten Wohnort des NS-Opfers verlegt werden. Deutschlandweit wurden in den letzten Jahren schon viele hundert Stolpersteine verlegt.
In Merzig hat sich Bernd Schirra ehrenamtlich engagiert, nach Betroffenen recherchiert und Gelder gesammelt, damit auch in Merzig, wo ehemals eine größere jüdische Gemeinde ansässig war, Stolpersteine verlegt werden können. Durch sein Engagement haben sich schon einige Spender gefunden, die die Aktion finanziell unterstützen.
Am Dienstag, 20. November, ist in Merzig eine erste große Aktion geplant, in der mit der Verlegung von zunächst 17 Steinen den Opfern des Nationalsozialismus gedacht werden soll.
Die Gedenksteine werden direkt vor den Häusern verlegt, in denen die Personen, die das NS-Regime nach ihrer Deportierung nicht überlebt haben, ihren letzten Wohnsitz hatten. Künstler Gunter Demnig wird die Steine verlegen. Beginn der Aktion ist um neun Uhr in der Hochwaldstraße 66
(Dekoba)." |
| |
| November 2013:
Gedenken zum 75. Jahrestag des Novemberpogroms
1938 |
 Bericht in "Neues aus Merzig" (Amtsblatt der
Stadt) - Ausgabe 46/2013 vom 13. November 2013: "Vor 75 Jahren brannte auch
die Merziger Synagoge...". Bericht in "Neues aus Merzig" (Amtsblatt der
Stadt) - Ausgabe 46/2013 vom 13. November 2013: "Vor 75 Jahren brannte auch
die Merziger Synagoge...".
Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
 Foto
des Kranzes an der Gedenkstätte links: Archiv Regler Foto
des Kranzes an der Gedenkstätte links: Archiv Regler |
| |
| Februar
2014: Weitere
"Stolpersteine" werden verlegt |
Artikel in der
"Saarbrücker Zeitung" vom 21. Febraur 2014: "Familie Frenkel ist nicht vergessen
Drei Stolpersteine werden am Samstag zum Gedenken an Nazi-Opfer in Merzig verlegt
Der Künstler Gunter Demnig verlegt am kommenden Samstag, 22. Februar, drei neue Stolpersteine in Merzig. 17 der Gedenktafeln in Form von Pflastersteinen erinnern bereits in der Stadt am jeweilig letzten
Wohnort an das Schicksal von Menschen, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert oder in den Suizid getrieben wurden..."
Link
zum Artikel |
| |
| April
2015: Die Stadt Merzig trennt sich von
Initiator des Stolperstein-Projektes |
Artikel von Philipp Anton in der
"Saarbrücker Zeitung" (Lokalausgabe Merzig) vom 25. April 2015:
"Stadt Merzig trennt sich von Initiator des Stolperstein-Projektes
In Merzig sollen auch künftig Stolpersteine verlegt werden, die an NS-Opfer erinnern. Aber die Stadt hat sich vom Initiator des Projektes wegen zahlreicher islamfeindlicher Äußerungen getrennt..."
Link
zum Artikel |
| |
| Oktober
2015: Weitere
"Stolperstein"-Verlegung |
| Am 13. Oktober 2015
wurde ein "Stolperstein" im Merziger Stadtteil Hilbringen
verlegt. Dieser erinnert an Valentin Kiefer (nicht-jüdisch), der seinen
Wohnsitz in der Mittelstraße 6 hatte und 1940 wegen Kritik am NS-System
verhaftet wurde. Er wurde in das KZ Dabei deportiert, von hier nach
Neu-Rohlau/Karlsbad (Außenlager des KZ Flossenbürg), wo er von der SS
erschossen wurde. |
| |
|
|
|
|
Fotos von der
Verlegung
(Archiv Regler) |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Portrait von
Valentin Kiefer |
Der
"Stolperstein" für Valentin Kiefer |
| |
|
|
|
|
| Presse-Artikel
zur Verlegung |
 |
 |
 |
|
| |
Artikel in
"Neues aus Merzig",
Ausgabe 43/2015 |
Artikel in der
"Saarbrücker Zeitung"
Lokalausgabe vom 12.10.2015 |
Artikel in der
"Saarbrücker Zeitung"
Lokalausgabe vom 14.10.2015 |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Wilhelm Laubenthal: Die Synagogengemeinden des
Kreises Merzig 1648-1942. Saarbrücken 1984. |
 | Annemarie Schestag: Woher stammt die Merziger
Familie Hanau? in: SFK (Vierteljahreszeitschrift Saarländische
Familienkunde) Bd. 9 2000 S. 64-80. Hier werden die Ursprünge der Familie
im Elsass beschrieben und ihre Verbreitung über Metz und Freistoff bis nach
Merzig. |
 | Wolfgang Reget: Die Einwohner von Brotdorf, Bachem
und Hausbach vor 1890. Merchingen/Saar 2003. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 446-448 (mit weiteren Literaturangaben). |
 | 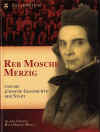 Alfred Diwersy
/ Hans Herkes (Hrsg.): Reb Mosche Merzig und die Jüdische Geschichte der Stadt Alfred Diwersy
/ Hans Herkes (Hrsg.): Reb Mosche Merzig und die Jüdische Geschichte der Stadt
208 Seiten, gebunden, mit zahlreichen zeitgenössischen Fotos und Dokumenten
ISBN: 978-3-86390-000-7 19,90 €
Gollenstein Verlag Merzig. Vertrieb über den Buchhandel.
Bericht über eine Veranstaltung zu dem Buch "Ein Abend für Reb Mosche
Merzig" in der "Saarbrücker Zeitung" vom 18. Januar
2012
(Link
zum Artikel; auch eingestellt
als pdf-Datei). |
 | Alfred Diwersy / Annemay Regler-Repplinger:
Gegen das Vergessen - Jüdisches Leben in Merzig. In: Jahrbuch 2014 des
Kreises Merzig-Wadern. Selbstverlag. Hrsg. vom Verein
für Heimatkunde im Kreis Merzig-Wadern e.V. S. 44-55. |
 |  Frank
Hirsch: Juden in Merzig zwischen Beharrung und Fortschritt. Eine
kleinstädtische Gemeinde im 19. Jahrhundert. Reihe: Geschichte &
Kultur. Saarbrücker Reihe Bd. 4. Trier 2014 (= Dissertation Universität
Saarbrücken 2012). 341 S. 15 Abb., 17 Tab. 52,00 €. ISBN
978-3-89890-188-8 Link
zu einer Seite der Verlagsbuchhandlung Kliomedia. Frank
Hirsch: Juden in Merzig zwischen Beharrung und Fortschritt. Eine
kleinstädtische Gemeinde im 19. Jahrhundert. Reihe: Geschichte &
Kultur. Saarbrücker Reihe Bd. 4. Trier 2014 (= Dissertation Universität
Saarbrücken 2012). 341 S. 15 Abb., 17 Tab. 52,00 €. ISBN
978-3-89890-188-8 Link
zu einer Seite der Verlagsbuchhandlung Kliomedia. |
 | ders.: Ein modernes Element in der Kleinstadt: Jüdische
Kaufleute in Merzig in der Zeit der Industrialisierung. In: Eckstein. Journal
für Geschichte 13 2014. S. 4-11. |
 | Edgar Schwer: Den jüdischen Gefallenen des
Saarlandes 1914-1918 zum Gedenken. In: Saarländische Familienkunde Band
12/4. Jahrgang XLVIII 2015 S. 559-600. Online
zugänglich: eingestellt als pdf-Datei. |
 |
 Neuerscheinung
2019 in der Reihe "Mitteilungen der 'Vereinigung für die
Heimatkunde im Landkreis Saarlouis e.V.'“ Sonderband 25: Neuerscheinung
2019 in der Reihe "Mitteilungen der 'Vereinigung für die
Heimatkunde im Landkreis Saarlouis e.V.'“ Sonderband 25:
Hans Peter Klauck: Jüdisches Leben im Landkreis Merzig-Wadern
1650-1940. 594 S., zahlr. Abbildungen, Hardcover-Einband. 2019. Preis: 38 €.
Bestellungen über Vereinigung für die
Heimatkunde im Landkreis Saarlouis e.V. Kaiser-Wilhelm-Str. 4-6
66740 Saarlouis
heimatkunde@vfh-Saarlouis.de
Zu dieser Publikation: Im 17. Jahrhundert sind im Raum Merzig die ersten
jüdischen Familien nachweisbar. 1652 wird in einem Vogteigerichtsprotokoll
ein "Roffel auch Raphael Jud" genannt. Es ist jedoch nicht sicher, ob er
selbst in Merzig wohnte. 1683 wurde erstmals die Familie des Moyses Hanau in
Merzig erwähnt Im 18. Jahrhundert zogen weitere jüdische Familien in Merzig
zu. 1768 und 1782 gab es fünf jüdische Familien in der Stadt, die
überwiegend vom Viehhandel lebten. Drei von ihnen waren allerdings nach
einer Beschreibung von 1782 "bettelarm". In letztgenanntem Jahr zählte die
jüdische Gemeinde, zu der auch die jüdischen Familien in den späteren
Filialgemeinden Brotdorf und Hilbringen gehörten, etwa 12 Familien. Die
Arbeit soll die Entwicklung der jüdischen Gemeinden im Landkreis
Merzig-Wadern über einen Zeitraum ab der Mitte des 17. Jahrhunderts
dokumentieren. Bis zum Jahre 1940 konnten insgesamt 4687 Bewohner jüdischen
Glaubens im Landkreis dokumentieren und in 638 Familien zusammenführen. Die
Geschichte der jüdischen Bevölkerung endete wie im gesamten Saarland am
22.10.1940. An diesem Tag wurden die letzten Juden in das französische Lager
Gurs deportiert. Den Nationalsozialisten war es in kurzer Zeit gelungen ein
gutes und konfliktloses Zusammenleben von Christen und Juden zu zerstören.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Merzig Saar.
Evidence of Jewish settlement dates back to the 14th century. The modern
community began to develop in the 18th century and a cemetery was established in
1770. In 1808 there were 83 Jews living in Merzig and 277 by 1905. The
community's synagogue was probably dedicated at the beginning of the 19th
century. From 1846 Jews served as town councilors. By 1933, the Jewish
population was 159. The Saarland's annexation to the German Reich in 1935 caused
many to emigrate and by 1936 there were only 14 Jewis in Merzig. The community
was subsequently affiliated with Illingen and Neunkirchen.
On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue was burned down, the
mortuary at the cemetery was desecrated, and Jewish businesses and homes were
wrecked. On 22 October 1940, at least seven Jews who had remained in Merzig were
deported to the Gurs concentration camp.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|