|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Lülsfeld (VG
Gerolzhofen, Kreis Schweinfurt)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit
von Evamaria Bräuer, Gerolzhofen)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Lülsfeld bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis
um 1935, bereits seit etwa 1920 in enger Verbindung mit der Gemeinde im
benachbarten Frankenwinheim. Die
Entstehung der Gemeinde geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. 1604
wird Berntz Jud von Lülsfeld genannt. Er war in Fellen (heute VG Burgsinn)
verhaftet worden: er hatte den Ort passiert, um Schutzgeld zu
sparen.
1733
lebten sechs jüdische Familien im Ort unter dem Schutz des Grafen von
Schönborn (genannt werden u.a. Levi und Abraham Jud, Schimpol und Jockel Jud). Juden, die am Ort aufgenommen werden wollten, mussten ein Vermögen
von mindestens 1.000 Gulden nachweisen. Im 18. Jahrhundert nahm die Zahl der
jüdischen Einwohner weiter zu: 1762 waren es elf Familien.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1816 68 jüdische Einwohner (24,9 % von insgesamt 273), 1836
68 (in 14 Familien; 22,4 % von 303), 1867 55 (in 10 Haushaltungen; 16,2 % von 339), 1875 45, 1880 38 (13,7 % von 278), 1890 29 (9,5 % von 305),
1892 6 Familien; 1897 30, 1910 25
(5,9 % von 420).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Lülsfeld auf
insgesamt 14 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände
genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Maier Salomon Katzmann
(Viehhandel), Joseph Baehrlein Berneth sen. (Ellen- und Spezereihandel), Moses
Löb Baehrlein Baerwein (Schmusen), Jacob Hirsch Hirschlein (Ellenwarenhandel),
Hirsch Joseph Berneth (Ellen- und Spezereienhandel), Moises Joseph Berneth
(Ellen- und Spezereienhandel), Oscher Salomon Loeb (Vieh- und Bettenhandel),
Löb Nachem Haas (Ellenhandel), Seligmann Hirsch Herrmann (Ellenhandel),
Seligmann Laemlein Lehmann (Wein- und Hopfenhandel), Simson Abraham Fleischmann
(Ellenhandel), Laemlein Seligmann Lang (Ellenhandel), Jacob Abraham Kramer
(Viehhandel), Jeidel Hirsch Handler
(Viehhandel).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), einen Raum für den Religionsunterricht der Kinder sowie ein
rituelles Bad (1852 neu erbaut). Die
Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Gerolzhofen
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war
zeitweise (im 19. Jahrhundert) ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter
und Schochet tätig war. Seit Ende des 19. Jahrhunderts konnte sich die Gemeinde
jedoch keinen eigenen Lehrer mehr leisten. 1857 verpflichteten die
jüdischen Familien von Järkendorf, Rimbach
und Lülsfeld den bisherigen Brünnauer
jüdischen Lehrer Abraham Jüng. Er war zugleich als Vorbeter und
Schächter tätig und erhielt als Besoldung jährlich 170 Gulden bei freier
Wohnung im Synagogengebäude in Lülsfeld. Die Gottesdienste und der Unterricht
wurden abwechselnd in Lülsfeld und Järkendorf abgehalten, der Unterricht im
Winter und der Gottesdienst an bestimmten Tagen auch in Rimbach. Die Gemeinde
gehörte zum Distriktsrabbinat in Niederwerrn,
nach dessen Auflösung beziehungsweise Verlegung 1864 zum Distriktsrabbinat Schweinfurt.
1868 gab es folgende jüdische Familien am Ort: Lemlein Löb
(Handelsmann), Hirsch Haas (Unterhändler), Abraham Löb Krämer (Viehhändler),
Lippmann Reinfelder (Webermeister), Simon Prölsdörfer (Viehhändler) Volk
Braun (Viehhändler), Moses Fleischmann (Viehhändler) Moses Pfeifer
(Unterhändler), Abraham Löb Kahn (Kaufmann), Natan Berwein
(Unterhändler).
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Sally Kohn
(geb. 18.2.1888 in Lülsfeld, gef. 14.10.1914; vgl. Dokument unten). Sein Name steht in der 1990
erstellten Dorfchronik; ein Kriegerdenkmal gibt es am Ort nicht.
1924 wurden 17 jüdische Einwohner in Lülsfeld gezählt, die inzwischen zur jüdischen
Gemeinde in Frankenwinheim gehörten. Der dortige Lehrer (seit 1876 Josef
Kissinger, betreute auch die Lülsfelder Gemeindeglieder). 1927 waren noch drei jüdische Familien am Ort, die Familien des Feist Fleischmann,
Adolf Kohn und Louis Maier.
1933 wurden 13 jüdische Einwohner gezählt (3,2 % von insgesamt 410). In den
folgenden Jahren verzogen die meisten von ihnen beziehungsweise wanderten aus.
Vor November 1938 lebten noch neun jüdische Personen im Dorf (siehe Dokument
unten). Beim
Novemberpogrom 1938 wurden die jüdischen Häuser verwüstet. Die letzten
jüdischen Einwohner (die dreiköpfige Familie Kohn) wurde am 22. April 1942 nach
Würzburg gebracht und von dort drei Tage später nach Izbica bei Lublin
deportiert.
Von den in Lülsfeld geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Baer geb.
Kohn (1869), Jettchen Fleischmann (1884), Moses Fleischmann
(1898), Fanny Klugmann geb. Kahner (1863), Adolf Kohn (1884), Alfred A. Kohn (1915),
Benno Kohn (1872,
Stolperstein in Bamberg), Erna Kohn (1922), Hedwig Kohn
geb. Klugmann (1891), Hermann Kohn (1871, Stolperstein in Gerolzhofen), Martin Krämer (1867), Else
Münz geb. Fleischmann (1900), Siegfried Münz (1904), Irma
Strauss geb. Fleischmann (1899), Selma Wilmersdörfer geb. Krämer (1886).
1950 wurden die am Novemberpogrom 1938 in Frankenwinheim und Lülsfeld
Beteiligten in Schweinfurt vor Gericht gestellt.
Im Vorgarten des Rathauses (Kirchstraße 17) befindet sich ein Gedenkstein
mit der Inschrift: "Die Gemeinde Lülsfeld gedenkt ihrer ehemaligen
jüdischen Mitbürger. Zur Erinnerung und Mahnung". Im August 2023 wurden
erste "Stolpersteine" des Künstlers Gunter Demnig in Lülsfeld verlegt (siehe
unter "Erinnerungsarbeit
vor Ort").
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibung der Stelle des Lehrers, Kantors und Schochets in Frankenwinheim (1927)
Anmerkung: aus der Ausschreibung geht hervor, dass
Lülsfeld der Gemeinde Frankenwinheim angeschlossen war und von dort betreut
wurde.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:
"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und
hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch
Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,
Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.
Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger
Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis
spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den
Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen
falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen
Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November
1927. Siegfried Kahn." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:
"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und
hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch
Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,
Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.
Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger
Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis
spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den
Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen
falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen
Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November
1927. Siegfried Kahn." |
Anzeigen
Anzeige der Samen- und Fruchthandlung Kohn (1881)
 Anzeige
im "Bote vom Steigerwald" vom März 1881: "Monats-Kleesamen, Dollen-Kleesamen,
Wicken und Kartoffeln empfiehlt billigst Kohn in Lülsfeld". Anzeige
im "Bote vom Steigerwald" vom März 1881: "Monats-Kleesamen, Dollen-Kleesamen,
Wicken und Kartoffeln empfiehlt billigst Kohn in Lülsfeld". |
Erinnerungen an einzelne Personen
| September 2017:
Sol Kohn in New York wird 100 Jahre
alt |
 Der älteste Lülsfelder wurde 2017 100 Jahre alt: Sol (Sally) Kohn ist am
9. September 1917 als Sohn von Adolf Kohn und seiner Frau Hedwig geb.
Klugmann in Lülsfeld geboren. Beide Eltern sind nach der Deportation
umgekommen.
Der älteste Lülsfelder wurde 2017 100 Jahre alt: Sol (Sally) Kohn ist am
9. September 1917 als Sohn von Adolf Kohn und seiner Frau Hedwig geb.
Klugmann in Lülsfeld geboren. Beide Eltern sind nach der Deportation
umgekommen.
Link: Oral history interview with Sol Kohn: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn76709 -
Text
des Interviews als pdf-Datei
(United States Holocaust Memorial Museum - Interview with Sol Kohn -
August 20, 2012) |
Dokumente
Kriegsstammrolle
Germersheim über
den 1914 gefallenen Sally Kohn
(Quelle: Gemeindearchiv Lülsfeld)
|
 |
|
|
Sally Kohn ist am 8. Februar 1888 in Lülsfeld
geboren als Sohn von Abraham Kohn und Regine geb. Frank. Er war im Ersten
Weltkrieg als Gefreiter eingesetzt. Über seine verschiedenen Aktivitäten als
Soldat wird in der Kriegsstammrolle berichtet. Dazu heißt es dann: "Am
14. Oktober 1914 bei den Kämpfen im Ailly Wald durch ein Artillerie-Geschoss
- Kopfschuss - gefallen. Die Leiche wurde von der Kompanie nicht beerdigt." |
| |
|
|
Anzeige des
Gefallenentodes
von Sally Kohn (1915)
(Quelle: Gemeindearchiv
Lülsfeld) |
 |
|
|
In der Anzeige des Veteranen-, Krieger- und Kampfgenossen-Vereins Lülsfeld
wird an den Gefallenentod der Kameraden Saly Kohn (jüdisch) und Otto Markert
(nichtjüdisch) gemeinsam gedacht. Die Anzeige erschien im Lokalblatt des
Steigerwald-Boten. |
| |
|
|
Meldeliste über die
noch in Lülsfeld
lebenden jüdischen Personen (1935 / 1938)
(Quelle: Gemeindearchiv
Lülsfeld) |

 |
 |
|
1935 werden genannt: Adolf Kohn
(1884), Hedwig Kohn geb. Klugmann (1891), Alfred Kohn (1915), Erna Kohn
(1922), Fanny Klugmann geb. Kahner (1862), Regina Maier geb. Krämer (1870),
Jakob Maier (1904), Mina Maier (1908), Siegfried Münz (1904), Else Münz geb.
Fleischmann (1900), Lilli Münz (1931), Feist Fleischmann (1868), Minna
Fleischmann geb. Sulzbacher (1865).
Am 1. Mai 1938 werden genannt: Fanny Klugmann geb. Kahner (1863), Adolf Kohn
(1884), Hedwig Kohn geb. Klugmann (1891), Alfred Kohn (1915), Erna Kohn (1922), Mina
Fleischmann geb. Sulzbacher (1865), Siegfried Münz (1904), Else Münz geb.
Fleischmann (1900), Lilli Münz
(1931). |
| |
|
|
Liste über die aus
Lülsfeld deportierten
jüdischen Personen (1946)
(Quelle: Gemeindearchiv
Lülsfeld) |
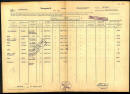 |
|
| In der
vom Bürgermeisteramt Lülsfeld auf Anweisung 1946 erstellten Liste werden
genannt: Minna Fleischmann geb. Sulzbacher (1865), Siegfried Münz (1904), Else Münz geb.
Fleischmann (1900), Lilli Münz (1931), Alfred Kohn (1915), Adolf Kohn
(1884), Hedwig Kohn geb. Klugmann (1894), Erna Kohn (1922), Fanny Klugmann
geb. Kahner (1862). |
| |
|
|
Todeserklärungen der
aus Lülsfeld deportierten
Mitglieder der Familie Kohn (1950)
(Quelle: Gemeindearchiv
Lülsfeld) |
 |
|
Die
Todeserklärung des Amtsgerichtes Gerolzhofen erschien im Lokalblatt des
Steigerwald-Boten im Mai 1950.
Zum 31. Mai 1942 wurden für tot erklärt: Adolf Kohn (1884), Hedwig Kohn
(1891), Alfred Kohn (1915), Erna Kohn (1922). |
| |
|
|
Gedenken
an Benno Kohn und seine
Frau Luise geb. Freitag
(Quelle
der Fotos) |
 |
 |
|
 Im
"Gedenkbuch der jüdischen Bürger Bambergs"
https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/206/1/Dokument_1.pdf
wird auch an das Schicksal von Benno Kohn (geb. 1872 in Lülsfeld) und seiner
Frau Luise geb. Freitag (geb. 1880 in Dormitz)
gedacht. Eingestellt ist hierzu eine
pdf-Datei der Seiten 219-220. Benno Kohn führte bis 1907 eine Filiale
der Firma Buxbaum in der Bahnhofstraße in Gerolzhofen und zog dann nach
Bamberg um. Im
"Gedenkbuch der jüdischen Bürger Bambergs"
https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/206/1/Dokument_1.pdf
wird auch an das Schicksal von Benno Kohn (geb. 1872 in Lülsfeld) und seiner
Frau Luise geb. Freitag (geb. 1880 in Dormitz)
gedacht. Eingestellt ist hierzu eine
pdf-Datei der Seiten 219-220. Benno Kohn führte bis 1907 eine Filiale
der Firma Buxbaum in der Bahnhofstraße in Gerolzhofen und zog dann nach
Bamberg um. |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Gemeindearchiv
Lülsfeld |
| Kennkarten
zu Personen, die in Lülsfeld geboren sind bzw. gelebt haben |
 |
 |
 |
| |
Kennkarte
(Brühl) für Bertha Baer
geb. Kohn (geb. 18. November 1869
in Lülsfeld; 1942 deportiert in das
Ghetto Theresienstadt,
für tot erklärt) |
Kennkarte
(Gerolzhofen) für Erna Kohn
(geb. 1. Juli 1922 in Würzburg,
wohnhaft in Lülsfeld, 1942 deportiert
nach Krasnystaw, für tot erklärt)
|
Kennkarte
(Nürnberg) für
Selma Wilmersdörfer geb. Krämer
(geb. 24. Januar 1886 in Lülsfeld,
wohnhaft in Nürnberg, 1942 deportiert
in das Ghetto Izbica, für tot erklärt) |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
Erste "Stolperstein"-Verlegung
in Lülsfeld (August 2023)
(Fotos der Stolpersteine und des Grabsteines von Evamaria Bräuer) |
 |

 |
 |
 |
Alfred Kohn, Foto in
der Website
"joodsmonument" (Link s.u.)
|
Stolpersteine
in Lülsfeld vor dem Haus Hauptstraße 5 für Fanny Klugmann geb. Kahner, Adolf
Kohn (1884), Hedwig Kohn geb. Klughahn (1891), Alfred Kohn (1915), Sol Kohn
(1917, 1938 in die USA emigriert), Erna Kohn (1922); rechts Gruppenbild mit
dem Künstler Gunter Demnig ( mit 1. Bürgermeister Thomas Heinrichs: 6.v.r.,
Vizelandrätin Martina Bärmann: 1.v.r.)
|
Grabstein des Abraham
Löb Kohn (heiratete 1867 nach Lülsfeld und gründete hier eine Familie mit
neun Kindern; Grabstein auf dem Friedhof
in Gerolzhofen) |
Pressebericht der "Mainpost" vom
28. August 2023 von der 1. Stolperstein Verlegung in der Nachbargemeinde
Lülsfeld:
Artikel eingestellt als pdf-Datei.
Link zur Gedenkseite bei "joodmonuments":
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226652/alfred-abraham-kohn
. |
Zur Geschichte der Synagoge
1762, als elf jüdische Familien am Ort lebten, baten diese
ihren Landesherrn, eine Schule, verbunden mit einer Synagoge bauen zu dürfen.
Der Bau wurde damals genehmigt und 1764 fertig gestellt. Über 130 Jahre
war dieses Gebäude Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens in Lülsfeld. Seit
Ende des 19. Jahrhunderts konnten auf Grund der zurückgegangenen Zahl der
Gemeindeglieder (1892 sieben Familien) keine regelmäßigen Gottesdienste mehr
abgehalten werden.
Das baufällig gewordene Gebäude
wurde von der klein gewordenen jüdischen Gemeinde 1922 an einen Landwirt verkauft. Die hier noch lebenden
jüdischen Personen besuchten seitdem die Gottesdienste in Frankenwinheim.
Das Gebäude der Synagoge ist - zumindest teilweise (Schwierz S. 86:
"Mauerreste") - zwar noch erhalten, befindet sich inzwischen aber in
baulich schlechtem Zustand und wird landwirtschaftlich genützt.
Adresse/Standort der Synagoge: Hauptstraße 14.
Fotos
Historische Fotos sind noch
nicht vorhanden; über Zusendungen freut sich der
Webmaster der
"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |
|
| |
|
| |
|
|
Gedenkstein zur
Erinnerung
an die "ehemaligen jüdischen Mitbürger"
in Lülsfeld
(Foto erhalten von Evamaria Bräuer) |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Haus der Familie Kohn
in Lülsfeld,
vgl. Bericht vom August 2019
(Besuch von Nachkommen der Familie Kohn
in Gerolzhofen und Lülsfeld
siehe Seite zu Gerolzhofen) |
 |
 |
| (Fotos erhalten von
Evamaria Bräuer) |
Bürgermeister Wolfgang
Anger aus Lülsfeld mit
Prof. Harold Kohn und seiner Frau Carol vor
dem Haus Hauptstraße 5, in dem die letzten
fünf Angehörigen der Kohn-Familie bis zu ihrer
Deportation 1942 wohnten. |
Rechts der in Lülsfeld
geborene und später in
Gerolzhofen lebende Hermann Kohn
mit seiner Frau Amalie geb. Schwab,
beide wurden nach der Deportation ermordet.
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 350. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 85-86. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 539.
|
 |  Andreas Müssig: Die Lülsfelder Synagoge.
Fulda 1994. Andreas Müssig: Die Lülsfelder Synagoge.
Fulda 1994.
ders.: Lülsfalder Loit. Hg. Gemeinde Lülsfeld. Fulda 1992. Darin: Die
israelitische Kultusgemeinde in Lülsfeld S. 29-42. und: Die israelitische
Religionsschule in Lülsfeld S. 43-48. |
 | Werner Steinhauser: Juden in und um Prichsenstadt:
Prichsenstadt, Altenschönbach, Brünnau, Kirchschönbach, Järkendorf.
Prichsenstadt 2002. Anfragen/Bestellungen über den Verfasser (E-Mail).
|
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 133. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Luelsfeld Lower Franconia.
Jews numbered 68 in 1816 and 13 in 1933 (total 410). Their fate was similar to
the Frankenwinheim community, to which they were attached: some emigrated and
the others were sent eastward where they were killed.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|