|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht: "Synagogen im
Rhein-Lahn-Kreis"
Isselbach (VG
Diez, Rhein-Lahn-Kreis)
Jüdische Geschichte / Betstube
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Isselbach bestand eine kleine jüdische Gemeinde im
19. Jahrhundert. Die am Ort lebenden Juden gehörten meist zur Gemeinde in Holzappel,
hatten jedoch zeitweise einen eigenen Betraum am Ort.
Bereits im 14. Jahrhundert gab es Juden am Ort. Seit 1319 siedelte
der Erzbischof von Trier einige Juden auf seinen Besitzungen an (darunter auch
in Isselbach), um den Handel zu beleben.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1843 19 jüdische Einwohner, 1905 37.
1843 bildeten die in Holzappel, Isselbach,
Dörnberg, Langenscheid und Eppenrod eine
gemeinsame Synagogengemeinde mit Sitz in Holzappel.
An Einrichtungen hatte die jüdische (Filial-)Gemeinde Isselbach eine Betstube (s.u.). Die
in Isselbach verstorbenen jüdischen Personen wurden auf dem Friedhof
in Holzappel beigesetzt.
Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 fiel aus Isselbach Isaac
Isselbächer (siehe Bericht unten). Ersten Weltkrieg fiel aus Isselbach der Gefreiter Albert (Adolf)
Isselbächer (geb. 22.8.1892 in Isselbach, vermisst seit 21.2.1916).
Um 1924, als
30 jüdische Einwohner in Isselbach gezählt wurden, waren zwei der drei
Gemeindevorsteher in Holzappel aus Isselbach: neben Sigmund Löwenthal aus
Holzappel waren dies Jacob Isselbächer I und Isaak Isselbächer aus Isselbach.
Den Religionsunterricht der jüdischen Kinder erteilte Lehrer Nehemias Alt aus Diez.
1932 waren die Gemeindevorsteher der Gemeinde Holzappel Josef Rosenthal
(1. Vors.) aus Holzappel, dazu Jakob Isselbächer I (Isselbach, 2. Vors.), Isaak
Isselbächer (3. Vors. Isselbach). Im Schuljahr 1931/32 erhielten acht jüdische
Kinder der Gemeinde Religionsunterricht. Er wurde weiterhin durch Lehrer
Nehemias Alt aus Diez erteilt. 1932 wurden in Isselbach 26 jüdische
Einwohner gezählt.
Nach 1933 ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder (1933: etwa 25 Personen) auf Grund der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom
1938 wurden die Häuser der jüdischen Familien von SA-Leuten überfallen,
die Bewohner teilweise schwer misshandelt und die Wohnungen demoliert und
geplündert. Vier ältere Ehepaare wurden am 12. Februar 1941 in
"Judenhäuser" nach Frankfurt verschickt und von dort später
deportiert.
Von den in Isselbach geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Klara Henoch geb.
Isselbächer (1862), Amalie (Malchen, Julie) Isselbächer geb. Simon (1890),
Betty Isselbächer geb. Tannewald (1886), Blanka Isselbächer geb. Schönberg
(1899), Emma Isselbächer geb. Stein (1875), Erwin Albert Isselbächer (1922),
Helga Isselbächer (1927), Helmut Isselbächer (1921), Ignatz Isselbächer
(1899(, Isidor Isselbächer (1895), Jakob Isselbächer (1883), Jakob
Isselbächer (1875), Julius Isselbächer (1880), Mathilde Isselbächer geb.
Löwenstein (1893), Amalie (Malchen) Katz geb. Isselbächer (1882), Ricke Katz
geb. Isselbächer (1885), Selma Marx geb. Isselbächer (1889).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Isaac Isselbächer ist im
deutsch-französischen Krieg gefallen (1870)
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:
"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88. Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:
"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88.
Musketier Simon Löb aus Villmar,
Kreis Oberlahn, tot.
Musketier Wolff, leicht verwundet, Schuss ins Bein.
Musketier Isaac Isselbächer aus Isselbach, Kreis Unterlahn,
tot.
Musketier Gefreiter (Einjährig-Freiwilliger Magnus Heller aus
Eiterfeld, Kreis Hünfeld, schwer
verwundet, Schuss in den Oberschenkel." |
Prozess wegen Totschlags des jüdischen Viehhändlers
Simon Isselbächer aus Isselbach (1934)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1934:
"Limburg (Lahn), 17. November (1934). Vor dem Schwurgericht
hatte sich der frühere Kassengehilfe Peter Rössel aus Montabaur
wegen Totschlags zu verantworten. Er hatte am 19. Juni den
Viehhändler Simon Isselbächer aus Isselbach derart mit einem
Gewehrschaft auf den Kopf geschlagen, dass dieser nach mehreren Tagen den
erlittenen Verletzungen erlag.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1934:
"Limburg (Lahn), 17. November (1934). Vor dem Schwurgericht
hatte sich der frühere Kassengehilfe Peter Rössel aus Montabaur
wegen Totschlags zu verantworten. Er hatte am 19. Juni den
Viehhändler Simon Isselbächer aus Isselbach derart mit einem
Gewehrschaft auf den Kopf geschlagen, dass dieser nach mehreren Tagen den
erlittenen Verletzungen erlag.
Der Angeklagte hatte nach Verlassen einer Wirtschaft unverständliche
Äußerungen getan, war nach Hause gegangen, hatte dort eine
Kleinkaliberbüchse geholt und traf dann mit dem Viehhändler, den er gar
nicht kannte, auf der Straße zusammen, der dort auf ein Auto wartete. Erst
wollte er auf den Viehhändler schießen, aber das Gewehr war nicht
geladen. Darauf schlug er dem Viehhändler mit dem Gewehrschaft auf den
Kopf.
Für die Anklage wegen Totschlags wurde zwar dem Angeklagten
Schuldausschließung nach $ 51 (Bewusstlosigkeit oder krankhafte Störung
der Geistestätigkeit des Täters) zugebilligt. Das Gericht
verurteilte ihn jedoch zu einem Jahr drei Monaten Gefängnis wegen Alkoholmissbrauchs.
In der Urteilsbegründung heißt es, dass es bei der Tat nicht darauf
angekommen sei, dass es sich um einen Juden gehandelt habe. Rössel
habe den erstbesten Menschen, der ihm entgegengekommen sei, in seinem
Zustande zusammengeschlagen." |
Zur Geschichte der Synagoge
Die jüdischen
Familien in Isselbach gingen zum Gottesdienst nach
Holzappel. Zeitweise - in der zweiten
Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts - gab es jedoch einen eigenen
Betraum am Ort. Er konnte 1904 wieder in Benützung genommen werden, nachdem es
einige Jahre keine brauchbare Torarolle in der Gemeinde gab:
Die jüdischen Familien in Isselbach
können eigene Gottesdienst abhalten (1904)
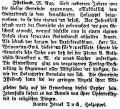 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1904: "Isselbach,
25. August (1904). Seit mehreren Jahren war die hiesige Gemeinde
gezwungen, allsabbatlich dem Gottesdienst in dem benachbarten Holzappel beizuwohnen,
da sie keine eigene Torarolle besaß. Vor Jahresfrist jedoch wurde
der Gemeinde eine gebrauchte Torarolle zum Geschenk gemacht, worauf
dieselbe nun in einem eigenen Lokale einen separaten Gottesdienst abhalten
konnte. Als jedoch vor kurzem der Bezirksrabbiner, Herr Dr. Weingarten -
Ems, diese Torarolle für unbrauchbar erklärte, scheute die
Gemeinde kein Opfer und ließ bei der Firma A. Rotschild - Frankfurt am
Main ein neues Sepher (Torarolle) anfertigen. Die Einweihung ging am
vergangenen Freitag-Nachmittag in Gegenwart aller Mitglieder der hiesigen,
sowie der Holzappeler Gemeinde vor sich. Die Gemeinde Isselbach kann bei
der geringen Anzahl ihrer Mitglieder stolz auf die Erwerbung dieses Sepher
sein. Jedenfalls liefert es den Beweis von ihrer Opferwilligkeit in
religiösen Dingen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1904: "Isselbach,
25. August (1904). Seit mehreren Jahren war die hiesige Gemeinde
gezwungen, allsabbatlich dem Gottesdienst in dem benachbarten Holzappel beizuwohnen,
da sie keine eigene Torarolle besaß. Vor Jahresfrist jedoch wurde
der Gemeinde eine gebrauchte Torarolle zum Geschenk gemacht, worauf
dieselbe nun in einem eigenen Lokale einen separaten Gottesdienst abhalten
konnte. Als jedoch vor kurzem der Bezirksrabbiner, Herr Dr. Weingarten -
Ems, diese Torarolle für unbrauchbar erklärte, scheute die
Gemeinde kein Opfer und ließ bei der Firma A. Rotschild - Frankfurt am
Main ein neues Sepher (Torarolle) anfertigen. Die Einweihung ging am
vergangenen Freitag-Nachmittag in Gegenwart aller Mitglieder der hiesigen,
sowie der Holzappeler Gemeinde vor sich. Die Gemeinde Isselbach kann bei
der geringen Anzahl ihrer Mitglieder stolz auf die Erwerbung dieses Sepher
sein. Jedenfalls liefert es den Beweis von ihrer Opferwilligkeit in
religiösen Dingen.
Kantor Israel Tuch,
Holzappel." |
Wie lange in der Isselbacher Betstube Gottesdienste abgehalten
wurden, ist nicht bekannt.
Adresse/Standort der Synagoge:
unbekannt
Fotos
Abbildungen zur jüdischen
Geschichte in Isselbach
(aus der Sammlung von Claus Peter Beuttenmüller) |
 |
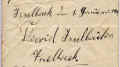 |
| |
Foto der Viehhändler Jakob
und Hermann Isaak
beim Verkauf von Vieh in Niederelbert um 1920 |
Unterschrift von David
Isselbächer aus Isselbach
unter einem privaten Schreiben von 1913 |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
| Hinweis
auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde Gemünden /
Wohra und umliegenden Orten |
In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs
(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus
hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:
Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41
Zu Gemünden/Wohra sind u.a. vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
HHStAW 365,354 Sterberegister der jüdischen Gemeinden in
Gemünden / Wohra und in Holzappel 1824 - 1843; enthält
Sterberegister der Juden aus Gemünden/Wohra, Dodenhausen, Grüsen und
Schiffelbach, 1824 - 1844 sowie Sterberegister der Juden aus Holzappel,
Isselbach und Langenscheid, 1917 - 1938. https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v2924801
|
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 384-385 (innerhalb des
Abschnittes zu Holzappel) |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 438-439 (innerhalb des Abschnittes zu Holzappel). |
 | Franz Gölzenleuchter: Sie verbrennen alle
Gotteshäuser im Lande (Psalm 74,8). Jüdische Spuren im Rhein-Lahn-Kreis -
Jahrzehnte danach. Limburg 1998. S. 86-90. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 189 (bei Holzappel).
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Holzappel
Hesse-Nassau. In
1843, the Jews of Holzappel, Isselbach, and three other villages established a
community, which numbered 67 in 1905. On Kristallnacht (9-10 November
1938), 15 Jews remained in Holzappel (and approximately the same number in
Isselbach). At least 12 perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|