|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Haigerloch
Haigerloch (Zollernalbkreis)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte des Ortes
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Haigerloch wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt. Neuste Einstellung am
20.8.2015.
Übersicht:
 | Allgemeine Berichte zur Geschichte der jüdischen
Gemeinde
- Erzählung von Dr. Samuel Mayer (Hechingen) über die
Erlebnisse eines reisenden Händlers in Haigerloch Mitte des 18.
Jahrhunderts
- Besuch
der Autorin Margarete Marasse in Haigerloch und ihr
Bericht (1918)
- Bericht
eines Reisenden über seine Eindrücke vom jüdischen Haigerloch (1921)
- Beitrag
über "Die Juden in Haigerloch" von Lehrer Gustav Spier (Artikel
von 1925)
- Über die konfessionelle Eintracht in
Haigerloch (1927)
- Sabbatstille in Haigerloch - Bericht eines nichtjüdischen
Autors in der "Neuen Zürcher Zeitung" 1930
- 150 Jahre
jüdischer Stadtteil Haag (1930)
- Über
den "Hag" in Haigerloch (Beitrag in der "Neuen Zürcher
Zeitung" von 1930) |
 | Aus der Geschichte des
Rabbinates
- Zum Tod von
Rabbiner Maier Hilb (1880)
- Zum 50.
Todestag von Rabbiner Maier Hilb (1930)
- Ausschreibung des Rabbinates
(1883)
- Rabbiner
Dr. Spitz wechselt nach Gailingen (1888)
- Ausschreibung des Rabbinates (1888)
- Begrüßung von
Rabbiner Dr. Aron Wolff durch den Gemeindevorsteher (1889)
- Zum
Tod von Rabbiner Dr. Aron Wolff in Fürth (1900) |
 | Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule(n)
- Von einem Beth-Hamidrasch (jüdisches Lehrhaus), das um 1860/70 nicht gegründet wurde
(Artikel von 1926)
- Vor dem Tod
Jakob Regensburgers: die Ausschreibung der Lehrerstelle für das
Beth HaMidrasch (1873)
- Zum 60.
Todestag von Jakob Regensburger (1933)
- Ausschreibung der Lehrer- und Kantorstelle (1878)
- Hebräische Prüfungen an der Schule durch
Rabbiner Dr. Spitz
(1885)
- Ausschreibung
der Stelle des Schächters, Hilfskantors und Religionslehrers (1902)
- 25-jähriges
Jubiläum von Lehrer Speyer (1904)
- Die
israelitische Schule wird der evangelischen Schule gleichgestellt (1904)
- Zum Tod
von Prediger und Lehrer J. Hilb (1905)
- Zum Tod von Lehrer
Speyer (1907)
- Ausschreibung
der Stelle des Lehrers und Kantors (1907)
- Lehrer Wallach
engagiert sich bei der Gründung des jüdischen
Schwarzwald-Jugendgauverbandes (1920)
- Über
den aus Haigerloch stammenden Kantor Jakob (Jacob) Hohenemser (1911-1964)
- Über den
Lehrer Gustav Spier (geb. 1892 in Zwesten, 1924 bis 1939
Lehrer in Haigerloch,
umgekommen 1942)
- Lehrer
Gustav Spier referiert im Jüdischen Jugendverein in Eschwege (1927)
- Lehrer
Hermann Adler tritt in den Ruhestand (1930)
- 70.
Geburtstag von Lehrer i.R. Hermann Adler (1930)
|
 | Verschiedene
Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und
Vereinsleben
- Verschiedene Meldungen (1880)
- Vortrag
von Alfred Levi über die Ziele des religiösen Liberalismus (1926)
- Anlässlich
der Einführung des neuen katholischen Stadtpfarrers wird die konfessionelle
Eintracht beschworen (1927)
- Vortrag
im Jüdischen Jugendverein mit Landgerichtsdirektor Stern aus Stuttgart
(1927)
- 40-jähriges
Bestehen des Männergesangvereins "Liederkranz" (1928)
- Gefallenen-Gedenkfeier
aller Konfessionen (1928)
- Vortrag
im Jüdischen Jugendverein von Oberlehrer Theodor Rothschild aus Esslingen
(1928)
- Vortragsveranstaltung
mit Else Bergmann aus Laupheim und Sophie Levy aus Ulm (1928)
- Neuwahlen
zum Israelitischen Vorsteheramt (1929)
- Frühjahrskonzert
des jüdischen Männergesangvereins "Liederkranz" (1929)
- Vortrag
im Jüdischen Jugendverein mit Redakteur Hans Sternheim aus Stuttgart (1929)
- Ausflug
des Vereins "Jüdisches Lehrhaus" Stuttgart u.a. nach Haigerloch
(1929)
- Haigerlocher
Heimattag mit jüdischer Beteiligung (1929)
- Vortrag
der Deutschen Friedensgesellschaft (1929)
- Vortragsabend
in der Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten mit Dr. Franz
Hirsch aus Ulm (1929)
- Bei
den Gemeinde-, Kreistags- und Kommunallandtagswahlen wurden aus Hechingen
und Haigerloch jüdische Personen gewählt (1930)
- Chanukkafeier
der Gemeinde im Dezember 1929 (1930)
- Hauptversammlung
des Gesangvereins "Liederkranz", Plenarversammlung des
"jüdischen Frauenvereins" - Generalversammlung des "Vereins
für jüdische Geschichte und Literatur" (1930)
- Mitgliederversammlung
des Jüdischen Jugendvereins - Plenarversammlung der Ortsgruppe des
Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten" (1930)
- Vortrag
im Jugendverein mit Rechtsanwalt Dr. Tänzer aus Stuttgart (1930)
- Gemeinsamer
Ausflug der jüdischen Jugendvereine Haigerloch und Rottweil (1930)
- "Rassenkundliche"
Forschungen in Haigerloch durch Dr. Stefanie Martin-Oppenheim aus München
(1930)
- Die
Kinder der Gemeinde beteiligen sich zu Simchas Thora bei den Umzügen in der
Synagoge (1930)
- Antisemitische
Vorfälle (1931)
- Generalversammlungen
der Vereine - Gesangverein "Liederkranz" und Jüdischer
Literaturverein (1931)
- Berichte
aus dem Jüdischen Frauenverein, dem Jüdischen Jugendbund und der
Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten (1931)
- Gefallenengedenkfeier
in der Synagoge, auf dem jüdischen Friedhof sowie Gedenkfeier der Stadt
für alle Konfessionen (1931)
- Vortragsabend
des Jugend- und des Literaturvereins (1931)
- Vortrag
von Rabbiner Dr. Tänzer aus Göppingen (1931)
- Vortrag
im Frauenverein von Johanna Bach aus Mühringen (1931)
- Vortrag
im jüdischen Jugendverein über "Jüdische Politik" (1931)
- Verschiedene
Veranstaltungen in der Gemeinde im Herbst 1932 (1932)
- Chanukkafeier
in der Gemeinde - Gemütlicher Abend des Frauenvereins - Familienabend des
jüdischen Gesangvereins "Liederkranz" (1932)
- Generalversammlungen
verschiedener Vereine (1932)
- Vortrag
im Jüdischen Frauenverein von Else Bergmann aus Laupheim (1932)
- Neuwahlen
zum Israelitischen Vorsteheramt - Vortragsveranstaltung im Jugendverein mit
Moses Thalmann aus Pforzheim (1932)
- 100-jähriges
Bestehen des Geschäftes der Familie Josef Hirsch (1932)
- Kulturelle
Veranstaltungen im Herbst 1932 (1932)
- Vortragsveranstaltungen
des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur und des Jugendvereins
(1932)
- 60 Jahre
Jüdischer Frauenverein (1933)
- Vortrag
im Jüdischen Frauenverein mit Meta Adelsheimer aus Stuttgart (1933)
- Chanukkafeier
der Gemeinde im Dezember 1932 (1933)
- Generalversammlungen
der Vereine, darunter 60-jähriges Bestehen des Jüdischen Frauenvereins
(1933)
- Vortragsveranstaltung
mit Rabbiner Mayer aus Frankfurt am Main (1933)
- Erzählung
über einen alten Pessachbrauch in Haigerloch (1933)
- Vortragsveranstaltungen
des Jüdischen Frauenvereins (1933)
- 50.
Stiftungstag des Wohltätigkeitsvereins Chewra Gemuiluth Chesed (1933)
- Rückgang
der jüdischen Bevölkerung in Haigerloch - Vortragsveranstaltungen (1933)
- Neuhebräisch-Kurs
mit Lehrer Spier (1933)
- Eine
Winterhilfe-Sammlung wird in der jüdischen Gemeinde durchgeführt (1933)
- Vortrag
über Palästina und weitere Veranstaltungen im Herbst 1933 (1934)
- Chanukkafeier
der Gemeinde im Dezember 1933 (1934)
- Bericht
über die Aktivitäten verschiedener jüdischer Vereine (1934)
- Gemeindeversammlung
mit Vortrag von Ilse Wolff aus Stuttgart sowie Vortragsveranstaltungen im
Jüdischen Frauenverein und im Jugendverein (1934)
- Vortragsveranstaltungen
im Frauenverein und im Jugendbund (1934)
- Theodor-Herzl-Gedenkfeier
(1934)
- Gedenkstunde
des Jugendbundes für Chajim Nachmann Bialik (1934)
- Verschiedene
Veranstaltungen, u.a. Palästina-Film-Abend und Vortrag von Dr. Julius
Herzfeld aus Köln (1934)
- Chanukkafeier im
Dezember 1934 (1935)
- Bibelabende
mit Lehrer Spier im Jüdischen Frauenverein (1935)
- Berichte
aus den Generalversammlungen der Vereine (1935)
- "Bunter Nachmittag" im jüdischen Gasthaus "Rose"
(1935)
- Vortragsveranstaltung
mit Julius Paul Eppstein aus Stuttgart - Gründung eines Kulturbundes der
jüdischen Gemeinden der Umgebung (1935)
- Neuwahlen
zum Israelitischen Vorsteheramt - Vortragsveranstaltung zum
Maimonides-Jubiläum (1935)
- Kulturveranstaltung
für die Schwarzwaldgemeinden in der "Rose" in Haigerloch (1935)
- Vortrag von Dr.
Ludwig Landau (1935)
- Dr.
Paul Tänzer referiert über den Zionistenkongress - Lehrer Spier über den
Zionismus - Anfängerkurs in Neuhebräisch - Organisation der Jüdischen
Winterhilfe (1935)
- Chanukkafeier im
Dezember 1935 (1936)
- Konzertveranstaltung
der "Jüdischen Kulturgemeinde Schwarzwald" (1936)
- Kulturelle Veranstaltungen
im Frühjahr 1936 (1936)
- Kulturelle
Veranstaltungen in den ersten Monaten des Jahres 1937 (1937) |
 | Berichte zu einzelnen Personen
- Schwerer
Diebstahl an Josua Hirsch von Haigerloch (1839)
- Mitteilung
betreffs der Verlassenschaft des Jakob Hilb (1844)
- Josua
Hirsch von Haigerloch wurde Opfer eines Diebstahles in Donaueschingen
(1844)
- Julius
Ullmann erhält im Krieg 1871 das Eiserne Kreuz
- Nachruf zum Tod von Oberamtmann Emele (1893)
- Zum Tod von Therese Levy
(1900)
- Zum
80. Geburtstag von Stadtrat David Levi (1900)
- Zum Tod von Klara Levi
(1927)
- Zum
80. Geburtstag von Salomon Hilb in Ulm, Sohn von Rabbiner Maier Hilb
in Haigerloch (1928)
- Zum Tod von Veit Hilb
(1929)
- Zum
Tod des früheren Gemeindevorstehers Moritz Levi (1930)
- Zum
Tod von Bertha Ullmann geb. Adler (1931)
- Zum
Tod von Eugen Nördlinger (geb. in Laupheim, gest. in Haigerloch
1931)
- Zum Tod von Wolf
Reutlinger I (1931)
- 70.
Geburtstag von Abraham Hilb (1931)
- Zum
Tod von Ernestine Levi geb. Levi sowie ihrer Tochter Babette Levi (1932)
- Zum Tod von Benno
Kappenmacher (1932)
- 85.
Geburtstag von Simon Ullmann - Zum Tod von Klärle Ullmann
(1933)
- Dokument
zur Goldenen Hochzeit von Wolf Reutlinger und seiner Frau Henriette (Juli
1933)
- Postkarte
an Familie Josef Hirsch in Haigerloch von E. Picard (1939)
- Zum
Tod von Berta Guttmann aus Hechingen (geb. und gest. in Haigerloch 1933)
- 85. Geburtstag
von Heinrich Hilb (1933) |
 | Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe,
Privatpersonen
sowie der Gemeinde
- Matzenbäckerei zu verkaufen (1882)
- Bäckerei zu verkaufen (1892)
- Nach
der Deportation / Emigration: Todesanzeige für Wolf Jacob Levi und Jakob
Maier Levi (beide umgekommen im Ghetto Theresienstadt 1944)
|
 | Weitere Dokumente
- Eintrag
in ein Poesie-Album in Oberdorf von S. Hohenemser aus Haigerloch
(1888)
- Von
Haigerloch nach Genf verschickte Karte (1899)
- Von
Moses Schwab in Haigerloch nach Rangendingen verschickte Postkarte (1917)
)
- Briefumschlag
und Postkarte der Fa. J. B. Reutlinger (1921 / 1928)
- Brief der Firma
Eugen Nördlinger (1929) |
Allgemeine Berichte zur Geschichte der jüdischen
Gemeinde
Erzählung von Dr. Samuel Mayer (Hechingen) über die Erlebnisse eines reisenden
Händlers in Haigerloch Mitte des 18. Jahrhunderts
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. November 1849: "Prag vor hundert Jahren. Erzählung von Dr. Samuel Mayer (Fortsetzung).
Hirsch Weil hatte seit seiner Verbannung aus Prag die Freuden und Leiden
des von ihm gewünschten Landstreicherlebens zur Genüge gekostet. Viele
Israeliten hatten keine bleibende Stätte, wenn sie in einem Staate aus
dem Schutzverbande entlassen und von keinem anderen Schutzherrn
aufgenommen worden sind. Heimatlos wanderten sie durch die Welt und
besuchten alle Orte, wo Glaubensgenossen ansässig waren. Sie wurden
gastfreundlich aufgenommen, denn Gastfreundschaft wird von der
israelitischen Religionslehre sehr empfohlen. War doch Abraham
gastfreundlich gegen die drei unbekannten Männer, die ihn besuchten, und
es ergab sich, dass es drei Engel waren, die er bewirtete. Sie brachten
ihm erfreulich Botschaft. Ist doch Lot gerettet worden, als Gottes Zorn
die Städte Sodom und Gomorrha zerstörte. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. November 1849: "Prag vor hundert Jahren. Erzählung von Dr. Samuel Mayer (Fortsetzung).
Hirsch Weil hatte seit seiner Verbannung aus Prag die Freuden und Leiden
des von ihm gewünschten Landstreicherlebens zur Genüge gekostet. Viele
Israeliten hatten keine bleibende Stätte, wenn sie in einem Staate aus
dem Schutzverbande entlassen und von keinem anderen Schutzherrn
aufgenommen worden sind. Heimatlos wanderten sie durch die Welt und
besuchten alle Orte, wo Glaubensgenossen ansässig waren. Sie wurden
gastfreundlich aufgenommen, denn Gastfreundschaft wird von der
israelitischen Religionslehre sehr empfohlen. War doch Abraham
gastfreundlich gegen die drei unbekannten Männer, die ihn besuchten, und
es ergab sich, dass es drei Engel waren, die er bewirtete. Sie brachten
ihm erfreulich Botschaft. Ist doch Lot gerettet worden, als Gottes Zorn
die Städte Sodom und Gomorrha zerstörte. |
 denn
er war gastfreundlich gegen die als Wanderer verkleideten Engel, als sie
bei ihm einkehrten. So könne man ja noch immer nicht wissen, ob der oder
der andere Gast nicht ein verkleidetes überirdisches Wesen sei? Sind doch
alle Menschen nur Gäste in der Schöpfung Gottes, der sie speise und
bewirte; waren doch besonders die Kinder Israels nur Gäste, welche nicht
wissen konnten, ob sie heute oder morgen von ihren Wohnsitzen vertrieben würden,
sodass auch sie den Wanderstab ergreifen und unstet und flüchtig umher
irren müssten? Darum wurden von den Gemeinden Herbergen, die man 'Schlafstätten' nannte, errichtet, in welchen die Wanderer übernachten
und verweilen konnten. An den Sabbat- und Feiertagen wurden sie bei den
Familien einquartiert, sie erhielten Billets, Blätte genannt, worauf der
Name des Mannes stand, an dessen Tisch sie essen durften. An den Werktagen
hausierten sie mit allerlei Warenartikeln, die sie auf dem Rücken trugen,
weshalb sie auch 'Packenträger' genannt wurden; oder es waren
reisende Schriftgelehrte, welche besonders gut gehandelt und freigebig
beschenkt wurden; oder sie besuchten die Märkte und schnitten den Bauern
die Geldbeutel ab, oder sie trieben das Handwerk der Taschendiebe oder der
linken Geldwechsler. Was sie erbettelten und erwarben, verprassten sie
wieder in den Schlafstätten. Sie heirateten Glaubensgenossinnen und
zeugten Kinder, die zu demselben Gewerbe erzogen wurden. Der Name eines
Gastes oder Orach wurde zur Bezeichnung eines garstigen, schmutzigen und
zudringlichen Menschen gebraucht, aber dennoch die Gastfreundschaft gegen
sie nicht verletzt, bis man vor einem viertel Jahrhunderte den unsteten
Wanderern von Staatswegen bleibende Stätten in den Gemeinden angewiesen
hat, in welchen sie geboren, oder beschnitten, oder getraut, oder
aufgegriffen worden waren. denn
er war gastfreundlich gegen die als Wanderer verkleideten Engel, als sie
bei ihm einkehrten. So könne man ja noch immer nicht wissen, ob der oder
der andere Gast nicht ein verkleidetes überirdisches Wesen sei? Sind doch
alle Menschen nur Gäste in der Schöpfung Gottes, der sie speise und
bewirte; waren doch besonders die Kinder Israels nur Gäste, welche nicht
wissen konnten, ob sie heute oder morgen von ihren Wohnsitzen vertrieben würden,
sodass auch sie den Wanderstab ergreifen und unstet und flüchtig umher
irren müssten? Darum wurden von den Gemeinden Herbergen, die man 'Schlafstätten' nannte, errichtet, in welchen die Wanderer übernachten
und verweilen konnten. An den Sabbat- und Feiertagen wurden sie bei den
Familien einquartiert, sie erhielten Billets, Blätte genannt, worauf der
Name des Mannes stand, an dessen Tisch sie essen durften. An den Werktagen
hausierten sie mit allerlei Warenartikeln, die sie auf dem Rücken trugen,
weshalb sie auch 'Packenträger' genannt wurden; oder es waren
reisende Schriftgelehrte, welche besonders gut gehandelt und freigebig
beschenkt wurden; oder sie besuchten die Märkte und schnitten den Bauern
die Geldbeutel ab, oder sie trieben das Handwerk der Taschendiebe oder der
linken Geldwechsler. Was sie erbettelten und erwarben, verprassten sie
wieder in den Schlafstätten. Sie heirateten Glaubensgenossinnen und
zeugten Kinder, die zu demselben Gewerbe erzogen wurden. Der Name eines
Gastes oder Orach wurde zur Bezeichnung eines garstigen, schmutzigen und
zudringlichen Menschen gebraucht, aber dennoch die Gastfreundschaft gegen
sie nicht verletzt, bis man vor einem viertel Jahrhunderte den unsteten
Wanderern von Staatswegen bleibende Stätten in den Gemeinden angewiesen
hat, in welchen sie geboren, oder beschnitten, oder getraut, oder
aufgegriffen worden waren.
Einen solchen genussreichen Lebenswandel hatte auch Hirsch vierzig Jahre
lang mit großem Behagen geführt. Aber jetzt wurden seine Haare grau, er
fühlte die Schwäche des Alters nahen. Er sehnte sich nach einer Ruhestätte,
denn er hatte ausgetobt, und dachte über seinen jugendlichen Leichtsinn
nach, der ihn in die Welt hinausgetrieben hatte. Ein Gast hatte ihm
gesagt, dass sein alter Vater noch lebe, und dunkle Gefühle der Sehnsucht
nach ihm regten sich mächtig in seinem Herzen. Ein besonderer Umstand
fachte dieses Gefühl zum unwiderstehlichen Heimweg an.
Auf seinen ewigen Wanderzügen kam er auch, mit seiner kinderlosen Frau,
einer Korallenfabrikantin, deren Herz sich auf der Landstraße ohne
weitere Prüfung zu seinem Herzen gefunden hatte, in den Schwarzwaldkreis.
Er wollte die Gegend sehen, in welcher sein Vater und Großvater gewohnt
hatten. So kam er auch nach Haigerloch in dem Fürstentum
Hohenzollern-Sigmaringen, wo Raphael Benjamin Gemeindevorsteher war. Sein
haus war wegen der in demselben herrschenden Gastfreundschaft allen Gästen
in der Nähe und Ferne wohl bekannt. Die Gemeinden in dieser Gegend waren
noch jung und aufblühend, denn erst seit kurzer Zeit durften sich hier
Israeliten niederlassen. Bei dem Anfang des vorigen Jahrhunderts kamen
mehrere Israeliten nach Hohenzollern-Hechingen, und der damalige Fürst
Friedrich Wilhelm erlaubte ihnen, kraft des auf die Dauer von zehn Jahren
dekretierten Schutzbriefes, in den Dörfern des Fürstentums sich
niederzulassen. Sein Nachfolger, der Fürst Friedrich Ludwig, erteilte
ihnen zwar keinen Schutzbrief, aber er duldete sie stillschweigend. Auch
die Fürsten von Sigmaringen, die Grafen und Barone von Mühringen,
Baisingen, Rexingen und Nordstetten gestatteten ihnen die Ansiedlungen. In
dem Blute Israels liegt eine magnetische Kraft, welche die Kinder des
Volkes durch eine innere Sympathie schnell vereinigt und verbindet. Bald
kamen noch mehrere Glaubensgenossen in diese Orte und ließen sich häuslich
nieder, denn im Herzogtum Württemberg waren seit dem gewaltsamen Tode des
Finanzministers Süß Oppenheim die Gesetze gegen die Juden in der Art
wieder geschärft worden, dass sie sich in diesem Staate nicht
niederlassen durften und sobald sie das Gebiet betraten, einen Geleitsmann
erhielten, der sie bis an die Grenze führten musste. Die Gemeinden
schlossen sich daher eng aneinander an und lebten gemeinschaftlich in
Eintracht und Frieden. Jetzt erwarteten sie die Rückkunft Raphaels, denn
der Rabbiner in Stein bei Hechingen war tot, und man wollte einen
Landrabbiner anstellen, der seinen Sitz in Mühringen haben sollte.
Am Fasttage Ester kam Hirsch nach Haigerloch in den Haag, eine abgelegene
Talgasse, wo die Israeliten wohnen durften. Er ließ seine Frau in der
Schlafstatt ausreihen und begab sich in das niedere Häuschen des
Vorstehers, dessen Frau, Rebekka, mit der Zubereitung der Backwerke für
das Purimfeste beschäftigt war. Sie war eine herzliche gute Frau; aber
sie hatte die Gewohnheit, alle Menschen, die sie besuchten, zuerst zu
schelten und dann ihnen große Ehre zu erweisen, Nahrung in Überfluss
vorzusetzen und reichliche Gaben zu spenden. |
 '"Woher
seid Ihr?' rief sie dem eintretenden Packenträger zu. 'Von Prag',
war die kurze Antwort. 'Von Prag? So seid Ihr falsch wie Galgenholz,
denn alle Böhmen sind falsch.' Hirsch, der von ihr gehört zu haben
schien, überhörte den höflichen Gruß. 'Brauchen Sie keine Messer und
Gabeln?' fragte er im Handelstone. 'Nein, behaltet sie für Euch!' 'Braucht sie keine Niederländer Spitzen?'
'Ja,' antwortete sie
eifrig und freundlich, 'kommt her, lasst sie sehen!'
Hirsch aber erwiderte höhnisch: 'Spitzen will Sie haben, aber
Messer und Gabeln verlangt Sie nicht? Sie kann sehen, wo Sie bekommt!'
Rebekka überhäufte ihn mit einem Schwall von Schimpfwörtern,
aber Hirsch lachte ihr ins Gesicht, dass sie wider Willen mitlachen
musste. Er forderte dreist seinen Anteil an den Backwerken, den er auch
erhielt. Während er mit dem Einpacken beschäftigt war, fragte sie ihn,
ob er schon lange nicht in Regensburg gewesen sei? Dort wohne die
Schwester ihrer Mutter. 'Ich komme von Regensburg,' entgegnete er,
indem er den ekelhaften Saft des im Munde käuenden Rauchtabaks zwischen
den Zähnen hervorspritzte. 'Als ich fort ging, ist ein großes Unglück
geschehen. Ein fremder, junger Mann, ich glaube, es war der hiesige
Vorsteher, ist plötzlich an einem Schlagfluss gestorben.' 'Sch'ma
Israel! Das ist mein Mann, mein guter Mann!' schrie die Frau, indem sie
die Haube vom Kopfe riss und sich jammernd auf den Boden warf. 'Steh'
Sie jetzt wieder auf,' lachte Hirsch, 'ich habe schon gesehen, dass
Sie in Einer Minute brav und bös sein, lachen und weinen kann. Ihr Mann
ist frisch und gesund und kann jeden Augenblick heimkommen.' Eben trat
Raphael zur Stube herein. Er fragte erschrocken, was diese Trauer bedeute,
worauf sie erzählte, was der Gast gesagt habe. 'Ich habe', ergänzte
Hirsch, 'mit Eurer Frau Komödie gespielt. Sie hat mir gemacht ein
Trauerspiel zum Lachen, darum habe ich ihr ein Lustspiel zum Weinen
gemacht'. Da lächelte der Vorsteher und sprach sehr heiter: 'Ihr habt
ganz recht getan, dass Ihr meine Frau erschreckt habt, denn sie wird Euch
gewiss gescholten haben. Zum Lohne sollt Ihr morgen bei mir zu Gast
geladen sein.' Hirsch nahm mit Freude die Einladung an. Am Tische musste
er von seinen Schicksalen und Abenteuern erzählen. Diese Mitteilungen
regten einen unendlichen Kummer in ihm auf, denn alle Menschen, die von
ehrbarer Familie abstammen, aber sich ihres Glückes durch die eigene
Torheit berauben, empfinden in manchen Stunden eine tiefe innere Reue, während
die Personen, die seit ihrer Kindheit das Beispiel moralischer
Verderbtheit vor Augen sahen, in Sünden und Lastern verstockt bleiben. '"Woher
seid Ihr?' rief sie dem eintretenden Packenträger zu. 'Von Prag',
war die kurze Antwort. 'Von Prag? So seid Ihr falsch wie Galgenholz,
denn alle Böhmen sind falsch.' Hirsch, der von ihr gehört zu haben
schien, überhörte den höflichen Gruß. 'Brauchen Sie keine Messer und
Gabeln?' fragte er im Handelstone. 'Nein, behaltet sie für Euch!' 'Braucht sie keine Niederländer Spitzen?'
'Ja,' antwortete sie
eifrig und freundlich, 'kommt her, lasst sie sehen!'
Hirsch aber erwiderte höhnisch: 'Spitzen will Sie haben, aber
Messer und Gabeln verlangt Sie nicht? Sie kann sehen, wo Sie bekommt!'
Rebekka überhäufte ihn mit einem Schwall von Schimpfwörtern,
aber Hirsch lachte ihr ins Gesicht, dass sie wider Willen mitlachen
musste. Er forderte dreist seinen Anteil an den Backwerken, den er auch
erhielt. Während er mit dem Einpacken beschäftigt war, fragte sie ihn,
ob er schon lange nicht in Regensburg gewesen sei? Dort wohne die
Schwester ihrer Mutter. 'Ich komme von Regensburg,' entgegnete er,
indem er den ekelhaften Saft des im Munde käuenden Rauchtabaks zwischen
den Zähnen hervorspritzte. 'Als ich fort ging, ist ein großes Unglück
geschehen. Ein fremder, junger Mann, ich glaube, es war der hiesige
Vorsteher, ist plötzlich an einem Schlagfluss gestorben.' 'Sch'ma
Israel! Das ist mein Mann, mein guter Mann!' schrie die Frau, indem sie
die Haube vom Kopfe riss und sich jammernd auf den Boden warf. 'Steh'
Sie jetzt wieder auf,' lachte Hirsch, 'ich habe schon gesehen, dass
Sie in Einer Minute brav und bös sein, lachen und weinen kann. Ihr Mann
ist frisch und gesund und kann jeden Augenblick heimkommen.' Eben trat
Raphael zur Stube herein. Er fragte erschrocken, was diese Trauer bedeute,
worauf sie erzählte, was der Gast gesagt habe. 'Ich habe', ergänzte
Hirsch, 'mit Eurer Frau Komödie gespielt. Sie hat mir gemacht ein
Trauerspiel zum Lachen, darum habe ich ihr ein Lustspiel zum Weinen
gemacht'. Da lächelte der Vorsteher und sprach sehr heiter: 'Ihr habt
ganz recht getan, dass Ihr meine Frau erschreckt habt, denn sie wird Euch
gewiss gescholten haben. Zum Lohne sollt Ihr morgen bei mir zu Gast
geladen sein.' Hirsch nahm mit Freude die Einladung an. Am Tische musste
er von seinen Schicksalen und Abenteuern erzählen. Diese Mitteilungen
regten einen unendlichen Kummer in ihm auf, denn alle Menschen, die von
ehrbarer Familie abstammen, aber sich ihres Glückes durch die eigene
Torheit berauben, empfinden in manchen Stunden eine tiefe innere Reue, während
die Personen, die seit ihrer Kindheit das Beispiel moralischer
Verderbtheit vor Augen sahen, in Sünden und Lastern verstockt bleiben.
Raphael bezeigte ihm seine Teilnahme und machte ihm Hoffnung, dass er
wieder nach Hause dürfe, denn man werde ihn nach Abfluss eines solchen
langen Zeitraums gewiss nicht mehr erkennen. 'Ich selbst,' fügte er
bei, 'werde, da ich ohnedies Geschäfte in Böhme abzumachen habe, etwa
im nächsten Dezember nach Prag kommen, um einen gemeinschaftlichen
Rabbiner für unsere Gemeinden zu holen, denn in Prag gibt es ja große
Schriftgelehrte, welche sich freuen werden, eine gute Anstellung zu
erhalten. Um jene Zeit komme ich nach Prag und ich will sehen, was sich für
Euch tun lässt.' Hirsch war hoch erfreut über diesen Antrag, der ihm
wie aus der Seele gesprochen war. Sein Mund übersprudelte von den Ausdrücken
des tiefsten Dankgefühles, aber auch von dem Lobe, das er dem Sohne
seines Onkels, dem Appellanten Nethanel Weil, zollte, da er demselben das
Los eines Landrabbiners des Schwarzwaldkreises umso mehr wünsche, als die
Frau Vorsteherin zwar eine bittere Zunge, aber ein desto süßeres Herz
habe.
Rebekka schmunzelte freundlich beistimmend, Raphael beschenkte ihn großmütig,
und Hirsch trat seine Wanderung nach dem angewiesenen Ziele an, in dessen
Nähe angekommen, sein Herz gewaltig pochte, da er durch verschiedene
Gegenstände an die glückliche Jugendzeit erinnert wurde. Er wagte es
aber nicht, die Stadt zu betreten, und sah sich ängstlich nach allen
Seiten um, ob seine Frau, die im letzten Dorfe zurückgeblieben, während
er sehnsuchtsvoll vorausgeeilt war, noch nicht kommen werde. Dadurch wurde
er verdächtig und festgesetzt, als eben seine Frau ankam. Sie heulte ihm
jammernd nach und bat um seine Freilassung, aber sie wurde mit Kolbenstößen
zurückgetrieben. Schreiend eilte sie zu den Gemeindeältesten, die sehr
erschraken bei dieser Kunde, denn sie fürchteten, dass dieser Umstand zum
Beweis ihrer Schuld benützt werden möchte. Sie beschlossen daher, die
Ungnade des Machthabers durch ein kostbares Geschenk abzuwenden. Landau
aber hatte richtig geurteilt. Der Herr nahm das Geschenk an und tat
dennoch, was er wollte." |
Besuch
der Autorin Margarete Marasse in Haigerloch und
ihr Bericht (1918)
Anmerkung: nach Angaben des Jüdischen Biographischen Archivs
ist die Autorin Margarete Marasse geb. Wolff (Pseudonym: M. Morgan) am 23.
November 1854 geboren. Sie lebte zuletzt (1938) in Berlin. Ihr weiteres
Schicksal konnte nicht geklärt werden.
Herzlichen Dank für diesen Hinweis an Georg Trettin, Frankfurt.
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. April 1918: "Die Juden von
Haigerloch. Von Margarete Marasse. Das kleine hohenzollernsche Bergstädtchen
Haigerloch, wie Hechingen und Sigmaringen dem preußischen Staate zugehörig,
obgleich im schwäbischen Gebiet, besitzt der Beziehungen viele zu
mittelalterlichen Geschichte, zum Minnesang, zur Romantik und zur Kunst
des Barock. Auch landschaftlich lugt der wenig bekannte Ort sehr merkwürdig
über der wilden Eyachschlucht ins Grüne. In heiliger Einsamkeit, geschützt
von drohenden Tannen auf starrem Fels, scheint er der gewitterschwülen,
der furchtbaren Zeit zu trotzen. Eine seltsam zusammengesetzte Bevölkerung,
Dinge gegensätzlicher Art, die da droben zwischen den Burger friedlich
nebeneinander ruhen, veranlassen mich, Haigerloch an dieser Stelle ein
warmes Wort zu weihen. Die Geschichte der Ansiedlung, die ich lapidar
wiedergeben möchte, bietet nicht gerade Ungewöhnliches: ums Jahr 1061 in
den Besitz der Zollern, die sich erst seit dem 13. Jahrhundert auch 'Hohenzollern' nannten, gelangt, wurde Haigerloch von Rudolf von
Habsburg zur Stadt erhoben und überflügelte bald alle die anderen
kleinen Residenzen in der Umgegend. Mit einer Unterbrechung von etwas über
100 Jahren blieb es bis auf den heutigen Tag unter hohenzollernscher
Herrschaft. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. April 1918: "Die Juden von
Haigerloch. Von Margarete Marasse. Das kleine hohenzollernsche Bergstädtchen
Haigerloch, wie Hechingen und Sigmaringen dem preußischen Staate zugehörig,
obgleich im schwäbischen Gebiet, besitzt der Beziehungen viele zu
mittelalterlichen Geschichte, zum Minnesang, zur Romantik und zur Kunst
des Barock. Auch landschaftlich lugt der wenig bekannte Ort sehr merkwürdig
über der wilden Eyachschlucht ins Grüne. In heiliger Einsamkeit, geschützt
von drohenden Tannen auf starrem Fels, scheint er der gewitterschwülen,
der furchtbaren Zeit zu trotzen. Eine seltsam zusammengesetzte Bevölkerung,
Dinge gegensätzlicher Art, die da droben zwischen den Burger friedlich
nebeneinander ruhen, veranlassen mich, Haigerloch an dieser Stelle ein
warmes Wort zu weihen. Die Geschichte der Ansiedlung, die ich lapidar
wiedergeben möchte, bietet nicht gerade Ungewöhnliches: ums Jahr 1061 in
den Besitz der Zollern, die sich erst seit dem 13. Jahrhundert auch 'Hohenzollern' nannten, gelangt, wurde Haigerloch von Rudolf von
Habsburg zur Stadt erhoben und überflügelte bald alle die anderen
kleinen Residenzen in der Umgegend. Mit einer Unterbrechung von etwas über
100 Jahren blieb es bis auf den heutigen Tag unter hohenzollernscher
Herrschaft.
Die schwäbische Habe dieses Hauses wurde im Jahre 1575 geteilt.
Eitelfriedrich IV. erhielt Hechingen, Karl Sigmaringen, Christoph, der
nachmalige Erbauer der schönen spätgotischen Schlosskirche mit ihrem prächtigen
holzbemalten Hochalter in Haigerloch, diese emporblühende Stadt. Die drei
genannten Glieder der jüngeren schwäbischen Linie sind die Stifter der
Nebenzweige des hohenzollernschen Hauses geworden. Heute sind diese
Gebiete wieder vereinigt. Am frühestens – im Jahre 1634 – erlosch die
Linie Haigerloch. Nie verband ein rastloser Strom des Verkehrs das Städtchen
mit der Außenwelt, ein gutes Motiv zur Erhaltung der Eigenart. Wer jetzt
die lohnende Fußwanderung scheut, der vertraut sich einer klingelnden
Kleinbahn an, die langsam und behäbig bergauf kriecht.
Ein Fluß in krausen Wirbeln, über dem im Spätherbst die Nebel brauen,
Wiesen und Wälder, der Burgruinen graue Schatten begleiten den
Schienenweg. Wie ein feiner, alter Stich harmonischer Architektur liegt plötzlich
das Ziel vor den Augen des sinnfrohen Reisenden. Auf steilen Felsen zu
beiden Seiten der Eyach, die ein Zustrom des Neckars ist, ragen die
Zollernschlösser. Stattliche Dome, ein imposanter frühmittelalterlicher
Turm grüßen die Sonne, die der Nebel Herr geworden. Ich gestehe es gern,
auf mich war der Eindruck ein wesentlich stärkerer als jener der
Zollernburg, der Wiege unseres |
 Herrscherhauses,
am Rande der Rauen Alb, die Friedrich Wilhelm IV. allzu anspruchsvoll und
mit geringem Stilgefühl wieder aufgebaut. So kunsthistorisch Schloss und
Schlosskirche, die man nach Überwindung vieler Stufen besucht, so
reizvoll der Rokokobau der St. Annakirche auch ist, ich enthalte mich,
hier davon zu sprechen. Ebenso erscheint es überflüssig, dabei zu
verweilen, dass neben diesen beiden katholischen Gottes eine evangelische
Kirche ihren Platz behauptet. Indessen die jüdische Kolonie mit ihrem
Tempelchen in diesem weltentrückten Ort der Verbrüderung konnte
Erstaunen erregen und verdient ein kurzes Wort der Würdigung. Der Hügel
hinter der evangelischen Kirche, 'Haag' genannt, wird ausschließlich
von dem Volk der wunderbaren Lebenskraft bewohnt. Ein freiwilliges Getto
in einem Garten Gottes. Denn nicht in traurigen Winkelgassen wühlen
Ausgestoßene im Lumpenkram, nicht in dunklen Türöffnungen sticken und
stopfen die armen Töchter Zions. Nein, in ländlichen Wohnhäusern auf
lieblichem Boden führen die Kinder Jehovas bei vielgestaltigen Beschäftigungen
ein menschenwürdiges Dasein. Herrscherhauses,
am Rande der Rauen Alb, die Friedrich Wilhelm IV. allzu anspruchsvoll und
mit geringem Stilgefühl wieder aufgebaut. So kunsthistorisch Schloss und
Schlosskirche, die man nach Überwindung vieler Stufen besucht, so
reizvoll der Rokokobau der St. Annakirche auch ist, ich enthalte mich,
hier davon zu sprechen. Ebenso erscheint es überflüssig, dabei zu
verweilen, dass neben diesen beiden katholischen Gottes eine evangelische
Kirche ihren Platz behauptet. Indessen die jüdische Kolonie mit ihrem
Tempelchen in diesem weltentrückten Ort der Verbrüderung konnte
Erstaunen erregen und verdient ein kurzes Wort der Würdigung. Der Hügel
hinter der evangelischen Kirche, 'Haag' genannt, wird ausschließlich
von dem Volk der wunderbaren Lebenskraft bewohnt. Ein freiwilliges Getto
in einem Garten Gottes. Denn nicht in traurigen Winkelgassen wühlen
Ausgestoßene im Lumpenkram, nicht in dunklen Türöffnungen sticken und
stopfen die armen Töchter Zions. Nein, in ländlichen Wohnhäusern auf
lieblichem Boden führen die Kinder Jehovas bei vielgestaltigen Beschäftigungen
ein menschenwürdiges Dasein.
Freilich habe ich später erfahren, dass auch hier der Handel, der
Viehhandel, in den Händen dieser Männer, die sich Levi, Behr, Hirsch,
Hohenemser usw. nennen und die sich äußerlich die ausgeprägten Merkmale
ihrer Rasse erhalten haben, liegt, jedoch ohne dass diese dadurch ein
weniger geachtetes Element der Einwohnerschaft bilden, ohne in irgendeinem
anderen Gewerbe oder Handwerk behindert zu werden. Es war mir nicht ganz
leicht, die Synagoge zu entdecken, denn sie ist kein 'auf Säulen
ruhender Tempel, innen mit köstlichen Teppichen und goldenem Bildwerk von
Granaten und Blumen ausgeziert', wie es der älteste jüdische Tempelbau
im trasteverinischen Rom gewesen, jene prächtige Synagoge, die 300 Jahre
früher als der St. Peter und der Lateran entstanden. Hier handelt es sich
um ein einfaches Bethaus. Der Spruch über der unverschlossenen Tür: 'Gesegnet, wer kommt im Namen Gottes' begrüßt feierlich und
freundlich den Eintretenden. Nur begleitet von zwei rotblonden Mädelchen,
macht ich mir den Versammlungsort der frommen Gemeinde zu eigen. Außer
den Kronen von graziösen Formen ist mir Bemerkenswertes nicht
aufgefallen. Und doch liegt ein Ahnen von etwas Unnennbarem, Unfassbarem
in dem Raum, der das 'Amen und lobe den Herrn' so vieler Gläubigen
auffängt. Vielleicht ging vor Jahrzehnten bei der Renovation der Synagoge
und des Gemeindehauses auch heiliges Gerät verloren. Jedenfalls ist der
Vergangenheit der Gemeinde in Haigerloch – ich habe mir deswegen viel Mühe
gegeben – schwer nachzuspüren.
Tatsache ist, wie mir vom israelitischen Vorsteheramt in Haigerloch
freundlichst geschrieben wird, 'dass damals bei der erwähnten
Restauration alle Gemeindeakten der älteren und ältesten Zeit, die nach
den obwaltenden Bildungsverhältnissen der deutschen Juden nur in jüdischer
bzw. jüdisch-deutscher Schrift abgefasst waren, mit den alten,
unbrauchbar gewordenen hebräischen Büchern heiligen Inhalts, so
genannten Schéaus und Seforim, auf dem israelitischen Kirchhof begraben
worden seien und damit der Vernichtung anheimgegeben, weil man sie für
heilige Bücher, unbrauchbare, hielt. Ein Rabbiner, der dies verhindert hätte,
war gerade nicht in der Gemeinde.'
Auf das beträchtliche Alter dieser Kolonie kann man trotz fehlender
Dokumente aus der Vergangenheit – die Gemeinde bewahrt nur einen
Judenschutzbrief aus dem 18. Jahrhundert und das Bürgermeisteramt einen
ähnlichen – durch einen nicht mehr benutzten Friedhof schließen. In
der feierlichen Ruhe des Waldes soll 'der gute Ort' mit Grabsteinen
aus dem 15. und 16. Jahrhundert zu finden sein. Zu später ward mir davon
die Kunde.
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese wie im Gelobten Land auch
Ackerbau treibenden Semiten 'bis zu den dreißiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts nicht nur in konfessioneller, sondern auch in politischer
Hinsicht vollkommen selbständig unter einem Judenschultheiß wirkten'.
Aus freundlicher jüdischer Feder, durch den Herrn Vorsitzenden und
Rabbinatsverweser Wallach, erhielt ich nachträglich schätzenswertes
Material für diese Skizze. An Ort und Stelle vernahm ich aus christlichem
Munde manch kluges und ehrliches Wort über das versprengte Volk im
Schutze des so genannten Römerturms, des weithin sichtbaren Wahrzeichens
von Haigerloch. Der intelligente Buchbinder, bei dem ich als Fingerzeig
die illustrierte Postkarte erstand, der seinem Unmut gegen den Krieg kräftigen
Ausdruck verlieh, stellte als Lokalfortschritt im Weltunfrieden den
uneingeschränkten Religionsfrieden in Haigerloch fest. Reibungen und
Missverständnisse unter den Konfessionen waren auch früher nicht zu
beklagen, indessen wurde die Schuljugend von zwei katholischen, einem
protestantischen und einem jüdischen Berufenen in die Geheimnisse des
Wissens eingeführt. Nun, da jene eingezogen, sitzen alle die Männlein
und Weiblein auf einer Schulbank, und – 'sie beißen sich nicht', so
schloss der Berichterstatter lachend.
Über die Entstehung des Getto, des 'Haag', lauft eine anmutige
Legende im lande herum. Was das Volk im bunten Traum sich selbst baut, das
lohnt stets der Mühe, aufgefangen zu werden. Ein Ritter aus der
Gefolgschaft des Haigerlocher Fürsten lernte an einem
sonnendurchleuchteten Tage auf Kriegspfaden ein schönes Judenmädchen
kennen. Bei seinem rauen Bewerbe rührten ihn die sanften Taubenaugen, und
lieblich erschien ihm der Jungfrau Rede. Er begehrte sie zum Weibe, und da
ihre Angehörigen den Übertritt zum Judentum zur Bedingung machten, erbat
und erhielt er von dem Fürsten, dem weisen Fürsten, die Erlaubnis zu
freiem Tun. In der Burg von Haigerloch, unter Wipfeln mit duftendem Laub,
genoss er sein junges Eheglück. Aber das Sehnen, das große Sehnen nach
ihrem Volke überfiel die holdselige Frau. Joseph, da ihm in den stolzen
Pharaonengemächern der Tod nahte, nahm seinen Brüdern einen heiligen Eid
ab. Er verlangte, dass seine Gebeine in das Land, das Gott Abraham, Isaak
und Jakob geschworen hatte, überführt wurden.
In nicht mehr biblischer Zeit sehnte sich eine Tochter Jerusalems in
voller Lebenslust nach den feurigen Augen der Genossinnen. Selbst in der
Freude ihres Herzens suchte sie jene, die ihre Seele liebte. Der Fürst,
an den sich der Ritter abermals wandte, verschloss ihm sein Ohr nicht.
Mitleidsvoll gestattete er dem Volke, das den Geboten Jehovas gehorchte,
sich im Schatten seiner Burg anzusiedeln. Sobald der Ruf ertönte, eilten
die Hebräer herbei. Ledig und frei vom Zwange des Berufs bebauten sie den
Hügel, den der kleine Fuß der treu gesinnten Rittersfrau so oft
beschritt. Noch heute stehen Reste der fürstlichen Burg und sind von
Israeliten bewohnte. Eine jüdische Gastwirtschaft: 'Zum Fürsten
Josef' erinnert an vergangene Zeiten. In der Stadt des Minnesängers
Grafen Albrecht von Haigerloch, der ein Schwager Rudolfs von Habsburg
gewesen, ist dies ein Geschichtlein, in dem sich Wahrheit und Dichtung
harmonisch gepaart. |
 Der
Wunsch, Proselyten zu machen, liegt nicht eigentlich im Judentum. Zu fest
wurzelt der Glaube an die lebendige Kraft der monotheistischen Lehre, als
dass man zu dem Mittel der Überredung gegriffen. Indessen die Weisheit
und Schönheit der Lehre ließ sich niemals unterdrücken. Historiker erzählen,
dass die Bürger des verfallenden Rom den tief religiösen Charakter der
Hebräer anstaunten und dass nicht wenige in den moralischen Bann des
Judentums gerieten. So sei die frevelhafte Poppäa, Neros Gemahlin, zur
Synagoge übergetreten und habe nur als Jüdin begraben sein wollen. In
Haigerloch, so geht der fromme Glaube, war es Gott selbst, der Berge
versetzt, ehe die Menschen es inne geworden." Der
Wunsch, Proselyten zu machen, liegt nicht eigentlich im Judentum. Zu fest
wurzelt der Glaube an die lebendige Kraft der monotheistischen Lehre, als
dass man zu dem Mittel der Überredung gegriffen. Indessen die Weisheit
und Schönheit der Lehre ließ sich niemals unterdrücken. Historiker erzählen,
dass die Bürger des verfallenden Rom den tief religiösen Charakter der
Hebräer anstaunten und dass nicht wenige in den moralischen Bann des
Judentums gerieten. So sei die frevelhafte Poppäa, Neros Gemahlin, zur
Synagoge übergetreten und habe nur als Jüdin begraben sein wollen. In
Haigerloch, so geht der fromme Glaube, war es Gott selbst, der Berge
versetzt, ehe die Menschen es inne geworden." |
Bericht eines Reisenden über seine Eindrücke vom jüdischen Haigerloch
(1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. September 1921:
"Ganz anders (sc. im Vergleich zu der nicht mehr bestehenden Gemeinde
Dettensee) steht es in dem im nahen Hohenzollern gelegenen Städtchen Haigerloch. Die Lage dieses Ortes ist durch die Natur auch recht
begünstigt, wenn auch die Waldungen nicht so reich, dicht und schattig
sind wie im nahen Mühringen. Aber eine blühende jüdische Gemeinde habe
ich hier kennen gelernt. Zahlreiche jüdische Kinder beleben die Straßen,
und mir scheint, dass hier die Juden in einem frei gewählten Ghetto in
der Nähe der schönen Synagoge wohnen. Ich will nicht verschweigen, dass
mir einzelne Stammesbrüder einen dementsprechenden Eindruck machten. In
der Nähe der Synagoge liegt auch gleich der wohl gepflegte 'Gute Ort' (sc.
Friedhof). Alles beieinander, wie bei den christlichen Mitbürgern auch.
Auch ein stattlicher jüdischer Gasthof ist vorhanden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. September 1921:
"Ganz anders (sc. im Vergleich zu der nicht mehr bestehenden Gemeinde
Dettensee) steht es in dem im nahen Hohenzollern gelegenen Städtchen Haigerloch. Die Lage dieses Ortes ist durch die Natur auch recht
begünstigt, wenn auch die Waldungen nicht so reich, dicht und schattig
sind wie im nahen Mühringen. Aber eine blühende jüdische Gemeinde habe
ich hier kennen gelernt. Zahlreiche jüdische Kinder beleben die Straßen,
und mir scheint, dass hier die Juden in einem frei gewählten Ghetto in
der Nähe der schönen Synagoge wohnen. Ich will nicht verschweigen, dass
mir einzelne Stammesbrüder einen dementsprechenden Eindruck machten. In
der Nähe der Synagoge liegt auch gleich der wohl gepflegte 'Gute Ort' (sc.
Friedhof). Alles beieinander, wie bei den christlichen Mitbürgern auch.
Auch ein stattlicher jüdischer Gasthof ist vorhanden.
Haigerloch hat sogar einen jüdischen Männergesangverein von
ungefähr 50 Mitgliedern, welcher in der Zeit meines Dortseins von
Sängerfesten zweimal preisgekrönt heimkehren durfte. Ich habe niemals
gehört, dass der Antisemitismus dort größer ist wie anderswo. Im
Gegenteil, die Heimkehrenden, die ihrer Heimat Ehre gemacht hatten, wurden
von der ganzen Einwohnerschaft unter Jubel in ihr Vereinslokal
geleitet.
Die jüdische Schule, die den Antisemitismus nach unserer Meinung so sehr
'befördern soll', wirkt in dieser Gegend klassen-versöhnend,
nicht-trennend. Haigerloch hat natürlich eine gut besuchte jüdische Volksschule
mit einem allseitig verehrten tüchtigen Lehrer.
Auch die Stadt der Hohenzollern-Burg, Hechingen, habe ich aufgesucht und
die dortigen jüdischen Stätten besichtigt. Nur wenige Kinder besuchen
dort die jüdische Volksschule; die meisten Eltern schicken
begreiflicherweise ihre Kinder in die höheren Schulen, die sich am Platze
befinden.
Hechingen und Haigerloch waren einst bedeutende Rabbbinatssitze - die
Lehrer führen daher den Titel 'Rabbinatsverweser'. Reiche Stiftungen sind
in beiden Gemeinden vorhanden für Wohltätigkeit und Beförderung
jüdischen Wissens. Auch Mühringen hat eine Reihe derartiger Stiftungen
und Vereine.
Verfall und Blüte - auch Aufschwung - habe ich also in diesen Gemeinden
bemerken können. Der Weltkrieg hat hier mit seinen Wirkungen teilweise
hemmend gegen die 'Landflucht' eingegriffen. Wohnungsnot wie
Nahrungsmittelteuerung und die sonstigen Unannehmlichkeiten haben dem
Juden auf dem Lande erst den Wert der Heimat nahegebracht.
Der Zug nach der Großstadt scheint hier für einige Zeit zum Stillstand
gekommen zu sein.
Es gibt sogar Mittel, hier neues jüdisches Leben zu entfachen!
Doch davon ein anderes Mal." |
Beitrag über "Die Juden in Haigerloch" von Lehrer Gustav Spier
(Artikel von
1925)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. März 1925: "Die Juden in Haigerloch. Schon im
16. Jahrhundert haben sich Juden in Haigerloch niedergelassen. 1546 wurde der Junker Jakob von Freiburg mit einer Geldstrafe belegt, weil er mit
'gewehrter Hand' vor das Haus des Juden Meyer zu Haigerloch gekommen und
ihn in in der Nacht herausgerufen. 1548 wird nach einer erhaltenen
Renteirechnung der Judentribut verrechnet. 1566 wird der Jude Irni Schmei
(Schemajah) zu Haigerloch genannt. 1572 werden drei Juden zu Gruol (Schmai, Mendle
und Abraham) und ein Jude (David) zu Zimmern erwähnt. Aus derselben Zeit stammt ein Grabstein auf dem alten Friedhof zu
Haigerloch, der die Jahreszahl 1576/77 trägt (Johann Pfeiffer in Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern
20. 103f).
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. März 1925: "Die Juden in Haigerloch. Schon im
16. Jahrhundert haben sich Juden in Haigerloch niedergelassen. 1546 wurde der Junker Jakob von Freiburg mit einer Geldstrafe belegt, weil er mit
'gewehrter Hand' vor das Haus des Juden Meyer zu Haigerloch gekommen und
ihn in in der Nacht herausgerufen. 1548 wird nach einer erhaltenen
Renteirechnung der Judentribut verrechnet. 1566 wird der Jude Irni Schmei
(Schemajah) zu Haigerloch genannt. 1572 werden drei Juden zu Gruol (Schmai, Mendle
und Abraham) und ein Jude (David) zu Zimmern erwähnt. Aus derselben Zeit stammt ein Grabstein auf dem alten Friedhof zu
Haigerloch, der die Jahreszahl 1576/77 trägt (Johann Pfeiffer in Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern
20. 103f).
Dann schweigen die Nachrichten über die dortigen Juden bis 1653. Damals beschloss der Rat zu Rottweil den in
Offenburg,
Stühlingen (Schweiz), Hechingen und
Haigerloch wohnenden Juden den Handel in der Stadt zu erlauben. (H. Robert Klein, Beiträge zur Geschichte der Juden in Rottweil
S. 36).
Ein Schutzbrief für die Juden zu Haigerloch aus dem Jahre 1701 ist die älteste erhaltene Urkunde. Die
Haigerlocher Bürger fürchteten aber die jüdische Konkurrenz und baten 1717 und
1720 die fürstlichen Behörden, den Juden den
Hausierhandel zu verbieten. Ein vom Fürsten Friedrich Ludwig im Jahre 1735 gewährter Schutzbrief erteilt Ihnen trotzdem weitgehende Handelserlaubnis, von der allerdings der Handel mit Stahl, Eisen, Leder, Tabak, Salz und Salpeter ausgenommen war. Es wird Ihnen freie Religionsübung zugesagt. Als Schutzgeld wird Ihnen für jeden Haushalt eine Jahressteuer von zehn Gulden auferlegt. Der Schutzbrief sollte immer nach Ablauf von zehn Jahren
erneut und für die Erneuerung eine Abgabe von 150 Gulden gezahlt werden. Im Schutzbrief des Jahres 1745 wird erwähnt, dass die Juden neben den Abgaben der übrigen Untertanen ihre Judensteuern zu entrichten
haben.
Als Freund der Juden wird Fürst Josef Friedrich nach alter Überlieferung gerühmt.
Sein Hofjude Samuel Hochstetter, den seine Glaubensgenossen 'Haagschmul' nannten, soll bei ihm in
hoher Gunst gestanden und mancherlei Vergünstigungen für die
Haigerlocher Juden erwirkt haben. Eine von Fürst Josef erlassene Verfügung aus dem Jahre
1748 gibt den
Haigerlocher Bürgern das Recht, von Juden gekaufte Häuser wieder auszulösen. Eine Verfügung von
1767 verbietet sogar den Verkauf von Häusern
an Juden.
Eine Aufzeichnung des Stadt Schultheißen aus den Jahren 1764 und und 1765 nennt
Jakob
Weill, Veith Hilb, Hirsch Weil, Seligmann Isacg, Itzig und Herschel Hilb,
Schlaume Hilb, Veit Josef Hilb, Söligmann, Isag Hirsch, Mayer, Haymann, Boris
und Salomon
Weill (?) und den 'Vorsinger'.
Erst der Schutzbrief des Fürsten Karl Friedrich von 1780 führt zur Gründung des Judenviertels im
Haag. In der Absicht, die Juden 'von der Bürgerschaft abzusondern', wird bestimmt, dass der Fürst im Haag Wohnungen für zehn jüdische Familien errichtet.
Das Geld zum Bau wird von der Judenschaft aufgebracht und zwar als ein Teil der für die Gewährung des Schutzbriefs zu zahlenden
'Recognition'. Sobald der |
 Bau vollendet ist, müssen die Juden, bisher bei zur Miete gewohnt haben, in den
Haag ziehen. Ausgenommen sind die Juden, die eigene Häuser 'in der Stadt' besitzen. Sollte ein Jude ein Haus in der Stadt kaufen, so hat jeder Bürger das Recht, dieses Haus gegen Erstattung der Kaufsumme sich zu
reißen. Bau vollendet ist, müssen die Juden, bisher bei zur Miete gewohnt haben, in den
Haag ziehen. Ausgenommen sind die Juden, die eigene Häuser 'in der Stadt' besitzen. Sollte ein Jude ein Haus in der Stadt kaufen, so hat jeder Bürger das Recht, dieses Haus gegen Erstattung der Kaufsumme sich zu
reißen.
Der Fürst verspricht, einem Sohne aus jeder jüdischen Familie den Schutz zu gewähren, mit der
Einschränkung, dass die Zahl der jüdischen Familien 20 nicht übersteigen darf.
Als Miete hat jede Familie acht Gulden, als Schutzgeld 16 Gulden zu zahlen. Juden, die mit der Zahlung im Rückstand sind, sollen vor das Oberamt geladen und, wenn sie auch dann nicht zahlen, innerhalb 24 Stunden über die Grenze verwiesen werden mit der Verwarnung, das Fürstentum nie wieder zu betreten. Der Judenschaft wird gegen eine jährliche Abgabe von 30 Gulden die Errichtung einer eigenen
'Metzg' erlaubt. Auch soll Ihnen später ein Bauplatz zu einer Synagoge und ein
Begräbnisplatz angewiesen werden.
Im Interesse der christlichen Metzger und der Gerberzunft wird bestimmt, dass jeder Schutzjude jährlich höchstens zwei Stück
Großvieh und und zwei Stück Kleinvieh für den eigenen Haushalt
schächten darf. Das Fleisch der Hinterviertel muss den Haigerlocher
Metzgern zum Kauf angeboten werden. Erst wenn diese auf das Fleisch verzichten, dürfen es die Juden im
Kleinverkauf absetzen. Dieselbe Bestimmung gilt für die Häute der geschächteten Tiere.
Diese Bestimmungen klingen weniger romantisch als die noch heute in Haigerloch lebendige Sage über die Entstehung des Judenviertels im
Haag. Nach dieser soll sich ein Fürst von Sigmaringen in eine Jüdin verliebt und sie zur Frau genommen haben.
Die junge Fürstin fühlte sich aber in ihrem Schlosse nicht glücklich. Sie sehnte sich nach ihren Glaubensgenossen so
sehr, dass sie erkrankte. Nach langem Fragen erfuhr der Fürst von ihrer Sehnsucht und beschloss, sie zu
stillen. Er errichtete in Haigerloch auf dem Hügel, den man den Haag
nannte, ein Schloss, in dem er mit seiner Gemahlin fortan wohnte. Rings um das Schluss aber siedelte er Juden an, dass die Fürstin inmitten ihre
Brüder wohnte. So sei die Judengemeinde in Haigerloch und das Judenviertel im
Haag entstanden.
Die Stimmung der Haigerlocher Bürger bleibt auch in der Folgezeit den Juden wenig günstig. Sie bitten allerdings erfolglos
1792, die Zahl der jüdischen Familien und ihre Handelserlaubnis zu beschränken.
1795 beschließt die Stadt, den Juden kein Holz aus den städtischen Waldungen abzugeben. Sie wird aber vom Oberamt angewiesen, diesen Beschluss
aufzuheben. Auch die Eingabe 'Verordnung zu treffen, dass die Stadt mit Juden nicht allzu sehr überhäuft und durch sie am Ende in das äußerste Elend
und sichere Verderben gestürzt werde' wird abschlägig beschieden. Die Zahl der jüdischen Familien steigt auf 30 (oder 36), die eine eigene politische Gemeinde bilden. Der
'Juden-Barnas' ist zugleich Schultheiss des Haag.
In den beiden letzterwähnten Schriftstücken werden der Barnas Veit Hilb und Jakob
Weil, 1836/37 der Schultheiß Levi genannt.
Die Gemeinde hatten einen Betsaal im Hause eines Juden in der Oberstadt, bis sie eine eigene Synagoge erbaut hat. Der neue Friedhof ist
1803 dicht bei der Besiedlung angelegt werden. Die
Gemeinde war dem Rabbinat Hechingen angeschlossen, bis sie 1820 Raphael Zivi als Rabbiner
für Haigerloch und Dettensee anstellte. Ihm folgte 1836 der der Freund und Studiengenosse Bertold Auerbachs,
Meier Hilb, der in der Talmudschule zu Hechingen, im Lyzeum zu Karlsruhe und auf den Universitäten Heidelberg und Tübingen studiert hatte. Er hat sein Amt bis 1880 versehen. Während seiner Amtszeit wurde 1843 die württembergische Synagogenordnung in Haigerloch und Dettensee eingeführt.
Hilbs Nachfolger im Rabbinate waren Dr. Spitz und Dr. Wolf. Nach dessen Weggang
(1894) wurde das Haigerlocher Rabbinat nicht wieder besetzt.
Der erste Volksschullehrer der Gemeinde war Salomon Neuburger
(Hinweis des Webmasters: der erste Lehrer hieß Samuel Neuburger,
siehe Familienregister
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-445280-134). Er hatte auf Veranlassung der fürstlichen Regierung seine Prüfung 1822
|
 in
Rottweil abgelegt
- wahrscheinlich als der erste Jude von Württemberg und Hohenzollern - und
richtete im Januar 1823 mit Unterstützung der Regierung gegen den
Widerstand des Rabbiners Zivi in seiner Heimatgemeinde Haigerloch eine jüdische
'Elementarschule' ein, die bereits am Ende dieses Jahres staatlich anerkannt wurde. Nach ihm waren in der Schule tätig:
Leopold Rosenstraus Neidenstein
(Baden) 1856-1857, Maier Jacobi 1857-1858, Provisor Biesinger 1878-1879,
Levi Speyer aus Guxhagen 1879-1907,
Kahn aus Baisingen 1907-1908, Louis Wallach aus Schwarzenborn 1908-1923,
Gustav Spier aus Zwesten seit 1924. in
Rottweil abgelegt
- wahrscheinlich als der erste Jude von Württemberg und Hohenzollern - und
richtete im Januar 1823 mit Unterstützung der Regierung gegen den
Widerstand des Rabbiners Zivi in seiner Heimatgemeinde Haigerloch eine jüdische
'Elementarschule' ein, die bereits am Ende dieses Jahres staatlich anerkannt wurde. Nach ihm waren in der Schule tätig:
Leopold Rosenstraus Neidenstein
(Baden) 1856-1857, Maier Jacobi 1857-1858, Provisor Biesinger 1878-1879,
Levi Speyer aus Guxhagen 1879-1907,
Kahn aus Baisingen 1907-1908, Louis Wallach aus Schwarzenborn 1908-1923,
Gustav Spier aus Zwesten seit 1924.
Die Aufhebung der für die Juden geltenden Beschränkungen erfolgte durch die fürstliche Landesregierung erst am 16. Mai 1849.
Nur ausnahmsweise war im Jahre 1800 einem Juden die Erlaubnis erteilt worden, in der Gemeinde
Gruol Grundbesitz zu erwerben. Noch im Jahr 1833 wurde einem Juden der Kauf eines Hauses in Haigerloch nicht gestattet. 1835 wurde dem
Wolf Israel Levi aber bereits erlaubt, trotz der Einwendungen der
Landschaft Haigerloch Land zur eigenen Bewirtschaftung zu erwerben. Ebenso versuchte die Stadt
1836 vergeblich, den Grundstücksankauf des Schutzjuden Samuel Katz zu verhindern.
Bereits 1837 wurde den Juden des Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen das Bürgerrecht
verliehen. Die Juden wurden den übrigen Bürgern gleichgestellt und das Schutzgeld aufgehoben.
Von da an wurden die 'Judengemeinden' Haigerloch und Dettensee
Kirchengemeinden und politisch mit den Gemeinden vereinigt. Vom Erwerb des Bürgerrechts wurden alle über
15 Jahre alten Juden ausgeschlossen, die noch keinen ordentlichen Beruf ergriffen hatten. Die Ausübung des Schachergewerbes blieb nur denen
gestattet, die bereits ausübten und über 20 Jahre alt |
 alt
waren. Fremde Schacherjuden durften auf keinen Fall eingebürgert werden.
Das Gesetz strebte die Überführung der Juden zum Landbau und zum
Handwerk an. Tatsächlich musste von da an jeder Hinsicht einen derartigen
Beruf erlernen. alt
waren. Fremde Schacherjuden durften auf keinen Fall eingebürgert werden.
Das Gesetz strebte die Überführung der Juden zum Landbau und zum
Handwerk an. Tatsächlich musste von da an jeder Hinsicht einen derartigen
Beruf erlernen.
Die wohlgemeinten Bemühungen der Regierung waren aber in einer Zeit zur
Erfolglosigkeit verurteilt, in der sich die gesamte deutsche Bevölkerung
in immer steigendem Maße dem Handel und der Industrie zuwandte. Diese
Entwicklung war durch die Absichten der Regierungen nicht mehr
aufzuhalten.
Das Verhältnis der christlichen Mitbürger zu den Juden des Ortes hat
sich seit der bürgerlichen Gleichstellung immer freundlicher gestaltet.
Das vorbildliche Einvernehmen zwischen den drei Bekenntnissen ist auch
durch die politischen Strömungen der Gegenwart nicht gestört
worden.
Der Weltkrieg hat der Gemeinde hatte Opfer auferlegt. Sechs ihrer Söhne
sind im Kampfe für das Vaterland gefallen. Die Wirkungen der
Nachkriegszeit haben die wirtschaftliche Lage der einst wohlhabenden
Gemeinde vollständig zerrüttet. Die Gemeinde Haigerloch hatte noch 1902
das Vermögen der aufgelösten Gemeinde Dettensee geerbt. Der Inflation
ist alles zum Opfer gefallen. Die Gemeinde, die heute etwa 210 Seelen zählt,
ist völlig verarmt und kaum im Stande, ihren Etat aufzubringen. Möge ein
gütiges Geschick der Gemeinde, die noch heute ihr altes Getto bewohnt,
einen neuen Aufschwung bringen! Lehrer G. Spier - Haigerloch." |
Über die konfessionelle Eintracht in Haigerloch (1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1927:
"Haigerloch (Hohenzollern), 23. August. Ein schönes Beispiel
konfessioneller Eintracht bietet unser Städtchen. Neben 900 Katholiken
wohnen hier 210 Juden und etwa 150 Protestanten. Die konfessionelle
Eintracht, die hier seit langem eine Stätte fand, ist auch in den letzten
Jahren, als überall der Judenhass sich austobte, unerschüttert
geblieben. einige Ereignisse aus der letzten Zeit mögen davon Kunde
geben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1927:
"Haigerloch (Hohenzollern), 23. August. Ein schönes Beispiel
konfessioneller Eintracht bietet unser Städtchen. Neben 900 Katholiken
wohnen hier 210 Juden und etwa 150 Protestanten. Die konfessionelle
Eintracht, die hier seit langem eine Stätte fand, ist auch in den letzten
Jahren, als überall der Judenhass sich austobte, unerschüttert
geblieben. einige Ereignisse aus der letzten Zeit mögen davon Kunde
geben.
Als vor etwa einem Jahr das neue (katholisch) Krankenhaus eingeweiht
wurde, sprach im Rahmen des Festaktes neben den Vertretern der Behörden
und den Geistlichen der christlichen Konfession auch der
Rabbinatsvertreter.
In diesem Frühjahr wurde beschlossen, die Gefallenengedenkfeiern, die
bisher von den einzelnen Religionsgemeinden gesondert veranstaltet worden
waren, künftig für die ganze Stadtgemeinde gemeinsam abzuhalten. Ohne
Anregung von jüdischer Seite wurde folgendes festgelegt: die Gedenkrede
soll der Reihe nach von den Geistlichen der drei Gemeinden gehalten
werden. Also sprach in diesem Jahre der katholische Geistliche als
Vertreter der größten Religionsgemeinde am Ort. Im nächsten Jahre wird
dann der Rabbinatsverweser die Gedenkrede halten und erst im folgenden
Jahre der evangelische Pfarrer.
Einen neuen Beweis der Eintracht brachte die weltliche Feier, welche die
katholische Gemeinde anlässlich der Einführung ihres neuen Stadtpfarrers
veranstaltete. Auch die Vertreter der jüdischen Gemeinde waren
eingeladen, und Rabbinatsverweser Spier führte in seiner Ansprache etwa
folgendes aus: Mit der katholischen Gemeinde freue sich auch die jüdische
Gemeinde, und diese Mitfreude sei umso größer, als dem neuen Pfarrer der
Ruh vorausgehe, dass er wie kaum ein anderer geeignet sei, den hierorts
herrschenden Geist der Eintracht weiter zu pflegen. Dem neuen
Stadtpfarrer, der zum Dienste des einen Gottes, an den wir schließlich
alle glauben, als dessen Kinder wir uns alle fühlen, in unsere Stadt
einziehe, rufe die jüdische Gemeinde zum Gruß entgegen: Gesegnet sei,
der da kommt, im Namen des Herrn!
Der also Begrüßte erwiderte, dass er von je die größte Hochachtung vor
der jüdischen Religion und vor ihren Bekennern gehegt habe. Er habe oft
seinen bisherigen Pfarrkindern die Treue, mit der die Juden an ihren
Religionsgesetzen hingen, als Beispiel vor Augen gestellt. Er werde weiter
diese Hochachtung vor dem Judentum und den Juden sich bewahren und werde
mit ganzer Kraft sich um die Erhaltung des konfessionellen Friedens
mühen.
Bietet der ganze Vorgang ein schönes Bild des gegenseitigen
Verständnisses und der Eintracht, so zeigt er weiter noch, wie wir Juden
uns am ehesten die Achtung der Andersgläubigen erwerben können: nicht
durch bedingungslose Anpassung, sondern durch Treue zum Glauben unserer
Väter. Möchte doch diese Erkenntnis Allgemeingut unserer jüdischen
Brüder werden!" |
Sabbatstille in Haigerloch - Bericht eines
nichtjüdischen Autors in der "Neuen Zürcher Zeitung" 1930
 Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 17. Oktober
1930: "Sabbatstille in Haigerloch. Im Feuilleton der 'Neuen Zürcher
Zeitung' vom 12. Oktober dieses Jahres beschreibt Felix Burckhardt das
auf der Schwäbischen Alb malerisch gelegene, uralte hohenzollernsche Städtchen
Haigerloch. Nach einem Rückblick auf die wechselvolle Geschichte dieser
preußischen Exklave und einigen das Stadtbild charakterisierenden
Bemerkungen schildert der Verfasser 'ein Erlebnis ganz eigener Art',
von dem er sagt, dass es wohl noch lebendig sein werde, wenn die Umrisse
des malerischen Bergstädtchens schon in seiner Erinnerung verwischt
seien. Der Artikel schließt nämlich mit den Sätzen: 'Es war an einem
Samstag, am frühen Nachmittag, als ich die Gassen durchstreifte. Das
Leben einer ländlichen Kleinstadt pulste darin mit Hammerschlag und
Kaufladenklingelton, mit dem Knarren und Kreischen der gebremsten Wagenräder
in den steilen Gassen und dem Brüllen des Viehs in den Ställen, die
ausgemistet wurden, mit Kinderlärm und nachbarlichem Getratsch der
Frauen. Ein paar Schritte weiter tat sich, auf halber Höhe der Felswand
vorgelagert, ein weiter Platz auf, von einstöckigen Häuschen umgeben.
Was war denn da plötzlich anders geworden? Ach ja, das war's: eine
tiefe Stille, kein Mensch draußen vor den Häusern, nur hinter halb
vorgezogenen Gardinen ein paar ruhige, alte Gesichter. Ich las die
Namenschilder an den Haustüren, über den paar Kaufläden: Behr und
Hirsch, Levi und Löwenstein waren da zu Hause. Ich war ins Judenviertel
von Haigerloch geraten, und es war die feierliche Ruhe des Sabbats, die
mich umgab. Nicht in einem finstern Ghetto hinter Tor und Mauer, sondern
als Kind seiner toleranten Zeit hat Fürst Joseph vor 170 Jahren seine
Haigerlocher Juden in einem freundlichen grünen Winkel seines Städtchens
angesiedelt, und noch heute ist dieser Stadtteil, 'im Hag' genannt,
ausschließlich von ihnen bewohnt. Die Stille war fast beklemmend. Hier
erneuert sich jede Woche das, was wir nur noch als Titel von
Erbauungsschriften kennen: die Sabbatstille, geboten durch das Gesetz vom
Sinai. Wahrlich, im Judenviertel von Haigerloch gelten noch die Worte des
Dekalogs: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Da sollst du
kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch
deine Magd, noch dein Vieh. – Und ich, der Fremdling in den Toren
Israels, setzte meine Füße behutsam auf, um diesen wundersamen
Feiertagsfrieden nicht zu stören.' Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 17. Oktober
1930: "Sabbatstille in Haigerloch. Im Feuilleton der 'Neuen Zürcher
Zeitung' vom 12. Oktober dieses Jahres beschreibt Felix Burckhardt das
auf der Schwäbischen Alb malerisch gelegene, uralte hohenzollernsche Städtchen
Haigerloch. Nach einem Rückblick auf die wechselvolle Geschichte dieser
preußischen Exklave und einigen das Stadtbild charakterisierenden
Bemerkungen schildert der Verfasser 'ein Erlebnis ganz eigener Art',
von dem er sagt, dass es wohl noch lebendig sein werde, wenn die Umrisse
des malerischen Bergstädtchens schon in seiner Erinnerung verwischt
seien. Der Artikel schließt nämlich mit den Sätzen: 'Es war an einem
Samstag, am frühen Nachmittag, als ich die Gassen durchstreifte. Das
Leben einer ländlichen Kleinstadt pulste darin mit Hammerschlag und
Kaufladenklingelton, mit dem Knarren und Kreischen der gebremsten Wagenräder
in den steilen Gassen und dem Brüllen des Viehs in den Ställen, die
ausgemistet wurden, mit Kinderlärm und nachbarlichem Getratsch der
Frauen. Ein paar Schritte weiter tat sich, auf halber Höhe der Felswand
vorgelagert, ein weiter Platz auf, von einstöckigen Häuschen umgeben.
Was war denn da plötzlich anders geworden? Ach ja, das war's: eine
tiefe Stille, kein Mensch draußen vor den Häusern, nur hinter halb
vorgezogenen Gardinen ein paar ruhige, alte Gesichter. Ich las die
Namenschilder an den Haustüren, über den paar Kaufläden: Behr und
Hirsch, Levi und Löwenstein waren da zu Hause. Ich war ins Judenviertel
von Haigerloch geraten, und es war die feierliche Ruhe des Sabbats, die
mich umgab. Nicht in einem finstern Ghetto hinter Tor und Mauer, sondern
als Kind seiner toleranten Zeit hat Fürst Joseph vor 170 Jahren seine
Haigerlocher Juden in einem freundlichen grünen Winkel seines Städtchens
angesiedelt, und noch heute ist dieser Stadtteil, 'im Hag' genannt,
ausschließlich von ihnen bewohnt. Die Stille war fast beklemmend. Hier
erneuert sich jede Woche das, was wir nur noch als Titel von
Erbauungsschriften kennen: die Sabbatstille, geboten durch das Gesetz vom
Sinai. Wahrlich, im Judenviertel von Haigerloch gelten noch die Worte des
Dekalogs: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Da sollst du
kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch
deine Magd, noch dein Vieh. – Und ich, der Fremdling in den Toren
Israels, setzte meine Füße behutsam auf, um diesen wundersamen
Feiertagsfrieden nicht zu stören.' |
150 Jahre jüdischer Stadtteil Haag
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1930: "Haigerloch. Ein eigenartiges Jubiläum
kann die jüdische Gemeinde Haigerloch in diesem Jahre begehen. Es jährt sich heuer zum 150. Male,
dass den Haigerlocher Juden der Stadtteil 'Haag', der noch heute als geschlossene jüdische Siedlung existiert, zugewiesen wurde. Eine jüdische Gemeinde bestand in Haigerloch schon seit Jahrhunderten. Die älteste erhaltene Urkunde stammt aus dem Jahre 1546. Da den Juden der Erwerb von Häusern fast unmöglich gemacht wurde, wohnten sie meist in Bürgerhäusern zur Miete. Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1930: "Haigerloch. Ein eigenartiges Jubiläum
kann die jüdische Gemeinde Haigerloch in diesem Jahre begehen. Es jährt sich heuer zum 150. Male,
dass den Haigerlocher Juden der Stadtteil 'Haag', der noch heute als geschlossene jüdische Siedlung existiert, zugewiesen wurde. Eine jüdische Gemeinde bestand in Haigerloch schon seit Jahrhunderten. Die älteste erhaltene Urkunde stammt aus dem Jahre 1546. Da den Juden der Erwerb von Häusern fast unmöglich gemacht wurde, wohnten sie meist in Bürgerhäusern zur Miete.
Bei der Erteilung eines neuen Schutz ordnete Fürst Carl Friedrich von Sigmaringen an, dass die Juden, soweit sie nicht eigene Häuser in der Stadt
besäßen, in die herrschaftlichen Gebäude im 'Haag': das ehemalige
Schloss, den ehemaligen Reitstall, die Schlosskirche und das Wachthaus, überzusiedeln hatten. Nachdem mit den Geldern der Juden diese Baulichkeiten wieder instandgesetzt worden waren, zog die
Haigerlocher Judenschaft dort ein. 1783 durfte sie auf dem Platz im 'Haag'
ihre Synagoge errichten und im Laufe von etwa sechs Jahrzehnten entstand Haus das ganze Judenviertel in seiner heutigen Gestalt.
Der Schutzbrief von 1780, auf Pergament geschrieben, ist eines der wertvollsten und interessantesten Dokumente im Besitz der jüdischen Gemeinde Haigerloch."
|
Über den "Haag" in Haigerloch (Beitrag in der Neuen Zürcher
Zeitung" von 1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1930: "Haigerloch. Die 'Neue Zürcher Zeitung' vom 12. Oktober dieses Jahres bringt einen Artikel von
Felix Burckhardt, in dem unser Städtchen nach der historischen und architektonischen Seite geschildert wird. Der interessante Aufsatz beschäftigt sich auch mit dem heute noch bestehenden Judenviertel,
dem 'Haag': wir geben die diesbezüglichen Ausführungen Burckhardts nachstehend wieder:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1930: "Haigerloch. Die 'Neue Zürcher Zeitung' vom 12. Oktober dieses Jahres bringt einen Artikel von
Felix Burckhardt, in dem unser Städtchen nach der historischen und architektonischen Seite geschildert wird. Der interessante Aufsatz beschäftigt sich auch mit dem heute noch bestehenden Judenviertel,
dem 'Haag': wir geben die diesbezüglichen Ausführungen Burckhardts nachstehend wieder:
'Es war an einem Samstag am frühen Nachmittag, als ich die Gassen durchstreifte. Das Leben einer ländlichen Kleinstadt
pulste darin mit Hammerschlag und Kaufladenklingelton, mit dem Knarren und
Kreischen der gebremsten Wagenräder in den steilen Gassen und dem Brüllen des
Viehs in den Ställen, die ausgemistet wurden, mit Kinderlärm und
nachbarlichem Getratsch der Frauen. Ein paar Schritte weiter tat sich auf halber Höhe der Felswand vorgelagert, ein
weiter Platz auf, von einstöckigen Häuschen umgeben. Was war denn da plötzlich anders geworden? Ach ja, das war's: eine tiefe Stille, kein Mensch draußen vor den Häusern, nur
hinter halb vorgezogenen Gardinen ein paar ruhige, alte Gesichter. Ich las
die Namensschilder an den Haustüren, über den paar Kaufläden: Behr und
Hirsch, Levi und Löwenstein waren da zu Hause. Ich war ins Judenviertel von
Haigerloch geraten, und es war die feierliche Ruhe des Sabbats, die mich umgab. Nicht in einem finsteren
Ghetto hinter Tor und Mauer, sondern als Kind seiner toleranten Zeit hat
Fürst Joseph vor 170 Jahren seine Haigerlocher Juden in einem freundlichen grünen Winkel seines Städtchens angesiedelt, und noch heute ist dieser Stadtteil,
'im Haag' genannt, ausschließlich von Ihnen bewohnt. Die Stille war fast beklemmend. Hier
erneuert sich jede Woche das, was wir nur noch als Titel von Erbauungsschriften kennen: die Sabbatstille, geboten durch das Gesetz vom Sinai. Wahrlich, im Judenviertel von
Haigerloch gelten noch die Worte des Dekalogs: Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligest. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine
Magd, noch dein Vieh. - Und ich, der Fremdling in den Toren Israels, setzte meine Füße behutsam auf, um diesen
wundersamen Feiertagsfrieden nicht zu stören'".
|
Aus der Geschichte des Rabbinates
Zum Tod von Rabbiner Maier Hilb (1880)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Juni 1880: "Man
schreibt uns aus Haigerloch vom 16. dieses Monats. Heute verstarb hier
Herr Rabbiner Hilb, der 1806 hier geboren, seit 1836 bei der hiesigen
Gemeinde als Rabbiner fungierte. Der Dahingeschiedene nimmt die volle
Anerkennung Aller, die ihn kannten, mit ins Grab. Ohne Unterstützung des
Staates ist die hiesige Gemeinde nicht imstande, die Stelle wieder zu
besetzen. Seit dem 1. September 1879 erhielt der Verstorbene monatlich 25
Mark von der königlichen Landeskasse, eine Subvention, die er nicht lange
genoss und die zur Neubesetzung nicht hinreicht. Vielleicht vereinigen
sich Hechingen, Haigerloch und Dettensee zu einem gemeinsamen Rabbinate." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Juni 1880: "Man
schreibt uns aus Haigerloch vom 16. dieses Monats. Heute verstarb hier
Herr Rabbiner Hilb, der 1806 hier geboren, seit 1836 bei der hiesigen
Gemeinde als Rabbiner fungierte. Der Dahingeschiedene nimmt die volle
Anerkennung Aller, die ihn kannten, mit ins Grab. Ohne Unterstützung des
Staates ist die hiesige Gemeinde nicht imstande, die Stelle wieder zu
besetzen. Seit dem 1. September 1879 erhielt der Verstorbene monatlich 25
Mark von der königlichen Landeskasse, eine Subvention, die er nicht lange
genoss und die zur Neubesetzung nicht hinreicht. Vielleicht vereinigen
sich Hechingen, Haigerloch und Dettensee zu einem gemeinsamen Rabbinate." |
Zum 50. Todestag von Rabbiner Maier Hilb
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Oktober 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Oktober 1930: |
Ausschreibung des Rabbinates (1883)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. September 1883: "Die hiesige israelitische Gemeinde beabsichtigt die
Rabbinatsstelle,
vorläufig provisorisch, zu besetzen mit einem Jahresgehalt von 1.500 Mark
und freier Wohnung, nebst 100 Mark aus verschiedenen Stiftungen. Bewerber
um diese Stelle werden ersucht, ihre Anmeldung mit Beifügung ihrer
Zeugnisse beim hiesigen Vorsteheramt einzureichen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. September 1883: "Die hiesige israelitische Gemeinde beabsichtigt die
Rabbinatsstelle,
vorläufig provisorisch, zu besetzen mit einem Jahresgehalt von 1.500 Mark
und freier Wohnung, nebst 100 Mark aus verschiedenen Stiftungen. Bewerber
um diese Stelle werden ersucht, ihre Anmeldung mit Beifügung ihrer
Zeugnisse beim hiesigen Vorsteheramt einzureichen.
Haigerloch,
Hohenzollern, den 2. September 1883. Israelitisches Vorsteheramt. David
Levi." |
Rabbiner
Dr. Spitz wechselt nach Gailingen (1888)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Juni 1888: "Bonn, 17. Juni (1888). Man
schreibt uns aus Haigerloch (Hohenzollern): Unser Rabbiner Dr.
Spitz hat einen Ruf nach Gailingen
angenommen. Es ist fraglich, da die Mittel der Gemeinde nicht ausreichen,
ob wieder ein Rabbiner angestellt wird; aus demselben Grunde hat auch Hechingen
keinen Rabbiner mehr." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Juni 1888: "Bonn, 17. Juni (1888). Man
schreibt uns aus Haigerloch (Hohenzollern): Unser Rabbiner Dr.
Spitz hat einen Ruf nach Gailingen
angenommen. Es ist fraglich, da die Mittel der Gemeinde nicht ausreichen,
ob wieder ein Rabbiner angestellt wird; aus demselben Grunde hat auch Hechingen
keinen Rabbiner mehr." |
Ausschreibung des Rabbinates (1888)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Dezember 1888: "Bekanntmachung. Durch die Berufung unseres Rabbiner Herrn Dr. Spitz zum
Bezirksrabbiner nach Gailingen wird die hiesige
Rabbinerstelle vakant, und
soll baldigst wieder besetzt werden. Akademisch gebildete Bewerber, die
mir der nötigen Hatarat Horaah
versehen und der religiösen Richtung angehören, wollen ihre Zeugnisse
bis zum 15. Januar 1889 der unterzeichneten Stelle gefälligst einsenden.
Gehalt 1.600 Mark, freie Wohnung und Nebeneinkünfte 300 Mark. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Dezember 1888: "Bekanntmachung. Durch die Berufung unseres Rabbiner Herrn Dr. Spitz zum
Bezirksrabbiner nach Gailingen wird die hiesige
Rabbinerstelle vakant, und
soll baldigst wieder besetzt werden. Akademisch gebildete Bewerber, die
mir der nötigen Hatarat Horaah
versehen und der religiösen Richtung angehören, wollen ihre Zeugnisse
bis zum 15. Januar 1889 der unterzeichneten Stelle gefälligst einsenden.
Gehalt 1.600 Mark, freie Wohnung und Nebeneinkünfte 300 Mark.
Haigerloch
(Hohenzollern), 31. Dezember 1888. Das israelitische Vorsteheramt." |
Begrüßung von Rabbiner Dr. Aron Wolff durch den Gemeindevorsteher (1889)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1889: "Haigerloch.
Vorigen Freitag, den 5. dieses Monats, hielt der von der hiesigen Gemeinde
einstimmig erwählte Rabbiner seinen Einzug in hiesiger Stadt. Herr Dr. A.
Wolff, seither in Kurnik in der Provinz Posen, hat am 1. April seine alte
Heimat verlassen und an dem oben bezeichneten Tage sein Amt dahier
angetreten. Da der Vorstand von der Ankunft des genannten Herrn
unterrichtet war, so ist derselbe dem Ankommenden bis zur nächsten
Station entgegen gefahren und fand auch alldort eine herzliche Begrüßung
statt, die sich alsdann in dem engeren Heim des Einziehenden zu einer
sympathischen Kundgebung gestaltete, und den neuen geistlichen Lehrer der
Gemeinde erkennen ließ, dass man dessen Amtsantritt mit Freuden allseitig
entgegen nimmt und dass auch mit Hinblick auf diesen wahrhaft freundlichen
Empfang das Verhältnis zwischen Rabbiner und Gemeinde ein gutes werden
und bleiben wird. In diesem Sinne sprach sich auch Herr Dr. A. Wolff in
seiner glanzvollen Rede aus, die er am vorigen Sabbat vor der zahlreich
versammelten Gemeinde hielt. Waren es doch Worte der Innigkeit, reich an
Gedankenfülle und geschmückt durch die Wahl des klassischen Ausdruckes,
die der Redner seinem Texte (hebräisch und deutsch:) 'Sei von den Schülern
Aron's, friedliebend, Frieden
stiftend, Menschen liebend und sie zur Tora leitend', anfügte und die
so recht erkennen ließen, dass die Gemeinde in ihrem neu ernannten
Rabbiner nicht allein einen reich begabten und gebildeten Mann erkoren,
sondern auch einen Freund des wahren Friedens in ihrer Mitte haben wird. Möge
es ihm auch vergönnt sein, den Baum der Erkenntnis des sittlichen und
religiösen Lebens nach seiner neuen Heimat zu verpflanzen und mögen die
Früchte desselben dort auch jene Labung gewähren, die dem Judentum zur
Erfrischung und der gesamten Menschheit zur Kräftigung wird und daraus
jener Segen sich entfalte, der zum Bande der Eintracht werde zwischen den
Bekennern aller dort lebenden Konfessionen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1889: "Haigerloch.
Vorigen Freitag, den 5. dieses Monats, hielt der von der hiesigen Gemeinde
einstimmig erwählte Rabbiner seinen Einzug in hiesiger Stadt. Herr Dr. A.
Wolff, seither in Kurnik in der Provinz Posen, hat am 1. April seine alte
Heimat verlassen und an dem oben bezeichneten Tage sein Amt dahier
angetreten. Da der Vorstand von der Ankunft des genannten Herrn
unterrichtet war, so ist derselbe dem Ankommenden bis zur nächsten
Station entgegen gefahren und fand auch alldort eine herzliche Begrüßung
statt, die sich alsdann in dem engeren Heim des Einziehenden zu einer
sympathischen Kundgebung gestaltete, und den neuen geistlichen Lehrer der
Gemeinde erkennen ließ, dass man dessen Amtsantritt mit Freuden allseitig
entgegen nimmt und dass auch mit Hinblick auf diesen wahrhaft freundlichen
Empfang das Verhältnis zwischen Rabbiner und Gemeinde ein gutes werden
und bleiben wird. In diesem Sinne sprach sich auch Herr Dr. A. Wolff in
seiner glanzvollen Rede aus, die er am vorigen Sabbat vor der zahlreich
versammelten Gemeinde hielt. Waren es doch Worte der Innigkeit, reich an
Gedankenfülle und geschmückt durch die Wahl des klassischen Ausdruckes,
die der Redner seinem Texte (hebräisch und deutsch:) 'Sei von den Schülern
Aron's, friedliebend, Frieden
stiftend, Menschen liebend und sie zur Tora leitend', anfügte und die
so recht erkennen ließen, dass die Gemeinde in ihrem neu ernannten
Rabbiner nicht allein einen reich begabten und gebildeten Mann erkoren,
sondern auch einen Freund des wahren Friedens in ihrer Mitte haben wird. Möge
es ihm auch vergönnt sein, den Baum der Erkenntnis des sittlichen und
religiösen Lebens nach seiner neuen Heimat zu verpflanzen und mögen die
Früchte desselben dort auch jene Labung gewähren, die dem Judentum zur
Erfrischung und der gesamten Menschheit zur Kräftigung wird und daraus
jener Segen sich entfalte, der zum Bande der Eintracht werde zwischen den
Bekennern aller dort lebenden Konfessionen." |
Zum Tod
von Rabbiner Dr. Aron Isak Wolff in Fürth (1900)
Rabbiner Dr. Aron Isak Wolf (geb. 1842 in Hohensalza/Inowrocław, Posen,
gest. 1900 in Fürth), studierte in Rawitsch/Rawicz (Ausbildung zum Rabbiner)
und in Berlin; Promotion in Leipzig; er war als Lehrer in Żnin und Hamburg
(Talmud-Tora-Realschule) tätig, um 1883/89 als Rabbiner in Kórnik, Posen; von
1889 bis 1894 Rabbiner in Haigerloch; danach zog er sich nach Fürth
zurück.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. August
1900: "Fürth, 31. Juli (1900). Am 25. Juni verschied
dahier nach längerer Krankheit im 59. Lebensjahre Herr Dr. Aron Isak
Wolff, welcher in verschiedenen Gemeinden lange Zeit hindurch das Amt
eines Religionslehrers und Rabbiners segensreich verwaltet hat. Die
Lauterkeit seiner Gesinnung, sein gottesfürchtiger Lebenswandel, der
reiche Schatz seines Wissens, sowie seine Begeisterung für die
Gotteslehre, deren Studium er sich während der ganzen Zeit seines Lebens aufs
eifrigste angelegen sein ließ, und dessen Früchte er in mehreren
schriftstellerischen Arbeiten, als da sind 'Das jüdische Erbrecht',
'Übersetzung von Maimonides' Mischnah Thora', der jüdischen
Gelehrtenwelt offenbarte, erwarben dem Heimgegangenen die ungeteilte Liebe
und Verehrung vieler Gutgesinnten auch über den Kreis seiner Wirksamkeit
hinaus. Körperliche Leiden, sowie mancherlei herbe Enttäuschungen und
bittere Erfahrungen, die seinem milden Sinne besonders nahe gingen,
bestimmen den nunmehr Entschlafenen, seine öffentliche Wirksamkeit
aufzugeben und im Stillen Gott und seiner Lehre zu leben. Er zog sich zu
diesem Behufe nach Fürth zurück, wo ihn freundliches Wohlwollen und
liebende Anerkennung gern aufnahmen. Dort verlebte er mehrere Jahre, ganz
in den Dienst heiliger Lebenserfüllung aufgehend, lernend und lehrend,
bis der Tod ihn zu früh für die Seinigen, sowie für seine zahlreichen
Verehrer ereilte. Möge er Ruhe finden, die ihm im leben vielfach versagt
geblieben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. August
1900: "Fürth, 31. Juli (1900). Am 25. Juni verschied
dahier nach längerer Krankheit im 59. Lebensjahre Herr Dr. Aron Isak
Wolff, welcher in verschiedenen Gemeinden lange Zeit hindurch das Amt
eines Religionslehrers und Rabbiners segensreich verwaltet hat. Die
Lauterkeit seiner Gesinnung, sein gottesfürchtiger Lebenswandel, der
reiche Schatz seines Wissens, sowie seine Begeisterung für die
Gotteslehre, deren Studium er sich während der ganzen Zeit seines Lebens aufs
eifrigste angelegen sein ließ, und dessen Früchte er in mehreren
schriftstellerischen Arbeiten, als da sind 'Das jüdische Erbrecht',
'Übersetzung von Maimonides' Mischnah Thora', der jüdischen
Gelehrtenwelt offenbarte, erwarben dem Heimgegangenen die ungeteilte Liebe
und Verehrung vieler Gutgesinnten auch über den Kreis seiner Wirksamkeit
hinaus. Körperliche Leiden, sowie mancherlei herbe Enttäuschungen und
bittere Erfahrungen, die seinem milden Sinne besonders nahe gingen,
bestimmen den nunmehr Entschlafenen, seine öffentliche Wirksamkeit
aufzugeben und im Stillen Gott und seiner Lehre zu leben. Er zog sich zu
diesem Behufe nach Fürth zurück, wo ihn freundliches Wohlwollen und
liebende Anerkennung gern aufnahmen. Dort verlebte er mehrere Jahre, ganz
in den Dienst heiliger Lebenserfüllung aufgehend, lernend und lehrend,
bis der Tod ihn zu früh für die Seinigen, sowie für seine zahlreichen
Verehrer ereilte. Möge er Ruhe finden, die ihm im leben vielfach versagt
geblieben." |
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der
Schule(n)
Von einem Beth-Hamidrasch (jüdisches Lehrhaus), das um 1860/70 nicht gegründet wurde
(Artikel von 1926)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November 1926: "Von einem
Beth-Hamidrasch, das nicht gegründet wurde - von Gustav Spier in
Haigerloch. Das Hinscheiden Rabbiner Salomon Breuers – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – hat die Gedanken vieler auf seine große
Gründung, die Jeschiwot und überhaupt auf die Jeschiwot-Gründungen der
neuesten Zeit gelenkt. So darf man vielleicht Interesse voraussetzen für
den Plan zu einer ähnlichen Anstalt, einen Plan, der leider kurz vor der
Vollendung scheiterte. Es handelt sich um das Projekt für ein Beit
Hamidrasch in Haigerloch. Haigerloch ist ein kleines Städtchen im
wesentlichen Teil des Ländchens Hohenzollern und hat eine ziemlich alte
und ansehnliche Gemeinde, die noch heute im ehemaligen Ghetto geschlossen
beisammen wohnt. Bis vor ca. 30 Jahren hatte die Gemeinde auch Rabbinat.
Hier in Haigerloch lebte zwischen 1812 und 1873 Jakob Regensburger. Die
Erinnerung an seinen Reichtum ist heute noch in der Gemeinde erhalten
geblieben, und die ältesten Männer der Gemeinde wissen auch noch von
seinem Plan, ein jüdisches Lehrhaus zu gründen. Genaueren Aufschluss darüber
gaben mir aber erst die Akten des ehemaligen Oberamts Haigerloch. Sie
berichte folgendes: 'Am 1. Juni 1866 richtete der erwähnte Jakob
Regensburger ein Gesuch folgenden Inhalts an das Oberamt: Das Bewusstsein,
dass die Religion eines der heiligsten Güter der Menschheit sei, dass sie
aber durch die zur Zeit herrschende materielle Geistesrichtung bedroht
werde, habe in dem Antragsteller den Plan reifen lassen, in Haigerloch ein
Beth-Hamidrasch, d.h. ein Lehrhaus zu gründen. Die jüdische Volksschule
unterrichte zwar im Lesen der heiligen Schrift und in der systematischen
Religionslehre, sie lehre auch einige Gebete und einige Kapitel des
Pentateuchs zu übersetzen. Aber 'der so reiche Schatz von herrlichen
Lehren und Vorschriften, wie sie die mündliche Überlieferung und die
Kommentare enthalten, unzählige Sittensprüche, Lebensregeln, heilige
Legenden, die Lehren eines Maimonides, eines Aben-Esra, einer Kimchi,
eines Albo; die schönen Dichtungen der jüdisch-spanischen Schule; die
Forschungen der neueren jüdischen Gelehrten, wie eines Luzzatto, Wessely,
Rappaport, Zunz, Sachs – alles das bleibt den Kindern, ja fast einer
ganzen Generation verschlossen. Ich möchte deshalb Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November 1926: "Von einem
Beth-Hamidrasch, das nicht gegründet wurde - von Gustav Spier in
Haigerloch. Das Hinscheiden Rabbiner Salomon Breuers – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – hat die Gedanken vieler auf seine große
Gründung, die Jeschiwot und überhaupt auf die Jeschiwot-Gründungen der
neuesten Zeit gelenkt. So darf man vielleicht Interesse voraussetzen für
den Plan zu einer ähnlichen Anstalt, einen Plan, der leider kurz vor der
Vollendung scheiterte. Es handelt sich um das Projekt für ein Beit
Hamidrasch in Haigerloch. Haigerloch ist ein kleines Städtchen im
wesentlichen Teil des Ländchens Hohenzollern und hat eine ziemlich alte
und ansehnliche Gemeinde, die noch heute im ehemaligen Ghetto geschlossen
beisammen wohnt. Bis vor ca. 30 Jahren hatte die Gemeinde auch Rabbinat.
Hier in Haigerloch lebte zwischen 1812 und 1873 Jakob Regensburger. Die
Erinnerung an seinen Reichtum ist heute noch in der Gemeinde erhalten
geblieben, und die ältesten Männer der Gemeinde wissen auch noch von
seinem Plan, ein jüdisches Lehrhaus zu gründen. Genaueren Aufschluss darüber
gaben mir aber erst die Akten des ehemaligen Oberamts Haigerloch. Sie
berichte folgendes: 'Am 1. Juni 1866 richtete der erwähnte Jakob
Regensburger ein Gesuch folgenden Inhalts an das Oberamt: Das Bewusstsein,
dass die Religion eines der heiligsten Güter der Menschheit sei, dass sie
aber durch die zur Zeit herrschende materielle Geistesrichtung bedroht
werde, habe in dem Antragsteller den Plan reifen lassen, in Haigerloch ein
Beth-Hamidrasch, d.h. ein Lehrhaus zu gründen. Die jüdische Volksschule
unterrichte zwar im Lesen der heiligen Schrift und in der systematischen
Religionslehre, sie lehre auch einige Gebete und einige Kapitel des
Pentateuchs zu übersetzen. Aber 'der so reiche Schatz von herrlichen
Lehren und Vorschriften, wie sie die mündliche Überlieferung und die
Kommentare enthalten, unzählige Sittensprüche, Lebensregeln, heilige
Legenden, die Lehren eines Maimonides, eines Aben-Esra, einer Kimchi,
eines Albo; die schönen Dichtungen der jüdisch-spanischen Schule; die
Forschungen der neueren jüdischen Gelehrten, wie eines Luzzatto, Wessely,
Rappaport, Zunz, Sachs – alles das bleibt den Kindern, ja fast einer
ganzen Generation verschlossen. Ich möchte deshalb |
 ein
Lehrhaus gründen, an dem ein jüdischer Theologe als Lehrer angestellt
werde, der eine Universität besucht und sein Staatsexamen mit Erfolg
bestanden, der ein grammatikalisch gebildeter Hebraiker und ein gewiegter
Talmudist ist. In diesem Institute soll jüdischen Jünglingen Gelegenheit
geboten werden, sich in der jüdischen Theologie so viele Kenntnisse zu
erwerben, als für sie zu ihrem künftigen theologischen Berufe notwendig
ist; sie können jedoch auch nur nach jeweiligem Bedürfnis, oder nach
Neigung dem Studium der Thora mit ihren trefflichen Kommentaren sich
hingeben, und sind hierzu auswärtige, wie hiesige Jünglinge
gleichberechtigt.' Das Lehrhaus sollte demnach die Vorbildung für das
Rabbiner-Amt vermitteln, gleichzeitig aber auch jungen Juden Gelegenheit
geben, sich neben ihrer kaufmännischen oder andern Berufserfahrung einen
gründlichen Fonds jüdischen Wissens zu erwerben. Der Unterricht solle
unentgeltlich sein, ärmeren Schülern solle, soweit der Platz reiche, im
Anstaltsgebäude freie Wohnung gegeben werden. In der Gemeinde bestehe
reges Interesse für den Plan. Es seien schön größere Beiträge
gezeichnet worden; der religiöse Sinn der Gemeinde bürge ferner dafür,
dass arme Jünglinge unentgeltlich Logis und Kost erhalten. Ein geeignetes
Gebäude und eine Bibliothek von 400 Bänden habe er, Jakob Regensburger,
bereits beschafft. Es fehle nur noch das Kapital, von dessen Zinsen die
Anstalt unterhalten werden könne. Darum bitte er das Oberamt um
Erlaubnis, diesen Fonds durch eine Kollekte aufbringen zu dürfen. Das
Oberamt reichte das Gesuch mit einer Befürwortung weiter. Einige Worte
des Begleitschreibens mögen hier angeführt werden: 'Es ist nicht zu
verkennen, dass, wenn der gegenwärtig fast nur noch in Beachtung der äußeren
Förmlichkeiten bestehende Judaismus nicht mehr mit innerer Tiefe
gehandelt und geübt wird, derselbe… in sich selbst zusammenfallen muss,
und das beste Mittel, um diesen Zerfall zu verhindern, dürfte allerdings
da vom Bittsteller angeregte sein.' Soweit der Oberamtmann in seinem
Begleitschreiben. Die Regierung in Sigmaringen erwidert am 1. September
1866, dass sie bei der mangelnden Genauigkeit des Plans noch nicht in der
Lage sei, ihre Zustimmung zu einer Kollekte zu geben. Auf wiederholte
Eingaben erhält Jakob Regensburger dann im Januar 1870 von den
Ministerien des Unterrichts und des Innern die Erlaubnis zu der geplanten
Sammlung, mit der Bedingung jedoch, dass er baldigst einen Gründungs- und
Lehrplan einreiche. Der Deutsch-Französische Krieg bewirkte einen neuen
Aufschub und erst am 24. November 1872 reichte Jakob Regensburger das
Statut der zu gründenden Anstalt ein.
Danach soll die Anstalt den Namen 'Haus Jakobs' tragen. Sie
soll in drei Klassen Jünglinge von 13 bis 19 Jahren unterrichten und zwar
in systematischem Religionsunterricht, hebräischem grammatikalischem
Sprachunterricht, Übersetzung des Pentateuchs und der Propheten mit
Kommentaren, Mischna, Gemara mit Schulchan Aruch und Jore Dea, Geschichte
der Judentums, Altertumskunde, jüdische Literaturgeschichte, Homiletik,
Vortrags- und Lehrübungen. Die Zahl der Schüler soll vorerst auf 20
begrenzt sein und zwar für so lange, als nur ein Lehrer vorhanden ist.
Dieser, der Stiftsrabbiner soll vorerst ein festes Gehalt von 500 Gulden
aus den Zinsen des von Jakob Regensburger gesammelten Stiftungskapitals
erhalten, ferner freie Wohnung und Heizung und von jedem wohlhabenden Schüler
25 Gulden jährliches Schulgeld und endlich 50 Gulden Mietsertrag vom
oberen Stockwerk des Anstaltsgebäudes. Das Haus und die Bibliothek
stellte Jakob Regensburger. Er und sein Bruder verpflichteten sich, jährlich
2 Klafter Holz zur Beheizung zu spenden. Wenn durch weitere Stiftungen das
Kapital von derzeit 10.225 Gulden auf 20.000 Gulden steige, so solle ein
zweiter Lehrer angestellt, bei weiterem Anwachsen der Mittel die Anstalt
auch baulich erweitert werden. Die Regierung genehmigte daraufhin die
Errichtung der Anstalt mit dem Vorbehalt, dass eine Lehrperson angestellt
werde, die der Regierung geeignet erscheine. Jakob Regensburger wählte
nun den Rabbinatskandidaten Jakob Stern aus Niederstetten (Württemberg)
zum Lehrer der Anstalt. Die Regierung erteilte darauf am 12. April 1873
die endgültige Erlaubnis zur Errichtung des Beit HaMidrasch. Damit schließen
die Akten. Von einer tatsächlichen Errichtung des Lehrhauses, von einem
Beginn des Unterrichts berichten sie nichts mehr. Wie kommt das? Ein
Grabstein auf unserem Friedhof deutete es an, die alten Männer der
Gemeinde berichten es ausführlicher: Alles war zur Aufnahme des
Lehrbetriebs im neuen Lehrhause vorbereitet. Mitte Mai 1873 sollte die
Anstalt eröffnet werden. Da brach Jakob Regensburger am Jahrzeitstage
seines Vaters, am 30. April 1873, auf dem Friedhof zusammen. Ein Schlag
hatte seinem Leben ein Ende bereitet. Mit ihm sank sein Plan ins Grab. Die
projektierte Anstalt ist nie eröffnet worden. Vielleicht war es ein Glück
fürs Judentum. Wohl verlangte das Statut des Lehrhauses, dass der
Rabbiner ein Mann von streng religiöser Lebensführung sei, und Jakob
Regensburger glaubte, in ein
Lehrhaus gründen, an dem ein jüdischer Theologe als Lehrer angestellt
werde, der eine Universität besucht und sein Staatsexamen mit Erfolg
bestanden, der ein grammatikalisch gebildeter Hebraiker und ein gewiegter
Talmudist ist. In diesem Institute soll jüdischen Jünglingen Gelegenheit
geboten werden, sich in der jüdischen Theologie so viele Kenntnisse zu
erwerben, als für sie zu ihrem künftigen theologischen Berufe notwendig
ist; sie können jedoch auch nur nach jeweiligem Bedürfnis, oder nach
Neigung dem Studium der Thora mit ihren trefflichen Kommentaren sich
hingeben, und sind hierzu auswärtige, wie hiesige Jünglinge
gleichberechtigt.' Das Lehrhaus sollte demnach die Vorbildung für das
Rabbiner-Amt vermitteln, gleichzeitig aber auch jungen Juden Gelegenheit
geben, sich neben ihrer kaufmännischen oder andern Berufserfahrung einen
gründlichen Fonds jüdischen Wissens zu erwerben. Der Unterricht solle
unentgeltlich sein, ärmeren Schülern solle, soweit der Platz reiche, im
Anstaltsgebäude freie Wohnung gegeben werden. In der Gemeinde bestehe
reges Interesse für den Plan. Es seien schön größere Beiträge
gezeichnet worden; der religiöse Sinn der Gemeinde bürge ferner dafür,
dass arme Jünglinge unentgeltlich Logis und Kost erhalten. Ein geeignetes
Gebäude und eine Bibliothek von 400 Bänden habe er, Jakob Regensburger,
bereits beschafft. Es fehle nur noch das Kapital, von dessen Zinsen die
Anstalt unterhalten werden könne. Darum bitte er das Oberamt um
Erlaubnis, diesen Fonds durch eine Kollekte aufbringen zu dürfen. Das
Oberamt reichte das Gesuch mit einer Befürwortung weiter. Einige Worte
des Begleitschreibens mögen hier angeführt werden: 'Es ist nicht zu
verkennen, dass, wenn der gegenwärtig fast nur noch in Beachtung der äußeren
Förmlichkeiten bestehende Judaismus nicht mehr mit innerer Tiefe
gehandelt und geübt wird, derselbe… in sich selbst zusammenfallen muss,
und das beste Mittel, um diesen Zerfall zu verhindern, dürfte allerdings
da vom Bittsteller angeregte sein.' Soweit der Oberamtmann in seinem
Begleitschreiben. Die Regierung in Sigmaringen erwidert am 1. September
1866, dass sie bei der mangelnden Genauigkeit des Plans noch nicht in der
Lage sei, ihre Zustimmung zu einer Kollekte zu geben. Auf wiederholte
Eingaben erhält Jakob Regensburger dann im Januar 1870 von den
Ministerien des Unterrichts und des Innern die Erlaubnis zu der geplanten
Sammlung, mit der Bedingung jedoch, dass er baldigst einen Gründungs- und
Lehrplan einreiche. Der Deutsch-Französische Krieg bewirkte einen neuen
Aufschub und erst am 24. November 1872 reichte Jakob Regensburger das
Statut der zu gründenden Anstalt ein.
Danach soll die Anstalt den Namen 'Haus Jakobs' tragen. Sie
soll in drei Klassen Jünglinge von 13 bis 19 Jahren unterrichten und zwar
in systematischem Religionsunterricht, hebräischem grammatikalischem
Sprachunterricht, Übersetzung des Pentateuchs und der Propheten mit
Kommentaren, Mischna, Gemara mit Schulchan Aruch und Jore Dea, Geschichte
der Judentums, Altertumskunde, jüdische Literaturgeschichte, Homiletik,
Vortrags- und Lehrübungen. Die Zahl der Schüler soll vorerst auf 20
begrenzt sein und zwar für so lange, als nur ein Lehrer vorhanden ist.
Dieser, der Stiftsrabbiner soll vorerst ein festes Gehalt von 500 Gulden
aus den Zinsen des von Jakob Regensburger gesammelten Stiftungskapitals
erhalten, ferner freie Wohnung und Heizung und von jedem wohlhabenden Schüler
25 Gulden jährliches Schulgeld und endlich 50 Gulden Mietsertrag vom
oberen Stockwerk des Anstaltsgebäudes. Das Haus und die Bibliothek
stellte Jakob Regensburger. Er und sein Bruder verpflichteten sich, jährlich
2 Klafter Holz zur Beheizung zu spenden. Wenn durch weitere Stiftungen das
Kapital von derzeit 10.225 Gulden auf 20.000 Gulden steige, so solle ein
zweiter Lehrer angestellt, bei weiterem Anwachsen der Mittel die Anstalt
auch baulich erweitert werden. Die Regierung genehmigte daraufhin die
Errichtung der Anstalt mit dem Vorbehalt, dass eine Lehrperson angestellt
werde, die der Regierung geeignet erscheine. Jakob Regensburger wählte
nun den Rabbinatskandidaten Jakob Stern aus Niederstetten (Württemberg)
zum Lehrer der Anstalt. Die Regierung erteilte darauf am 12. April 1873
die endgültige Erlaubnis zur Errichtung des Beit HaMidrasch. Damit schließen
die Akten. Von einer tatsächlichen Errichtung des Lehrhauses, von einem
Beginn des Unterrichts berichten sie nichts mehr. Wie kommt das? Ein
Grabstein auf unserem Friedhof deutete es an, die alten Männer der
Gemeinde berichten es ausführlicher: Alles war zur Aufnahme des
Lehrbetriebs im neuen Lehrhause vorbereitet. Mitte Mai 1873 sollte die
Anstalt eröffnet werden. Da brach Jakob Regensburger am Jahrzeitstage
seines Vaters, am 30. April 1873, auf dem Friedhof zusammen. Ein Schlag
hatte seinem Leben ein Ende bereitet. Mit ihm sank sein Plan ins Grab. Die
projektierte Anstalt ist nie eröffnet worden. Vielleicht war es ein Glück
fürs Judentum. Wohl verlangte das Statut des Lehrhauses, dass der
Rabbiner ein Mann von streng religiöser Lebensführung sei, und Jakob
Regensburger glaubte, in |
 Jakob
Stern einen solchen Mann gefunden zu haben. Dieser Rabbiner Stern hat sich
aber im laufe der Zeit dahin entwickelt, dass er in dem wahrlich doch
liberalen Württemberg seines Rabbinats enthoben werden musste. Er ist
einer der beiden liberalen Rabbiner, die Chiefrabbi Hertz jüngst erwähnte
als diejenigen, auf deren Äußerungen hin die Schweiz das Schächten
durch Volksbeschluss verboten hätte. Wer weiß, welche Verwüstungen er
als Leiter eines Beit HaMidrasch in jüdischen Jünglingsherzen hätte
anrichten können. – So bedauerlich es also auch ist, dass der schöne,
fromme Plan des Jakob Regensburger sang- und klanglos scheiterte, so sehr
ist man doch auch hier berechtigt, zu sagen (hebräisch und deutsch): Auch
das war zum Guten." Jakob
Stern einen solchen Mann gefunden zu haben. Dieser Rabbiner Stern hat sich
aber im laufe der Zeit dahin entwickelt, dass er in dem wahrlich doch
liberalen Württemberg seines Rabbinats enthoben werden musste. Er ist
einer der beiden liberalen Rabbiner, die Chiefrabbi Hertz jüngst erwähnte
als diejenigen, auf deren Äußerungen hin die Schweiz das Schächten
durch Volksbeschluss verboten hätte. Wer weiß, welche Verwüstungen er
als Leiter eines Beit HaMidrasch in jüdischen Jünglingsherzen hätte
anrichten können. – So bedauerlich es also auch ist, dass der schöne,
fromme Plan des Jakob Regensburger sang- und klanglos scheiterte, so sehr
ist man doch auch hier berechtigt, zu sagen (hebräisch und deutsch): Auch
das war zum Guten." |
| |
| Der Beitrag von Gustav Spier
erschien noch einmal in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen
Gemeinden Württemberg" 1929: |
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September
1929:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September
1929: |
 |
 |
Vor dem Tod Jakob Regensburgers: die Ausschreibung der Lehrerstelle für das
Beth HaMidrasch (1873)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1873: "Es wurde mit
Genehmigung der hohen Königlichen Regierung hier ein Lehrhaus 'Beth
Hamidrasch' gegründet, an dem ein akademisch gebildeter Theologie als
Lehrer angestellt werden soll. Die Anfangsbesoldung besteht in: 500 Gulden
fix, freier Wohnung, 7 Raummeter Holz, Benutzung des Gartens, und
eventueller Bezug einer Hausmiete, die aus einer überflüssigen Wohnung
der Anstalt bezogen werden kann und die aus 50 Gulden geschützt ist,
endlich 25 Gulden Schulgeld von jedem vermöglichen Schüler. Die Bewerber
um diese Stelle haben ihre desfallsigen Gesuche im Laufe des Monats Januar
1873 nebst ihren Zeugnissen über Befähigung und früherer Laufbahn bei
unterzeichneter Stelle einzusenden. Haigerloch, 1. Januar 1873. Das
Kuratorium der Anstalt. Der Vorstand. Jakob Regensburger." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1873: "Es wurde mit
Genehmigung der hohen Königlichen Regierung hier ein Lehrhaus 'Beth
Hamidrasch' gegründet, an dem ein akademisch gebildeter Theologie als
Lehrer angestellt werden soll. Die Anfangsbesoldung besteht in: 500 Gulden
fix, freier Wohnung, 7 Raummeter Holz, Benutzung des Gartens, und
eventueller Bezug einer Hausmiete, die aus einer überflüssigen Wohnung
der Anstalt bezogen werden kann und die aus 50 Gulden geschützt ist,
endlich 25 Gulden Schulgeld von jedem vermöglichen Schüler. Die Bewerber
um diese Stelle haben ihre desfallsigen Gesuche im Laufe des Monats Januar
1873 nebst ihren Zeugnissen über Befähigung und früherer Laufbahn bei
unterzeichneter Stelle einzusenden. Haigerloch, 1. Januar 1873. Das
Kuratorium der Anstalt. Der Vorstand. Jakob Regensburger." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Januar 1873:
"Haigerloch, den 1. Januar 1873. Es wurde mit
Genehmigung...." Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Januar 1873:
"Haigerloch, den 1. Januar 1873. Es wurde mit
Genehmigung...."
(Text wie oben in der Zeitschrift "Der
Israelit") |
Zum 60. Todestag von Jakob Regensburger
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1933: |
Ausschreibung der Lehrer- und Kantorstelle (1878)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. November 1878:
"In der israelitischen Gemeinde Haigerloch (Hohenzollern) ist die
Lehrer- und Kantorstelle sofort zu besetzen. Fixer Gehalt 1.500 Mark nebst
freier Wohnung. Bewerber wollen ihre Zeugnisse einsenden an das
israelitische Vorsteheramt Haigerloch." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. November 1878:
"In der israelitischen Gemeinde Haigerloch (Hohenzollern) ist die
Lehrer- und Kantorstelle sofort zu besetzen. Fixer Gehalt 1.500 Mark nebst
freier Wohnung. Bewerber wollen ihre Zeugnisse einsenden an das
israelitische Vorsteheramt Haigerloch." |
Hebräische Prüfungen an der Schule durch Rabbiner Dr.
Joseph Spitz
(1885)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1885: "Haigerloch
(Hohenzollern). Am 2. April dieses Jahres, dem 1. Tag der Halbfeiertag
von Pessach, wurde hier nach langjähriger Pause wieder einmal eine
hebräische Prüfung abgehalten, deren Resultate in jeder Beziehung als glänzende
zu bezeichnen sind. Unser allverehrter Herr Rabbiner Dr. Spitz, seit einem
Jahre in höchst segensreicher Weise hier wirksam, hat es verstanden, in
unserer Gemeinde, in der sich noch Sinn und Verständnis für das rechte,
unverfälschte Judentum erhalten hat, durch Wort und Beispiel in Synagoge
und Schule zur Belebung und Erhaltung des wahren jüdischen Geistes
allseitig beizutragen. Diese glänzenden Erfolge seiner Wirksamkeit,
dessen moralischer Einfluss und anregende Tätigkeit wurde besonders heute
einem sehr zahlreichen Auditorium bei der stattgehabten Prüfung sichtbar,
sodass alle Anwesenden mit sichtlichem Erstaunen dem Gange der Prüfung
lauschten. Mit der größten Schlagfertigkeit und Präzision antworteten
die durch den Herrn Examinanten sehr gut disziplinierten Schüler in der
Religionslehre, im Übersetzen des Pentateuchs, der täglichen Gebete, der
hebräisch Grammatik und so fort. Es war in der Tat eine Freude, teilweise
noch sehr junge Kinder, Knaben wie Mädchen so lebendig und frisch,
manchmal sehr schwierige grammatikalische Fragen richtig lösen und ganz pünktlich
übersetzen zu hören. Auch über die Festtage und deren Bedeutung, wie über
die Pflichtenlehre wussten die Kinder vorzüglich Bescheid zu erteilen.
Hierbei wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass zur Freude aller
Anwesenden, kurz nach Beginn der Prüfung, was gewiss heutigen Tages ein höchst
erfreuliches Zeichen der Toleranz, unser hoch geehrter Herr Oberamtmann
(Landrat) Emele erschien, dieselbe durch 1 ½-stündige Anwesenheit
beehrte und weil Kenner der hebräischen Sprache mit gespannter
Aufmerksamkeit und sichtlichem Interesse manchmal selbst eingreifend, dem
raschen Fragen- und Antwortenspiel mit rechter Sympathie folgte. Mit
herzlicher Freude gratulierte er vor seinem Weggange dem hochwürdigen
Herrn Rabbiner und beglückwünschte die Zuhörer zu den trefflichen
Leistungen der israelitischen Kinder bei der heutigen Prüfung. Möchte
nun aber auch die jüdische Gemeinde Haigerloch kräftig, froh und freudig
dazu beitragen, ihren durchaus gelehrten Herrn Rabbiner dauernd zu
erhalten und ihn durch tätige Mitwirkung nach Kräften in seinem heiligen
Berufe unterstützen, damit er hier weiter baue am heiligen Bau des
mosaischen Glaubens, wohl bewusst, dass es gerade in der Jetztzeit doppelt
Pflicht ist, die humanitären und gottesgefälligen Institutionen aufrecht
zu erhalten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1885: "Haigerloch
(Hohenzollern). Am 2. April dieses Jahres, dem 1. Tag der Halbfeiertag
von Pessach, wurde hier nach langjähriger Pause wieder einmal eine
hebräische Prüfung abgehalten, deren Resultate in jeder Beziehung als glänzende
zu bezeichnen sind. Unser allverehrter Herr Rabbiner Dr. Spitz, seit einem
Jahre in höchst segensreicher Weise hier wirksam, hat es verstanden, in
unserer Gemeinde, in der sich noch Sinn und Verständnis für das rechte,
unverfälschte Judentum erhalten hat, durch Wort und Beispiel in Synagoge
und Schule zur Belebung und Erhaltung des wahren jüdischen Geistes
allseitig beizutragen. Diese glänzenden Erfolge seiner Wirksamkeit,
dessen moralischer Einfluss und anregende Tätigkeit wurde besonders heute
einem sehr zahlreichen Auditorium bei der stattgehabten Prüfung sichtbar,
sodass alle Anwesenden mit sichtlichem Erstaunen dem Gange der Prüfung
lauschten. Mit der größten Schlagfertigkeit und Präzision antworteten
die durch den Herrn Examinanten sehr gut disziplinierten Schüler in der
Religionslehre, im Übersetzen des Pentateuchs, der täglichen Gebete, der
hebräisch Grammatik und so fort. Es war in der Tat eine Freude, teilweise
noch sehr junge Kinder, Knaben wie Mädchen so lebendig und frisch,
manchmal sehr schwierige grammatikalische Fragen richtig lösen und ganz pünktlich
übersetzen zu hören. Auch über die Festtage und deren Bedeutung, wie über
die Pflichtenlehre wussten die Kinder vorzüglich Bescheid zu erteilen.
Hierbei wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass zur Freude aller
Anwesenden, kurz nach Beginn der Prüfung, was gewiss heutigen Tages ein höchst
erfreuliches Zeichen der Toleranz, unser hoch geehrter Herr Oberamtmann
(Landrat) Emele erschien, dieselbe durch 1 ½-stündige Anwesenheit
beehrte und weil Kenner der hebräischen Sprache mit gespannter
Aufmerksamkeit und sichtlichem Interesse manchmal selbst eingreifend, dem
raschen Fragen- und Antwortenspiel mit rechter Sympathie folgte. Mit
herzlicher Freude gratulierte er vor seinem Weggange dem hochwürdigen
Herrn Rabbiner und beglückwünschte die Zuhörer zu den trefflichen
Leistungen der israelitischen Kinder bei der heutigen Prüfung. Möchte
nun aber auch die jüdische Gemeinde Haigerloch kräftig, froh und freudig
dazu beitragen, ihren durchaus gelehrten Herrn Rabbiner dauernd zu
erhalten und ihn durch tätige Mitwirkung nach Kräften in seinem heiligen
Berufe unterstützen, damit er hier weiter baue am heiligen Bau des
mosaischen Glaubens, wohl bewusst, dass es gerade in der Jetztzeit doppelt
Pflicht ist, die humanitären und gottesgefälligen Institutionen aufrecht
zu erhalten." |
Ausschreibung
der Stelle des Schächters, Hilfskantors und Religionslehrers (1902)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1902: "Die
Stelle eines Schächters, Hilfskantors und Religionslehrers ist in unserer
Gemeinde sofort zu besetzen. Gehalt 800 Mark, Nebeneinkommen ca. 500 Mark.
Ledige Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisabschriften bei
dem unterzeichneten Vorsteheramte melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1902: "Die
Stelle eines Schächters, Hilfskantors und Religionslehrers ist in unserer
Gemeinde sofort zu besetzen. Gehalt 800 Mark, Nebeneinkommen ca. 500 Mark.
Ledige Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisabschriften bei
dem unterzeichneten Vorsteheramte melden.
Haigerloch (Hohenzollern), August 1902. Das israelitische Vorsteheramt:
L. Speyer." |
25-jähriges
Jubiläum von Lehrer Speyer (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11.
Mai 1905: "Haigerloch. Der israelitische Lehrer Speyer
feierte heute sein 25-jähriges Jubiläum. Nach dem Gottesdienste
versammelte sich die ganze Gemeinde vor seinem Hause. Es wurden schöne
Ansprachen gehalten und prächtige Geschenke überreicht. Die Mitglieder
der Gemeinde haben gezeigt, dass sie Unterricht und Erziehung zu schätzen
und Dankbarkeit zu üben wissen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11.
Mai 1905: "Haigerloch. Der israelitische Lehrer Speyer
feierte heute sein 25-jähriges Jubiläum. Nach dem Gottesdienste
versammelte sich die ganze Gemeinde vor seinem Hause. Es wurden schöne
Ansprachen gehalten und prächtige Geschenke überreicht. Die Mitglieder
der Gemeinde haben gezeigt, dass sie Unterricht und Erziehung zu schätzen
und Dankbarkeit zu üben wissen." |
Die
israelitische Schule wird der evangelischen Schule gleichgestellt (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Mai 1904:
"Haigerloch (Hohenzollern), 15. Mai (1904). Die hiesige
Gemeindevertretung hat diese Woche beschlossen, wie die evangelische
Schule, so auch die israelitische Schule auf den Gemeindeverband zu
übernehmen."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Mai 1904:
"Haigerloch (Hohenzollern), 15. Mai (1904). Die hiesige
Gemeindevertretung hat diese Woche beschlossen, wie die evangelische
Schule, so auch die israelitische Schule auf den Gemeindeverband zu
übernehmen." |
Zum
Tod von Prediger und Lehrer J. Hilb (1905)
 Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. April 1905:
"In Haigerloch ist am 7. vorigen Monats der Prediger und
Lehrer J. Hilb im 61. Lebensjahre gestorben". Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. April 1905:
"In Haigerloch ist am 7. vorigen Monats der Prediger und
Lehrer J. Hilb im 61. Lebensjahre gestorben". |
Zum Tod von Lehrer Speyer
(1907)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1907: "Haigerloch,
18. März. Heute wurde in Haigerloch Herr Lehrer Speyer zu Grabe getragen.
Am Tage seiner Todes wurde ihm vom Bürgermeister seine Pensionierung ins
Haus getragen, aber seine welke Hand konnte das Schriftstück schon nicht
mehr unterschreiben. Tags darauf kam der Kreisschulinspektor von Hechingen
angefahren, um ihn mit einem Orden zu dekorieren. Sein Vorgesetzter stand
vor einer Leiche und musste unverrichteter Sache aus dem Hause des Todes
scheiden. Seine Seele sein eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1907: "Haigerloch,
18. März. Heute wurde in Haigerloch Herr Lehrer Speyer zu Grabe getragen.
Am Tage seiner Todes wurde ihm vom Bürgermeister seine Pensionierung ins
Haus getragen, aber seine welke Hand konnte das Schriftstück schon nicht
mehr unterschreiben. Tags darauf kam der Kreisschulinspektor von Hechingen
angefahren, um ihn mit einem Orden zu dekorieren. Sein Vorgesetzter stand
vor einer Leiche und musste unverrichteter Sache aus dem Hause des Todes
scheiden. Seine Seele sein eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 29. März 1907: Derselbe Bericht wie im
"Israelit" erschien im "Frankfurter Israelitischen
Familienblatt". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 29. März 1907: Derselbe Bericht wie im
"Israelit" erschien im "Frankfurter Israelitischen
Familienblatt". |
Ausschreibung
der Stelle des Lehrers und Kantors (1907)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 12. Juli 1907: "Die israelitische Lehrer- und Kantorstelle Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 12. Juli 1907: "Die israelitische Lehrer- und Kantorstelle
in Haigerloch-Hohenzollern wird zur Besetzung auf 1. Januar 1908
ausgeschrieben.
Das Einkommen beträgt: a) Grundgehalt einschließlich Heizung 1600 Mark;
b) freie Wohnung; c) Alterszulageneinheitssatz 130 Mark. Zu dem Lehrer-
und Kantorgehalt wird aus der Gemeindekasse ein weiterer Beitrag von 400
Mark geleistet und erhält der Stelleninhaber außerdem als Nebenverdienst
für Rabbinatsfunktionen 3-400 Mark. Bewerber wollen ihre Gesuche unter
Anschluss von Zeugnissen einsehen.
Das israelitische Vorsteheramt." |
Lehrer Wallach engagiert sich bei der Gründung des
jüdischen Schwarzwald-Jugendgauverbandes (1920)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. August 1920:
"Mühringen, 30. Juli (1920). Endlich kam der Plan, der in
Versammlungen zu Mühringen und Haigerloch angeregt wurde, zur
Ausführung. Die Schwarzwald-Jugendvereine Haigerloch, Mühringen,
Baisingen, Horb und Rexingen folgten einer Einladung des Herrn
Hauptlehrer Wallach (Haigerloch) nach Rexingen, um dort die
endgültige Statuierung des Schwarzwald-Jugendgauverbandes vorzunehmen.
Auf Sonntag, den 11. Juli, nachmittags 2 Uhr, war die Versammlung
einberufen. Sämtliche Vereine waren zahlreich vertreten, sodass der
große Saal in der Wirtschaft zum 'Kaiser' kaum ausreichte. Nach einer
kleinen Begrüßungsansprache des Vorstandes von der Jugendgruppe
Rexingen, Herrn Julius Fröhlich, ergriff Herr Wallach das Wort zu einer
längeren Ausführung. Er schilderte in klaren Worten die jetzigen
Zustände in unserem deutschen Vaterlande, kam dann ganz eingehend auf die
antisemitische Verhetzung des deutschen Volkes zu sprechen und somit auf
den Zweck des zu gründenden Schwarzwaldverbandes. Es ist Pflicht der
jüdischen Jugend, sich zusammenzuschließen zum gemeinsamen Arbeiten, zur
gemeinsamen Abwehr, und ganz besonders muss die jüdische Jugend beim
Wiederaufbau des Vaterlandes mitarbeiten helfen. Hierauf fand eine
Versammlung der Delegierten der einzelnen Ortsgruppen statt, die den
Arbeitsplan für die kommenden Wintermonate festlegte. Diese Arbeit soll
eine gemeinsame sein in allen Vereinen, die dem Verband angehören. Es
wurde beschlossen, dass innerhalb acht Wochen mindestens ein größerer
Vortrag in jeder Ortsgruppe stattzufinden hat, und zwar aus dem Gebiete
der jüdischen Geschichte und Literatur sowie über jüdisch-politische
Themen. Der Referent, der für das betreffende Thema vorgesehen ist, hat
den Vortrag in allen Ortsgruppen zu halten, damit die Arbeit eine
einheitliche wird. In der Zwischenzeit bleibt es dem Vorstand jeder
Ortsgruppe überlassen, für Lehr- und Unterhaltungsabende zu sorgen. Von
Zeit zu Zeit sollen Gauzusammenkünfte stattfinden, um über das Gehörte
zu diskutieren und neue Anträge und Wünsche vorzubringen. Der
Arbeitsplan wurden dem Plenum der Versammlung vorgelegt und von diesem
nach reger 'Aussprache gut geheißen. Nun folgte die Wahl des
Gauvorstandes und Ausschusses. Gauvorstand: Herr Hauptlehrer Wallach
(Haigerloch), Gauausschussmitglieder. Herr Hauptlehrer Spatz (Rexingen),
Herr Lehrer Jakob Adler (Mühringen), Herr Herrmann Kahn (Baisingen),
Fräulein Flora Rothschild (Horb-Nordstetten). Statuten hat der Gauverband
keine, maßgebend sind für jeden Verein die betreffenden
Ortsvereinsstatuten. Nach einer kleinen Schlussansprache des Herrn Julius
Fröhlich (Rexingen) mit dem Wunsche für gedeihliche und segenbringende
Zusammenarbeit schloss die gut gelungene Versammlung." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. August 1920:
"Mühringen, 30. Juli (1920). Endlich kam der Plan, der in
Versammlungen zu Mühringen und Haigerloch angeregt wurde, zur
Ausführung. Die Schwarzwald-Jugendvereine Haigerloch, Mühringen,
Baisingen, Horb und Rexingen folgten einer Einladung des Herrn
Hauptlehrer Wallach (Haigerloch) nach Rexingen, um dort die
endgültige Statuierung des Schwarzwald-Jugendgauverbandes vorzunehmen.
Auf Sonntag, den 11. Juli, nachmittags 2 Uhr, war die Versammlung
einberufen. Sämtliche Vereine waren zahlreich vertreten, sodass der
große Saal in der Wirtschaft zum 'Kaiser' kaum ausreichte. Nach einer
kleinen Begrüßungsansprache des Vorstandes von der Jugendgruppe
Rexingen, Herrn Julius Fröhlich, ergriff Herr Wallach das Wort zu einer
längeren Ausführung. Er schilderte in klaren Worten die jetzigen
Zustände in unserem deutschen Vaterlande, kam dann ganz eingehend auf die
antisemitische Verhetzung des deutschen Volkes zu sprechen und somit auf
den Zweck des zu gründenden Schwarzwaldverbandes. Es ist Pflicht der
jüdischen Jugend, sich zusammenzuschließen zum gemeinsamen Arbeiten, zur
gemeinsamen Abwehr, und ganz besonders muss die jüdische Jugend beim
Wiederaufbau des Vaterlandes mitarbeiten helfen. Hierauf fand eine
Versammlung der Delegierten der einzelnen Ortsgruppen statt, die den
Arbeitsplan für die kommenden Wintermonate festlegte. Diese Arbeit soll
eine gemeinsame sein in allen Vereinen, die dem Verband angehören. Es
wurde beschlossen, dass innerhalb acht Wochen mindestens ein größerer
Vortrag in jeder Ortsgruppe stattzufinden hat, und zwar aus dem Gebiete
der jüdischen Geschichte und Literatur sowie über jüdisch-politische
Themen. Der Referent, der für das betreffende Thema vorgesehen ist, hat
den Vortrag in allen Ortsgruppen zu halten, damit die Arbeit eine
einheitliche wird. In der Zwischenzeit bleibt es dem Vorstand jeder
Ortsgruppe überlassen, für Lehr- und Unterhaltungsabende zu sorgen. Von
Zeit zu Zeit sollen Gauzusammenkünfte stattfinden, um über das Gehörte
zu diskutieren und neue Anträge und Wünsche vorzubringen. Der
Arbeitsplan wurden dem Plenum der Versammlung vorgelegt und von diesem
nach reger 'Aussprache gut geheißen. Nun folgte die Wahl des
Gauvorstandes und Ausschusses. Gauvorstand: Herr Hauptlehrer Wallach
(Haigerloch), Gauausschussmitglieder. Herr Hauptlehrer Spatz (Rexingen),
Herr Lehrer Jakob Adler (Mühringen), Herr Herrmann Kahn (Baisingen),
Fräulein Flora Rothschild (Horb-Nordstetten). Statuten hat der Gauverband
keine, maßgebend sind für jeden Verein die betreffenden
Ortsvereinsstatuten. Nach einer kleinen Schlussansprache des Herrn Julius
Fröhlich (Rexingen) mit dem Wunsche für gedeihliche und segenbringende
Zusammenarbeit schloss die gut gelungene Versammlung." |
Über den aus Haigerloch stammenden Kantor Jakob
(Jacob) Hohenemser (1911-1964)
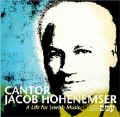 Jakob
Hohenemser ist am 12. August 1911 als Sohn des Kaufmann Sigmund
Hohenemser und seiner Frau Mathilde geb. Einstein in Haigerloch geboren
(vgl. Dokument zu S. Hohenemser unten). Er ließ sich am Israelitischen
Lehrerseminar in Würzburg von 1928 bis 1931 zum Lehrer und Kantor
ausbilden (R. Strätz, Biograph. Handbuch Würzburger Juden Bd. 1 S. 273).
Von 1936 bis 1938 war er (der letzte) Kantor an der Hauptsynagoge in
München, die 1938 zerstört wurde. Im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom
1938 wurde er in das KZ Dachau verschleppt. 1939 konnte er in die USA
emigrieren, wo er schließlich eine Stelle als Kantor der Congregation
Temple Emanu-El in Providence, Rhode Island fand. Er starb 1964. Jakob
Hohenemser ist am 12. August 1911 als Sohn des Kaufmann Sigmund
Hohenemser und seiner Frau Mathilde geb. Einstein in Haigerloch geboren
(vgl. Dokument zu S. Hohenemser unten). Er ließ sich am Israelitischen
Lehrerseminar in Würzburg von 1928 bis 1931 zum Lehrer und Kantor
ausbilden (R. Strätz, Biograph. Handbuch Würzburger Juden Bd. 1 S. 273).
Von 1936 bis 1938 war er (der letzte) Kantor an der Hauptsynagoge in
München, die 1938 zerstört wurde. Im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom
1938 wurde er in das KZ Dachau verschleppt. 1939 konnte er in die USA
emigrieren, wo er schließlich eine Stelle als Kantor der Congregation
Temple Emanu-El in Providence, Rhode Island fand. Er starb 1964.
Von ihm wurde ein Langspielplatte / CD herausgebracht:
Cantor Jacob Hohenemser: A Life for Jewish Musik. Hrsg. vom Jüdischen
Museum Hohenems. 2010.
Diese CD ist erhältlich beim Jüdischen
Museum in Hohenems. |
Über den Lehrer Gustav Spier (geb. 1892 in Zwesten,
1924 bis 1939 Lehrer in Haigerloch,
umgekommen 1942)
 Gustav
Spier stammte aus der bekannten Familie Spier in Zwesten, aus der in drei
Generationen Lehrer, Vorbeter und Rabbiner hervorgingen. Spier ist am 16.
März 1892 in Zwesten geboren. Er ließ sich am Lehrerseminar in Kassel
ausbilden und legte im Februar 1912 als Jahrgangsbester sein 1. Examen ab.
Am Ersten Weltkrieg nahm er als Soldat teil. Er unterrichtete
an der Volksschule Kronjanke in Westpreußen sowie an der jüdischen
Volksschule in Geisa (Thüringen). Im
Juni 1924 kam er mit seiner aus Geisa gebürtigen Frau Hertha geb. Bloch
und der 1921 geborenen Tochter Ruth nach Haigerloch.
Hier war Spier als Rabbinatsverweser angestellt und für die
religiösen Aufgaben der Gemeinde zuständig. Bekannt wurde er in
Haigerloch auch als
Heimatforscher und Publizist. Beim Novemberpogrom 1938 wurde Gustav Spier
verhaftet und für mehrere Wochen in das KZ Dachau verschleppt. Am 1.
Oktober 1939 wurde aus aus dem Staatsdienst entlassen, die jüdische
Volksschule Haigerloch geschlossen. Außer seiner Tochter Ruth, die
im Februar 1939 mit einem Kindertransport nach England emigrieren konnte,
wurde die gesamte Familie Spier (auch Gustavs Eltern Simon Spier und
Amalie geb. Rosenberg, die 1938 von Zwesten nach Haigerloch umgezogen
waren) deportiert und in das KZ Salspil bei Riga verschleppt. Gustav und
Hertha Spier sowie der Sohn Julius sind dort wenig später umgekommen,
gleichfalls die Eltern von Gustav (Simon Spier im Oktober 1942, Amalie
geb. Rosenberg am 13. September 1942 im Ghetto Theresienstadt). Gustav
Spier stammte aus der bekannten Familie Spier in Zwesten, aus der in drei
Generationen Lehrer, Vorbeter und Rabbiner hervorgingen. Spier ist am 16.
März 1892 in Zwesten geboren. Er ließ sich am Lehrerseminar in Kassel
ausbilden und legte im Februar 1912 als Jahrgangsbester sein 1. Examen ab.
Am Ersten Weltkrieg nahm er als Soldat teil. Er unterrichtete
an der Volksschule Kronjanke in Westpreußen sowie an der jüdischen
Volksschule in Geisa (Thüringen). Im
Juni 1924 kam er mit seiner aus Geisa gebürtigen Frau Hertha geb. Bloch
und der 1921 geborenen Tochter Ruth nach Haigerloch.
Hier war Spier als Rabbinatsverweser angestellt und für die
religiösen Aufgaben der Gemeinde zuständig. Bekannt wurde er in
Haigerloch auch als
Heimatforscher und Publizist. Beim Novemberpogrom 1938 wurde Gustav Spier
verhaftet und für mehrere Wochen in das KZ Dachau verschleppt. Am 1.
Oktober 1939 wurde aus aus dem Staatsdienst entlassen, die jüdische
Volksschule Haigerloch geschlossen. Außer seiner Tochter Ruth, die
im Februar 1939 mit einem Kindertransport nach England emigrieren konnte,
wurde die gesamte Familie Spier (auch Gustavs Eltern Simon Spier und
Amalie geb. Rosenberg, die 1938 von Zwesten nach Haigerloch umgezogen
waren) deportiert und in das KZ Salspil bei Riga verschleppt. Gustav und
Hertha Spier sowie der Sohn Julius sind dort wenig später umgekommen,
gleichfalls die Eltern von Gustav (Simon Spier im Oktober 1942, Amalie
geb. Rosenberg am 13. September 1942 im Ghetto Theresienstadt). |
Lehrer
Gustav Spier referiert im Jüdischen Jugendverein in Eschwege (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. Juli 1927: "Eschwege.
Der Jüdische Jugendverein Eschwege wird sich am 14. August (Sonntag
nachmittag) auf dem Meißner mit dem Nachbarjudenverein (vermutlich:
Nachbarjugendverein) Spangenberg
treffen. Hierzu sind sämtliche Mitglieder, sowie Gäste freundlichst
eingeladen. - Am 10. August, abends 8.30 Uhr, spricht Herr Gustav Spier
aus Haigerloch (Hohenzollern) in unseren Vereinsräumen 'Schöne
Aussicht' über das Thema: 'Das Judentum und die
Friedensidee'."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. Juli 1927: "Eschwege.
Der Jüdische Jugendverein Eschwege wird sich am 14. August (Sonntag
nachmittag) auf dem Meißner mit dem Nachbarjudenverein (vermutlich:
Nachbarjugendverein) Spangenberg
treffen. Hierzu sind sämtliche Mitglieder, sowie Gäste freundlichst
eingeladen. - Am 10. August, abends 8.30 Uhr, spricht Herr Gustav Spier
aus Haigerloch (Hohenzollern) in unseren Vereinsräumen 'Schöne
Aussicht' über das Thema: 'Das Judentum und die
Friedensidee'." |
Lehrer Hermann Adler tritt in den Ruhestand (1930)
Anmerkung: Lehrer Hermann Adler (geb. in Heßdorf) war seit 1905 in
Haigerloch Religionslehrer, 2. Kantor und Schochet sowie zeitweise auch
Gemeinderechner.
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. April 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. April 1930: |
70. Geburtstag von Lehrer i.R. Hermann Adler
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1930: |
Verschiedene Berichte aus dem Gemeinde- und
Vereinsleben
Verschiedene Meldungen (1880)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. September 1880: "Man schreibt uns aus
Haigerloch, den 2. September (1880). Hier ist Herr
David Levi von der größten Zahl der Bürger zum dritten Male zum
Stadtrat gewählt worden. Die hiesige Gemeinde zählt 68 Familien,
worunter 13 Wittfrauen. Sie hat einen herben Verlust durch den Tod des
Herrn Wolf Israel Levi erlitten, der, ein Helfer der Armen und
Notleidenden, lange Zeit, als Mohel unentgeltlich fungierte und jetzt der
Gemeinde ein Stück Feld zur Erweiterung des Friedhofes im Werte von 500
Mark geschenkt hatte. Dagegen müssen wir mit hartem Tadel bemerken, dass
das Vorsteheramt beschlossen hat, der Witwe des hoch verdienten
Rabbinen Hilb keine Pension zu zahlen, weil sie 3.000 Mark von der
Lebensversicherung erhalten hat; als ob diese Frau von dem geringen
Zinsertrage dieser Summe leben könnte. Möge das Vorsteheramt sich bald
eines Anderen besinnen!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. September 1880: "Man schreibt uns aus
Haigerloch, den 2. September (1880). Hier ist Herr
David Levi von der größten Zahl der Bürger zum dritten Male zum
Stadtrat gewählt worden. Die hiesige Gemeinde zählt 68 Familien,
worunter 13 Wittfrauen. Sie hat einen herben Verlust durch den Tod des
Herrn Wolf Israel Levi erlitten, der, ein Helfer der Armen und
Notleidenden, lange Zeit, als Mohel unentgeltlich fungierte und jetzt der
Gemeinde ein Stück Feld zur Erweiterung des Friedhofes im Werte von 500
Mark geschenkt hatte. Dagegen müssen wir mit hartem Tadel bemerken, dass
das Vorsteheramt beschlossen hat, der Witwe des hoch verdienten
Rabbinen Hilb keine Pension zu zahlen, weil sie 3.000 Mark von der
Lebensversicherung erhalten hat; als ob diese Frau von dem geringen
Zinsertrage dieser Summe leben könnte. Möge das Vorsteheramt sich bald
eines Anderen besinnen!" |
Vortrag
von Alfred Levi über die Ziele des religiösen Liberalismus (1926)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 15. Januar 1926: "Haigerloch (Hohenzollern). Unser
rühriger Gesinnungsfreund Herr Alfred Levi hielt am 2. Januar im
vollbesetzten Rosensaal einen Vortrag über die Ziele des religiösen
Liberalismus. Die Zuhörerschaft folgte seinen Darlegungen mit großer
Aufmerksamkeit und nahm diese mit starkem Beifall auf. Auch die Angriffe
eines Diskussionsredners gegen die Ausführungen des Referenten änderten
nichts an der Tatsache, dass der religiöse Liberalismus in der Gemeinde
starke Wurzeln geschlagen hat".
Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 15. Januar 1926: "Haigerloch (Hohenzollern). Unser
rühriger Gesinnungsfreund Herr Alfred Levi hielt am 2. Januar im
vollbesetzten Rosensaal einen Vortrag über die Ziele des religiösen
Liberalismus. Die Zuhörerschaft folgte seinen Darlegungen mit großer
Aufmerksamkeit und nahm diese mit starkem Beifall auf. Auch die Angriffe
eines Diskussionsredners gegen die Ausführungen des Referenten änderten
nichts an der Tatsache, dass der religiöse Liberalismus in der Gemeinde
starke Wurzeln geschlagen hat". |
Anlässlich der Einführung des neuen katholischen Stadtpfarrers wird
die konfessionelle Eintracht beschworen
(1927)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1927: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1927: |
 |
Vortrag im Jüdischen Jugendverein mit Landgerichtsdirektor Stern aus Stuttgart
(1927)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember
1927: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember
1927: |
40-jähriges Bestehen des Männergesangvereins "Liederkranz"
(1928)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar
1928:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar
1928: |
Gefallenen-Gedenkfeier aller Konfessionen
(1928)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1928: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1928: |
Vortrag im Jüdischen Jugendverein von Oberlehrer Theodor Rothschild aus
Esslingen (1928)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1928: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1928: |
Vortragsveranstaltung mit Else Bergmann aus Laupheim und Sophie Levy aus Ulm
(1928)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juni
1928:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juni
1928: |
Neuwahlen zum Israelitischen Vorsteheramt
(1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1929: |
Frühjahrskonzert des jüdischen Männergesangvereins "Liederkranz"
(1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1929:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1929: |
Vortrag im Jüdischen Jugendverein mit Redakteur Hans Sternheim aus Stuttgart
(1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1929: |
Ausflug des Vereins "Jüdisches Lehrhaus" Stuttgart u.a. nach
Haigerloch (1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juni 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juni 1929: |
Haigerlocher Heimattag mit jüdischer Beteiligung
(1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juli
1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juli
1929: |
Vortrag der Deutschen Friedensgesellschaft
(1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1929: |
Vortragsabend in der Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten mit
Dr. Franz Hirsch aus Ulm
(1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. November
1929:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. November
1929: |
Bei den Gemeinde-, Kreistags- und Kommunallandtagswahlen wurden aus Hechingen
und Haigerloch jüdische Personen gewählt
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1930:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1930: |
Chanukkafeier der Gemeinde im Dezember 1929 (1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Januar 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Januar 1930: |
Hauptversammlung des Gesangvereins "Liederkranz" . Plenarversammlung
des "Jüdischen Frauenvereins" - Generalversammlung des "Vereins
für jüdische Geschichte und Literatur"
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1930: |
Mitgliederversammlung des Jüdischen Jugendvereins - Plenarversammlung der
Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1930: |
Vortrag im Jugendverein mit Rechtsanwalt Dr. Tänzer aus Stuttgart
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1930: |
Gemeinsamer Ausflug der jüdischen Jugendvereine Haigerloch und Rottweil
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1930: |
"Rassenkundliche" Forschungen in Haigerloch durch Dr. Stefanie
Martin-Oppenheim aus München
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1930: |
Die Kinder der Gemeinde beteiligen sich zu Simchas Thora bei den Umzügen in der
Synagoge (1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1930: |
Antisemitische Vorfälle
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar
1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar
1931: |
Generalversammlungen der Vereine - Gesangverein "Liederkranz" und
Jüdischer Literaturverein
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1931: |
Berichte aus dem Jüdischen Frauenverein, dem Jüdischen Jugendbund und der
Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. März 1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. März 1931: |
Gefallenengedenkfeier in der Synagoge, auf dem jüdischen Friedhof sowie
Gedenkfeier der Stadt für alle Konfessionen
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1931: |
Vortragsabend des Jugend- und des Literaturvereins
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1931:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1931: |
Vortrag von Rabbiner Dr. Tänzer aus Göppingen
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. April 1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. April 1931: |
Vortrag im Frauenverein von Johanna Bach aus Mühringen
(1931)
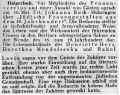 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1931: |
Vortrag im jüdischen Jugendverein über "Jüdische Politik"
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1931:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1931: |
Verschiedene Veranstaltungen in der Gemeinde im Herbst 1932
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1932: |
Chanukkafeier in der Gemeinde - Gemütlicher Abend des Frauenvereins -
Familienabend des jüdischen Gesangvereins "Liederkranz"
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar
1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar
1932: |
Generalversammlungen
verschiedener Vereine (1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1932: "Haigerloch. Im vergangenen Monat hielten die Vereine der Gemeinde ihre
Generalversammlungen ab. Den Anfang machte der jüdische Gesangverein
'Liederkranz'. Er ist im Laufe der letzten Zeit zahlenmäßig etwas zurückgegangen, hat aber durch die Veranstaltungen des verflossenen Jahres aufs Neue seine
ungeschwächte Leistungsfähigkeit bewiesen. Der 'Jüdische Geschichts- und
Literatur-Verein' konnte auf eine Anzahl Neuanschaffungen für seine stark in Anspruch genommen Bücherei hinweisen, ferner auf vier Vortragsabende, die er gemeinsam mit anderen Vereinen der Gemeinde veranstaltet hat.
- Der 'Jugendverein' hat an Mitgliederzahl etwas verloren. Dafür arbeitet er regelmäßiger und eifriger als im
vorletzten Jahre. Zur Schulung der jüngeren Mitglieder werden diese neuerdings zu kleineren Referaten herangezogen. Der
'Jüdische Frauenverein' hat im vergangenen Jahr reichlich Gelegenheit gehabt, Armen und besonders
Kranken seine Hilfe zuzuwenden. Dank einer in Vereinsjahr erfolgten Aufwertung konnte
sein Fonds trotz aller Aufwendungen vergrößert werden. - Als letzter Verein hielt die
Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten ihre
Jahresversammlung ab. Eine Ermäßigung der Beiträge erwies sich hier wie auch bei einigen anderen Vereinen unumgänglich. Die Vorstandschaft
aller Vereine wurden wiedergewählt. Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1932: "Haigerloch. Im vergangenen Monat hielten die Vereine der Gemeinde ihre
Generalversammlungen ab. Den Anfang machte der jüdische Gesangverein
'Liederkranz'. Er ist im Laufe der letzten Zeit zahlenmäßig etwas zurückgegangen, hat aber durch die Veranstaltungen des verflossenen Jahres aufs Neue seine
ungeschwächte Leistungsfähigkeit bewiesen. Der 'Jüdische Geschichts- und
Literatur-Verein' konnte auf eine Anzahl Neuanschaffungen für seine stark in Anspruch genommen Bücherei hinweisen, ferner auf vier Vortragsabende, die er gemeinsam mit anderen Vereinen der Gemeinde veranstaltet hat.
- Der 'Jugendverein' hat an Mitgliederzahl etwas verloren. Dafür arbeitet er regelmäßiger und eifriger als im
vorletzten Jahre. Zur Schulung der jüngeren Mitglieder werden diese neuerdings zu kleineren Referaten herangezogen. Der
'Jüdische Frauenverein' hat im vergangenen Jahr reichlich Gelegenheit gehabt, Armen und besonders
Kranken seine Hilfe zuzuwenden. Dank einer in Vereinsjahr erfolgten Aufwertung konnte
sein Fonds trotz aller Aufwendungen vergrößert werden. - Als letzter Verein hielt die
Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten ihre
Jahresversammlung ab. Eine Ermäßigung der Beiträge erwies sich hier wie auch bei einigen anderen Vereinen unumgänglich. Die Vorstandschaft
aller Vereine wurden wiedergewählt.
Im Frauenverein sprach der Vorsitzende der Gemeinde, Alfred Levi, über
'Die Frau und das Bürgerliche Gesetzbuch'. Eine rege Aussprache zeigte, dass der Referent das Interesse seiner Zuhörerinnen gefunden hatte."
|
Vortrag im Jüdischen Frauenverein von Else Bergmann aus Laupheim
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1932: "Haigerloch. Im Jüdischen Frauenverein sprach am 23. Februar
Frau Else Bergmann, Laupheim in
interessanter Weise über die Bestrebungen und Erfolge des Landesverbands im letzten Jahre und gab so den Frauen unserer Gemeinde erwünschte Gelegenheit, von
bestunterrichteter Seite zu erfahren, was der Verband auf dem Gebiete der Berufsberatung und
-Ausbildung, der Stellenvermittlung, der Erholungsfürsorge, der Reisekasse
usw. geleistet hat. In der sich anschließenden lebhaften Diskussionen kamen von Seiten der Hörerschaft manche Wünsche
- unter anderem Schaffung einer Nähstube - zum Ausdruck. Der Erfolg des warmherzigen Referats dürfte sich bald in einer verstärkten Arbeit des hiesigen Vereins
zeigen." Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1932: "Haigerloch. Im Jüdischen Frauenverein sprach am 23. Februar
Frau Else Bergmann, Laupheim in
interessanter Weise über die Bestrebungen und Erfolge des Landesverbands im letzten Jahre und gab so den Frauen unserer Gemeinde erwünschte Gelegenheit, von
bestunterrichteter Seite zu erfahren, was der Verband auf dem Gebiete der Berufsberatung und
-Ausbildung, der Stellenvermittlung, der Erholungsfürsorge, der Reisekasse
usw. geleistet hat. In der sich anschließenden lebhaften Diskussionen kamen von Seiten der Hörerschaft manche Wünsche
- unter anderem Schaffung einer Nähstube - zum Ausdruck. Der Erfolg des warmherzigen Referats dürfte sich bald in einer verstärkten Arbeit des hiesigen Vereins
zeigen."
" |
Neuwahlen zum Israelitischen Vorsteheramt - Vortragsveranstaltung im
Jugendverein mit Moses Thalmann aus Pforzheim (1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1932: "Haigerloch. Am 24. April fanden die Neuwahlen zum Vorsteheramt statt. Mit etwa neun Zehntel aller abgegebenen Stimmen wurden die seitherigen Vorsteher
- Vorsitzender Alfred Levi, Ludwig Reutlinger, Albert Ullmann, Wilhelm
Levi und Benno Wilhelm Weil - wiedergewählt. Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1932: "Haigerloch. Am 24. April fanden die Neuwahlen zum Vorsteheramt statt. Mit etwa neun Zehntel aller abgegebenen Stimmen wurden die seitherigen Vorsteher
- Vorsitzender Alfred Levi, Ludwig Reutlinger, Albert Ullmann, Wilhelm
Levi und Benno Wilhelm Weil - wiedergewählt.
Am 1. Mai sprach im Jugendverein Moses Thalmann aus Pforzheim über das Thema
"Fragen, die uns heute interessieren". Der Redner behandelte zunächst die wirtschaftliche Krise und suchte darzulegen, warum sich diese mit einer gewissen Notwendigkeit im jüdischen Menschen Kreis im jüdischen Menschen Kreise besonders auswirken musste. Er gab dann einen Einblick in die geistigen und religiösen Nöte unserer Zeit und zeigte zum Schluss die Arbeit an den geistigen Werten des Judentums und die Betätigung jüdischen Gemeinschaftsgefühls als Wege aus der Not. Eine Aussprache schloss sich an." |
100-jähriges Bestehen des Geschäftes der Familie Josef Hirsch
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober
1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober
1932: |
Kulturelle Veranstaltungen im Herbst 1932
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Dezember 1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Dezember 1932: |
Vortragsveranstaltungen des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur und
der Jugendvereins
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember
1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember
1932: |
60 Jahre Jüdischer Frauenverein
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 18. Januar 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 18. Januar 1933: |
Vortrag im Jüdischen Frauenverein mit Meta Adelsheimer aus Stuttgart
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 18. Januar 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 18. Januar 1933: |
Chanukkafeier der Gemeinde im Dezember 1932
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1933: |
Generalversammlungen der Vereine, darunter 60-jähriges Bestehen des Jüdischen
Frauenvereins
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1933:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1933: |
Vortragsveranstaltung mit Rabbiner Mayer aus Frankfurt am Main
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar
1933:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar
1933: |
Erzählung
über einen alten Pessachbrauch in Haigerloch (1933)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und
Umgebung" vom 7. April 1933: "Das Chomezhäusle. Ein
Pessachbrauch, erzählt von J. Hohenemser - Worms. In einem kleinen Städtchen,
das an der Grenze zwischen Württemberg und Hohenzollern liegt, hat sich
bis auf den heutigen Tag ein uralter Brauch erhalten, der wegen seiner
Anschaulichkeit und des Miterlebens, das sich tief in die kindliche Seele
eingräbt, besonders für das jüdische Kind großen Wert besitzt. Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und
Umgebung" vom 7. April 1933: "Das Chomezhäusle. Ein
Pessachbrauch, erzählt von J. Hohenemser - Worms. In einem kleinen Städtchen,
das an der Grenze zwischen Württemberg und Hohenzollern liegt, hat sich
bis auf den heutigen Tag ein uralter Brauch erhalten, der wegen seiner
Anschaulichkeit und des Miterlebens, das sich tief in die kindliche Seele
eingräbt, besonders für das jüdische Kind großen Wert besitzt.
Die Eyach, ein Nebenfluss des Neckars, schlingt sich kunstvoll an den
Felswänden vorbei, an denen die Häuser des Städtchens zu kleben
scheinen. Über das jüdische Viertel, den 'Haag', breitet sich eine
Staubwolke aus, von den Felswänden hallt das Echo der teppichklopfenden
Frauen. Aus den Fenstern der Häuser hört man das Rasseln und Klirren von
Geschirr. Man hört das Kreischen weiblicher Stimmen, die im Weg stehende
Kinder hinwegjagen. Wir stehen inmitten der großen Reinigungszeit vor
Pessach.
Im Hofe der alten Mazzenbäckerei sammelt sich die Kinderschar der
zusammengeschrumpften jüdischen Volksschule. Von einst neunzig Kindern
sind noch fünfzehn übrig. Die Esther hat einen Eimer mitgebracht, der
Jakob eine Schaufel, der Fritz einen Hammel. Der Julius hat einen Wagen
dabei. Das kleine Häufchen sieht aus, als wollten sie auf den
ägyptischen Bauplatz, um eine Pyramide zu bauen. Jedes Kind hat
selbstverständlich das älteste an, was Frau Mutter aus dem Schrank
hervorziehen konnte. Und fragt man das bunte Häufchen: 'Wohin geht ihr
denn in eurer Ausrüstung?' so antworten sie: 'Wir bauen am Chomezhäusle,
damit man das Chomez darin verbrennen kann!'
Am Bergabhang liegt der jüdische Friedhof. Hier ruhen schon gar viele,
und sie brauchen es nicht zu bedauern und werden die Lebenden um ihr Los
auch nicht beneiden. In der Nähe dieses idyllisch gelegenen Ruheplatzes
ist die Verbrennungsstätte des Gesäuerten, des Chomez. An diese Stelle
ziehen die Kinder. Der Älteste ist ach alter Überlieferung der
Anführer. Er teilt die Kinder ein in: Steinherbeischlepper, Lehmkneter,
Baumeister und Aufseher. Jedes Kind fühlt und weiß: Das ist nicht nur
Spielerei! Hier geht es um ein Gebot, um die Mizwah! Da fallen bedeutende
Worte wie: 'So wie wir haben unsere Urväter auch gearbeitet' oder der
Älteste ruft: 'Ihr müsst noch mehr schaffen, damit Ihr wisst, was Moraur
bedeutet'. - Die Hagadah wird erlebt. Ein Jugenderlebnis, das nie aus der
Seele schwindet. Die Arbeit schreitet vorwärts. Bereits stehen die
niedrigen Steinwände, die ein Viereck bilden, wie die Mauern eines
Hauses, auf denen noch ein Dach gezimmert ist. Deshalb der Name 'Chomezhäusle'.
Das Bestreichen mit Lehm geht schnell voran. Bald kann es seiner
Bestimmung übergeben werden.
Erew-Pessach - 9 Uhr - Den Berg herunter springen Kinder, und Hände
umspannen große Heubündel und Strohgarben, manche bringen die Arme voll
alter Zeitungen oder Holzbündel. Jedes Kind will dazu beitragen, dass das
Chomezfeuer recht groß wird. Ein hallo, die ersten Leute kommen, in der
Hand die Hagadah und das in weißes Leinen gehüllte Chomez. Immer mehr
Männer kommen. Alle Kinderaugen starren überirdisch den alten Isser an. Langsam,
würdig zieht dieser die Streichhölzer heraus - ein Ruf aus allen
Kinderkehlen: 'Das Chomez brennt!' |
Vortragsveranstaltungen des Jüdischen Frauenvereins
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1933: |
50. Stiftungstag des Wohltätigkeitsvereines Chewra Gemiluth Chesed
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1933: |
Rückgang der jüdischen Bevölkerung in Haigerloch - Vortragsveranstaltungen
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August
1933:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August
1933: |
Neuhebräisch-Kurs mit Lehrer Spier
(1933)
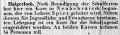 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Oktober 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Oktober 1933: |
Eine Winterhilfe-Sammlung wird in der jüdischen Gemeinde durchgeführt
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 8. November 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 8. November 1933: |
Vortrag über Palästina und weitere Veranstaltungen im Herbst 1933
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1934: |
Chanukkafeier der Gemeinde im Dezember 1933
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1934: |
Bericht über die Aktivitäten verschiedener jüdischer Vereine
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1934: |
Gemeindeversammlung mit Vortrag von Ilse Wolff aus Stuttgart sowie
Vortragsveranstaltungen im Jüdischen Frauenverein und im Jugendverein
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1934:
|
Vortragsveranstaltungen im Frauenverein und im Jugendbund
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1934: |
Theodor-Herzl-Gedenkfeier
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juli 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juli 1934: |
Gedenkstunde des Jugendbundes für Chajim Nachmann Bialik
(1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1934: |
Verschiedene Veranstaltungen, u.a. Palästina-Film-Abend und Vortrag von Dr.
Julius Herzfeld aus Köln (1934)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember 1934: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember 1934: |
Chanukkafeier im Dezember 1934 (1935)
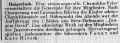 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1935: |
Bibelabende mit Lehrer Spier im Jüdischen Frauenverein
(1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Januar 1935: |
Berichte aus den Generalversammlungen der Vereine
(1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1935: |
"Bunter
Nachmittag" im jüdischen Gasthaus Rose (1935)
 Artikel in der "CV-Zeitung"
(Zeitschrift des Central-Vereins) vom 21. Februar 1935: "Abend
jüdischer Kunst im Schwarzwald. Es ist das Gebiet, das Berthold
Auerbach hervorgebracht hat - Schwarzwaldrand. Es gibt Judendörfer dort.
Und die Leute verstehen sich, sie freuen sich der reizvollen Natur, sie
sprechen das geruhsame Platt, das dahinplätschert, wie der Neckar, der
friedsam und ohne Eile gen Osten hinplaudert. Artikel in der "CV-Zeitung"
(Zeitschrift des Central-Vereins) vom 21. Februar 1935: "Abend
jüdischer Kunst im Schwarzwald. Es ist das Gebiet, das Berthold
Auerbach hervorgebracht hat - Schwarzwaldrand. Es gibt Judendörfer dort.
Und die Leute verstehen sich, sie freuen sich der reizvollen Natur, sie
sprechen das geruhsame Platt, das dahinplätschert, wie der Neckar, der
friedsam und ohne Eile gen Osten hinplaudert.
Hier geschieht etwas für die Juden, die seit Monaten nur von Sorgen und
Diskussionen hören, sie sollen auch einmal aufgelockert werden. Eine
wohlmeinende, rührige Leitung hat die Juden der kleinen
Schwarzwaldstädte und Dörfer zusammengerufen.
Das ist eine Tat, die die Großstadt nicht so leicht begreift. Schon den
zentralen Ort zu finden, kostet Mühe und Überlegung. Man fand ihn in Haigerloch!
Nun suchen die Berliner und die anderen Großstädter mit etwas
überlegenem Gesichtsausdruck das ihnen unbekannte 'Nest' auf der Karte,
finden es vielleicht an der Bahnstrecke, die von Stuttgart nach der
Schweiz leitet und auch da noch mit dem vielbewitzelten Kleinbähnlein
abseitig zu erreichen ist. - Aber, wie liegt das Bergnest? Auf einem
phantastischen Hügel, den nur künstlerischer Bausinn gewählt haben
kann, jedes Haus schaut woanders hinab in die Talwindung.
Auf der höchsten Rückenwölbung des Hügels ruht ein jüdisches
Gasthaus, drum herum viel Häuser von fleißigen Leuten. Es ist ein
Wintersonntag, die Sonne hilft mit. Sie illuminiert das Tal, sie blitzt
aus dem Flüßlein herauf und funkelt schalkhaft in die Beschaueraugen
hinein.
Mittags nach der Kaffeezeit sollen die Leute Unterhaltung haben und es
sind aus Stuttgart und weiter her Kräfte gekommen, die den Geplagten mal
was anderes geben mögen, als Tagesgedanken und Zukunftsschatten. Und ..
trotzdem es zunächst etwas kalt in dem Saal ist, der auf dem Felsen hockt
und um den herum es windet aus allen Richtungen, wird allmählich Stimmung
und Temperatur erhöht. Ein geschickter Kabarettist packt die Laune mit
kecker Geste des Wortes und der Mimik. Er ist kein Süddeutscher, er ist
Österreicher, also viel wendiger, als wir schwerfälligen Menschen
...
Er heizt das Stimmungsöfele mit Witzchen und dann soll die Kohle kommen,
die schwerer brandelt.
Er kriegt seine Aufgabe fertig. Was literarisch aussieht, jagt den Leuten
ein bisschen Furcht ein, Musik mundet schon williger, aber gutwillig ist
die Saalwelle schließlich und Stimmung stellt sich ein. Was beabsichtigt
ist, vollzieht sich, die enge Tagesfalte glättet sich und die Stirnen
werden entrunzelt, nette Frauen lassen sich von dem Conferencier ein paar
Anzüglichkeiten ohne Groll in die Ohren plauschen und nehmen dann sogar
den literarischen Mann an, der im Heimatdialekt jetzt Geschichten
erzählt! - Die familiäre Kontaktbindung ist da und die 200 Weiblein und
Männer helfen als Resonanzgeber dem 'bunten Nachmittag' zu einem runden
Abschluss.
Dann ist die Nacht über dem Bergdorf, und die Künstler wollen heim. Ein
Autobesitzer nimmt sie gastlich auf. Zu fünf werden wir in das Wägele
verfrachtet und dann zottelt der Wagen bergab ins Tal. Erst versagt die
Zündung, dann will sie schließlich doch und wir klettern am Kreuzweg
nach Nordstetten hinauf, am Geburtshaus Berthold Auerbachs vorbei,
bergab ins Neckartal an die Schienenverbindung Berlin-Zürich, und wir
dampfen nach kultureller Arbeit ein Stücklein der Riesenstadt zu -
bleiben aber in Stuttgart, das vorerst 'nur' Großstadt ist, noch hangen.
Es ist immer eine Freude, so von oben her in Stuttgart anzulangen. Nachts
funkelt aus dem Bassin der Stadt herauf ein lustiges Lichterensemble,
manchmal schnurgerade gerichtet, dann wieder kreuz und quer.
Es gehört zur Beschaulichkeit des hier geborenen Gemüts, sich immer
wieder an dem ganz simplen Lichttheater freuen zu können. Und heute
bringt man die Nachstimmung mit hierher, dass man einigen hundert
zugehörigen Menschen ein bisschen Freude brachte... Alfred
Auerbach." |
Vortragsveranstaltung mit Julius Paul Eppstein aus Stuttgart - Gründung eines
Kulturbundes der jüdischen Gemeinden der Umgebung
(1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. März 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. März 1935: |
Neuwahlen zum Israelitischen Vorsteheramt - Vortragsveranstaltung zum Maimonides-Jubiläum
(1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1935: |
Kulturveranstaltung für die Schwarzwaldgemeinden in der "Rose" in
Haigerloch (1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1935:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1935: |
Vortrag von Dr. Ludwig Landau (1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. August 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. August 1935: |
Dr. Paul Tänzer referiert über den Zionistenkongress - Lehrer Spier über den
Zionismus - Anfängerkurs in Neuhebräisch - Organisation der Jüdischen
Winterhilfe (1935)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1935: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1935: |
Chanukkafeier im Dezember 1935 (1936)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1936: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1936: |
Konzertveranstaltung der "Jüdischen Kulturgemeinde Schwarzwald"
(1936)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1936: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Februar 1936: |
Kulturelle Veranstaltungen
im Frühjahr 1936 (1936)
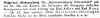 Artikel
in der "Jüdischen Rundschau" vom 23. Juni 1936:
"Haigerloch (Hohenzollern). Die 'Kultusvereinigung Schwarzwald' gab
am 10. Mai ein Konzert des Orchesters der Stuttgarter jüdischen
Kunstgemeinschaft unter Leitung von Karl Adler und Karl Haas. - Am 14.
Juni rezitierte Edith Herrnstadt - Oettingen Gedichte, Stücke aus der
Bibel, ostjüdische Novellen u.a.m." Artikel
in der "Jüdischen Rundschau" vom 23. Juni 1936:
"Haigerloch (Hohenzollern). Die 'Kultusvereinigung Schwarzwald' gab
am 10. Mai ein Konzert des Orchesters der Stuttgarter jüdischen
Kunstgemeinschaft unter Leitung von Karl Adler und Karl Haas. - Am 14.
Juni rezitierte Edith Herrnstadt - Oettingen Gedichte, Stücke aus der
Bibel, ostjüdische Novellen u.a.m." |
Kulturelle Veranstaltungen in den ersten Monaten 1937
(1937)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. April 1937: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. April 1937: |
Berichte zu einzelnen
Personen
Schwerer
Diebstahl an Josua Hirsch von Haigerloch (1839)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1839 S. 374-375 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1839 S. 374-375 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken |
 |
Mitteilung
betreffs der Verlassenschaft des Jakob Hilb (1844)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 17.Juli 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Haigerloch
[Verlassenschaft des Jakob Hilb von hier]. Zur Herstellung des
Aktivstandes in der obbemerkten Teilungsangelegenheit werden alle Jene,
welche noch an Hilb etwas schulden, ersucht, dies in tunlichster
Bälde hier anzuzeigen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 17.Juli 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Haigerloch
[Verlassenschaft des Jakob Hilb von hier]. Zur Herstellung des
Aktivstandes in der obbemerkten Teilungsangelegenheit werden alle Jene,
welche noch an Hilb etwas schulden, ersucht, dies in tunlichster
Bälde hier anzuzeigen.
Haigerloch, den 12. Juli 1844. Fürstliches Oberamt.
Haigerloch. [Aufforderung]. Zur Vereinigung des Verlassenschaft des
ledigen Israeliten Jakob Hilb von hier, werden seine etwaigen
Gläubiger aufgefordert, sich inner 20 Tagen a dato hier zu melden,
widrigenfalls ohne ihre Berücksichtigung über den, aus einigen Mobilien
bestehenden Nachlass anderweitig verfügt wird.
Haigerloch, den 6. Juli 1844.
Fürstliches Oberamt. v. Sellwürk." |
Josua
Hirsch von Haigerloch wurde Opfer eines Diebstahles in Donaueschingen (1844)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 21. August 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Donaueschingen. [Diebstahl]. An Johanni vorigen Jahres wurden
dem Josua Hirsch von Haigerloch in Donaueschingen aus zwei Kosten,
welche im hiesigen Adlerwirtshause standen, nachfolgende Gegenstände
entwendet: Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 21. August 1844 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Donaueschingen. [Diebstahl]. An Johanni vorigen Jahres wurden
dem Josua Hirsch von Haigerloch in Donaueschingen aus zwei Kosten,
welche im hiesigen Adlerwirtshause standen, nachfolgende Gegenstände
entwendet:
1) Ein Schlafrock von baumwollenem Merino im Werte von 3 fl.
2) Fünf Reste Sommerzeug von Baumwolle, im Wert von 20
fl.
3) Blauer Futterbarchent, im Wert von 2 fl.
4) Ein Stück breiter dicker Gesundheitsflanell um Wert von 10
fl.
Wir bringen diesen Diebstahl Behufs der Fahndung auf den Täten und die
entwendeten Gegenstände hiermit zur öffentlichen Kenntnis.
Donaueschingen, den 8. August 1844. Großherzoglich badisches f.f. Bezirksamt".
|
Julius Ullmann erhält
im Krieg 1871 das Eiserne Kreuz (1871)
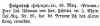 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. April 1871:
"Haigerloch (Hohenzollern), 30. März 1871: "Herr Julius Ullmann
von hier, Füselier im 3. Rheinischen Infanterie-Regiment Nr. 29, hat bei
Peronne sich das eiserne Kreuz erworben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. April 1871:
"Haigerloch (Hohenzollern), 30. März 1871: "Herr Julius Ullmann
von hier, Füselier im 3. Rheinischen Infanterie-Regiment Nr. 29, hat bei
Peronne sich das eiserne Kreuz erworben." |
Nachruf zum Tod von Oberamtmann Emele (1893)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. April 1893: "Haigerloch
(Hohenzollern), am 17. März (1893). Heute ist hier ein Mann zu Grabe
getragen worden, der, obwohl einem anderen Glauben angehörig, dennoch
auch in diesen Blättern einen ehrenden Nachruf verdient. Es ist dies der
Herr Oberamtmann Emele, der ca. vierzig Jahre lang an der Spitze des
diesseitigen Kreises gestanden und während dieser ganzen Zeit nicht nur für
die Kreisinsassen im Allgemeinen, sondern auch und ganz besonders für die
in seinem Ressort unterstellten jüdischen Gemeinden segensreich gewirkt
hat. Wie vielleicht kein zweiter hat er in glücklichster Übereinstimmung
die Tugenden des Vorgesetzten, wie die des Menschenfreundes in sich
vereinigt. Was speziell die jüdischen Angelegenheiten betrifft, so hat er
denselben stets das lebhafteste und wärmste Interesse gewidmet. Gerecht
und unparteiisch hat er unsere Sachen behandelt, aber auch mit zarter Rücksicht
und Schonung, mit besonderer Liebe sie geleitet. Er hat das Recht jedes
Einzelnen, wie das der Gesamtheit trefflich zu wahren und
Meinungsdifferenzen glücklich zu lösen verstanden, Meinungsdifferenzen,
die nicht selten den Frieden unserer Gemeinden bedrohten. Er war uns nicht
nur der pflichttreue Vorgesetzte, sondern viel mehr: ein liebevoller
Vater, ein väterlicher Freund, der zu jeder Zeit mit Rat und Tat, sowohl
innerhalb der Grenzen der amtlichen Pflichten als auch außerhalb
derselben uns zur Seite stand. Ja noch mehr: Obwohl nicht unseres
Glaubens, hat er dennoch auch unsere religiösen Interessen so zu fördern
sich bemüht, als wären sie seine eigenen. Nur auf sein liebevolles
Zureden und kraftvolles Mahnen hat die Gemeinde, die nach dem Abgange des
vorigen Rabbiners, in Nachahmung unserer fast ebenso großen
Nachbargemeinde Hechingen, den Rabbinatsposten unbesetzt lassen wollte,
diese ihre Absicht aufgegeben und von neuem einen Rabbiner angestellt. Ein
solches Verhalten des Oberhauptes des Kreises gegen die Bewohner desselben
und insbesondere gegen unsere Glaubensgenossen konnte nicht verfehlen in
rechter Weise auf die Gemüter derselben zu wirken und Liebe und Achtung
einzutragen. Und in der Tat wird wohl selten jemand sich die Herzen in so
hohem Grade gewonnen haben, wie der Verblichene sie besessen hat. Ganz
besonders aber hing ihm unsere Gemeinde mit ganzer Seele und in voller
Verehrung an, eine Verehrung, die sich auch heute bei seinem Leichenbegängnisse
kundgab, zu dem Alles, ja Alles, auch aus der Ferne, wohin viele des Geschäftes
wegen sich begeben hatten, herbeieilte. Und so möge er in Frieden ruhen
und im Jenseits die Früchte seiner schönen Taten genießen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. April 1893: "Haigerloch
(Hohenzollern), am 17. März (1893). Heute ist hier ein Mann zu Grabe
getragen worden, der, obwohl einem anderen Glauben angehörig, dennoch
auch in diesen Blättern einen ehrenden Nachruf verdient. Es ist dies der
Herr Oberamtmann Emele, der ca. vierzig Jahre lang an der Spitze des
diesseitigen Kreises gestanden und während dieser ganzen Zeit nicht nur für
die Kreisinsassen im Allgemeinen, sondern auch und ganz besonders für die
in seinem Ressort unterstellten jüdischen Gemeinden segensreich gewirkt
hat. Wie vielleicht kein zweiter hat er in glücklichster Übereinstimmung
die Tugenden des Vorgesetzten, wie die des Menschenfreundes in sich
vereinigt. Was speziell die jüdischen Angelegenheiten betrifft, so hat er
denselben stets das lebhafteste und wärmste Interesse gewidmet. Gerecht
und unparteiisch hat er unsere Sachen behandelt, aber auch mit zarter Rücksicht
und Schonung, mit besonderer Liebe sie geleitet. Er hat das Recht jedes
Einzelnen, wie das der Gesamtheit trefflich zu wahren und
Meinungsdifferenzen glücklich zu lösen verstanden, Meinungsdifferenzen,
die nicht selten den Frieden unserer Gemeinden bedrohten. Er war uns nicht
nur der pflichttreue Vorgesetzte, sondern viel mehr: ein liebevoller
Vater, ein väterlicher Freund, der zu jeder Zeit mit Rat und Tat, sowohl
innerhalb der Grenzen der amtlichen Pflichten als auch außerhalb
derselben uns zur Seite stand. Ja noch mehr: Obwohl nicht unseres
Glaubens, hat er dennoch auch unsere religiösen Interessen so zu fördern
sich bemüht, als wären sie seine eigenen. Nur auf sein liebevolles
Zureden und kraftvolles Mahnen hat die Gemeinde, die nach dem Abgange des
vorigen Rabbiners, in Nachahmung unserer fast ebenso großen
Nachbargemeinde Hechingen, den Rabbinatsposten unbesetzt lassen wollte,
diese ihre Absicht aufgegeben und von neuem einen Rabbiner angestellt. Ein
solches Verhalten des Oberhauptes des Kreises gegen die Bewohner desselben
und insbesondere gegen unsere Glaubensgenossen konnte nicht verfehlen in
rechter Weise auf die Gemüter derselben zu wirken und Liebe und Achtung
einzutragen. Und in der Tat wird wohl selten jemand sich die Herzen in so
hohem Grade gewonnen haben, wie der Verblichene sie besessen hat. Ganz
besonders aber hing ihm unsere Gemeinde mit ganzer Seele und in voller
Verehrung an, eine Verehrung, die sich auch heute bei seinem Leichenbegängnisse
kundgab, zu dem Alles, ja Alles, auch aus der Ferne, wohin viele des Geschäftes
wegen sich begeben hatten, herbeieilte. Und so möge er in Frieden ruhen
und im Jenseits die Früchte seiner schönen Taten genießen." |
Zum Tod von Therese Levy (1900)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juli 1900:
"Haigerloch, 28. Juni. Am 24. vorigen Monats haben wir eine
Frau zu Grabe getragen, die es wohl verdient, auch in Ihrem geschätzten
Blatte gedacht zu werden. Frau Therese Levy, Gattin des Herrn Seligmann
Levy, war eine Esches Chail (= wackere Frau), ein biederes, edles Weib.
Die Verblichene hat durch die Frömmigkeit ihres Wirkens sich so
wohltätig und nützlich unter ihren Mitmenschen gemacht, dass wir es
fühlen und uns klar bewusst sind, dass es ein allgemeiner Verlust ist,
den wir durch ihren Tod erlitten haben. Sie vereinigte in sich die
Tugenden des häuslichen Lebens, Einfachheit, Bescheidenheit und
Anspruchslosigkeit. Aufopfernd und hingebend war sie den Armen, im Stillen
übte sie viel Zedokoh (Wohltätigkeit). Nach kurzem Krankenlager,
sanft und still, wie sie gelebt, haucht sie ihre Seele aus im Alter von 71
Jahren und nach 47jährigem Eheleben. Als beim M'thar das Sargenes
(Sterbekleid, Totengewand) herbeigeholt wurde, fand man in demselben 390
Mark mit einer eigenhändig geschriebenen Bestimmung vor, dass dieselben
nach ihrem Ableben gleich verteilt werden sollen. Herr Lehrer Speyer
widmete der Entschlafenen tief zu Herzen gehende Worte, die ein lebhaftes
Echo bei der großen aus allen Konfessionen von Nah und Fern
herbeigeeilten Trauerversammlung gefunden haben."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juli 1900:
"Haigerloch, 28. Juni. Am 24. vorigen Monats haben wir eine
Frau zu Grabe getragen, die es wohl verdient, auch in Ihrem geschätzten
Blatte gedacht zu werden. Frau Therese Levy, Gattin des Herrn Seligmann
Levy, war eine Esches Chail (= wackere Frau), ein biederes, edles Weib.
Die Verblichene hat durch die Frömmigkeit ihres Wirkens sich so
wohltätig und nützlich unter ihren Mitmenschen gemacht, dass wir es
fühlen und uns klar bewusst sind, dass es ein allgemeiner Verlust ist,
den wir durch ihren Tod erlitten haben. Sie vereinigte in sich die
Tugenden des häuslichen Lebens, Einfachheit, Bescheidenheit und
Anspruchslosigkeit. Aufopfernd und hingebend war sie den Armen, im Stillen
übte sie viel Zedokoh (Wohltätigkeit). Nach kurzem Krankenlager,
sanft und still, wie sie gelebt, haucht sie ihre Seele aus im Alter von 71
Jahren und nach 47jährigem Eheleben. Als beim M'thar das Sargenes
(Sterbekleid, Totengewand) herbeigeholt wurde, fand man in demselben 390
Mark mit einer eigenhändig geschriebenen Bestimmung vor, dass dieselben
nach ihrem Ableben gleich verteilt werden sollen. Herr Lehrer Speyer
widmete der Entschlafenen tief zu Herzen gehende Worte, die ein lebhaftes
Echo bei der großen aus allen Konfessionen von Nah und Fern
herbeigeeilten Trauerversammlung gefunden haben." |
Zum 80.
Geburtstag von Stadtrat David Levi (1900)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juli 1900: "Haigerloch,
4. Juli (1900). Am ersten Tage Rosch chaudesch Tamus (= 28. Juni 1900)
beging Herr Stadtrat David Levi in bester Lebensfrische seinen 80.
Geburtstag. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juli 1900: "Haigerloch,
4. Juli (1900). Am ersten Tage Rosch chaudesch Tamus (= 28. Juni 1900)
beging Herr Stadtrat David Levi in bester Lebensfrische seinen 80.
Geburtstag.
Aus diesem Anlass begaben sch mittags 11 Uhr die Herren Stadträte, mit
dem Herrn Bürgermeister an der Spitze, in die Wohnung ihres Herrn
Kollegen, um ihm ihre Glückwünsche darzubringen. Abends waren diese
Herren, sowie viele Freunde des Jubilars, im 'Fürst Joseph' zu einer
gemeinsamen, gemütlich verlaufenen Feier versammelt. Herr David Levi
gehört schon seit 33 Jahren ununterbrochen dem Stadtkollegium an, ein
Beweis, dass er sich infolge seines biederen Charakters des allgemeinen
Vertrauens seitens der hiesigen Bürgerschaft zu erfreuen hat. Herr
Stadtbürgermeister Münzer hielt Abends eine schöne Festrede, worauf der
Jubilar tief gerührt dankte. Auch in unserer Gemeinde fungiert Herr Levi
schon über 40 Jahre als Bal thefile (Vorbeter) an den hohen Festtagen.
Möge derselbe noch lange Jahre uns erhalten bleiben." |
Zum Tod von Klara Levi (1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1927: "Haigerloch
(Hohenzollern), 1. Juli. Am Dienstag, den 21. Juni, den 21. Siwan wurde
hier unter zahlreicher Beteiligung aller Kreise und Konfessionen unserer
Stadt und der Umgebung eine der Besten unserer Gemeinde zu Grabe getragen,
Frau Klara Levi. Im 50. Lebensjahre hat der Herr der Welt sie abberufen in
jene andere Welt. Die Beteiligung schon zeigte die allgemeine
Wertschätzung und Verehrung, die die Entschlafene bei ihren Mitbürgern
und Bekannten genossen hat. Sie hat sich diese Zuneigung voll und ganz
verdient. In Tagen des Wohlstandes bescheiden und hilfsbereit, in Tagen
der Not geduldig und ergeben - so konnte sie vielen ein Beispiel sein.
Dabei war sie eine wohltätige Frau im wahrsten Sinne des Wortes,
und kurz vor ihrem Tode hat sie noch ihren Kindern das Versprechen abgenommen,
auch nach ihrem Tode in gleicher Weise Wohltätigkeit weiter zu üben und
vor allem nie einen Armen hungrig aus dem Hause gehen zu lassen. Am
stärksten zeigte sich ihre Glaubenstreue aber im Leiden. Seit
Jahren war sie von schwerster Krankheit geplagt. Ihre oft
übermenschlichen Qualen ertrug sie ohne Murren und Klagen im Aufblick zu
Gott, dem sie voll vertraute. Der Tod war ihr Erlöser von schwerstem
Leid. Möge ihr Beispiel weiter wirken. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1927: "Haigerloch
(Hohenzollern), 1. Juli. Am Dienstag, den 21. Juni, den 21. Siwan wurde
hier unter zahlreicher Beteiligung aller Kreise und Konfessionen unserer
Stadt und der Umgebung eine der Besten unserer Gemeinde zu Grabe getragen,
Frau Klara Levi. Im 50. Lebensjahre hat der Herr der Welt sie abberufen in
jene andere Welt. Die Beteiligung schon zeigte die allgemeine
Wertschätzung und Verehrung, die die Entschlafene bei ihren Mitbürgern
und Bekannten genossen hat. Sie hat sich diese Zuneigung voll und ganz
verdient. In Tagen des Wohlstandes bescheiden und hilfsbereit, in Tagen
der Not geduldig und ergeben - so konnte sie vielen ein Beispiel sein.
Dabei war sie eine wohltätige Frau im wahrsten Sinne des Wortes,
und kurz vor ihrem Tode hat sie noch ihren Kindern das Versprechen abgenommen,
auch nach ihrem Tode in gleicher Weise Wohltätigkeit weiter zu üben und
vor allem nie einen Armen hungrig aus dem Hause gehen zu lassen. Am
stärksten zeigte sich ihre Glaubenstreue aber im Leiden. Seit
Jahren war sie von schwerster Krankheit geplagt. Ihre oft
übermenschlichen Qualen ertrug sie ohne Murren und Klagen im Aufblick zu
Gott, dem sie voll vertraute. Der Tod war ihr Erlöser von schwerstem
Leid. Möge ihr Beispiel weiter wirken. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." |
Zum
80. Geburtstag von Salomon Hilb in Ulm, Sohn von Rabbiner Maier Hilb in
Haigerloch (1928)
 Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 28. September
1928: "Ulm, 80. Geburtstag. Salomon
Hilb, ein hoch geachtetes Mitglied unserer Gemeinde, Teilhaber der
Großfirma L. Hilb & Cie., konnte am 24. September in körperlicher
und geistiger Frische seinen 80. Geburtstag begehen. Der große Bekannten-
und Freundeskreis aus sämtlichen Schichten der hiesigen Bevölkerung
ließ es sich nicht nehmen, Gratulationen und Glückwünsche durch
herzliche Worte und schöne Angebinde zum Ausdruck zu bringen. Der Oberrat
der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs ließ durch
Rabbiner Dr. Cohn ein Glückwunschschreiben überreichen, worin
insbesondere die Verdienste des Achtzigjährigen um Familie und Gemeinde
hervorgehoben werden. Salomon Hilb wurde als Sohn eines Rabbiners in
Haigerloch (Hohenzollern) geboren. Seit 1866 ist er in
Ulm." Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 28. September
1928: "Ulm, 80. Geburtstag. Salomon
Hilb, ein hoch geachtetes Mitglied unserer Gemeinde, Teilhaber der
Großfirma L. Hilb & Cie., konnte am 24. September in körperlicher
und geistiger Frische seinen 80. Geburtstag begehen. Der große Bekannten-
und Freundeskreis aus sämtlichen Schichten der hiesigen Bevölkerung
ließ es sich nicht nehmen, Gratulationen und Glückwünsche durch
herzliche Worte und schöne Angebinde zum Ausdruck zu bringen. Der Oberrat
der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs ließ durch
Rabbiner Dr. Cohn ein Glückwunschschreiben überreichen, worin
insbesondere die Verdienste des Achtzigjährigen um Familie und Gemeinde
hervorgehoben werden. Salomon Hilb wurde als Sohn eines Rabbiners in
Haigerloch (Hohenzollern) geboren. Seit 1866 ist er in
Ulm." |
Zum Tod von Veit Hilb (1929)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1929: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1929: |
Zum Tod des früheren Gemeindevorstehers Moritz Levi
(1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1930: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juli 1930: |
Zum Tod von Bertha Ullmann geb. Adler
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar
1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar
1931: |
Zum Tod von Eugen Nördlinger (geb. in Laupheim gest. in Haigerloch
1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1931:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März
1931: |
Zum Tod von Wolf Reutlinger I (1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1931: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1931: |
70. Geburtstag von Abraham Hilb
(1931)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1931:
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. Juni 1931: |
Zum Tod von Ernestine Levi geb. Levi sowie ihrer Tochter Babette Wolf Levi
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juni
1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juni
1932: |
Zum Tod von Benno Kappenmacher
(1932)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1932: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 1. November 1932: |
85. Geburtstag von Simon Ullmann - Zum Tod von Klärle Ullmann
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 18. Januar
1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 18. Januar
1933: |
Dokument
zur Goldenen Hochzeit von Wolf Reutlinger und seiner Frau Henriette (Juli 1933)
(Quellen: Foto von Paul Weber in: Karl Werner Stein: Juden in
Haigerloch. Haigerloch 1987 S. 60;
Gratulationskarte: aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries)
 |
 |
 |
|
Text der Gratulationskarte zur Goldenen
Hochzeit von E. Picard aus Paris (abgestempelt 7. Juli 1933):
"Meine Lieben, zu Eurem goldenen Ehejubiläum sollen auch meine
Glückwünsche nicht fehlen. Ich gratulieren Euch allen zu diesem
freudigen Ereignis recht herzlich und wünsche Euch nur bessere Zeiten bis
zur 'Diamantenen'. Ich weiß nicht, ob meine Eltern bei Euch sind, in Gedanken
sind sie es jedenfalls. Ich hoffe, dass es Euch gesundheitlich
zufriedenstellend geht, was bei mir auch der Fall ist. Ich hätte zwar
vieles von hier zu erzählen, doch das könnte Ihr in einem Baedeker auch
lesen. Ich habe die feste Hoffnung, dass ich mich hier durchsetzen werde,
wenn es auch lange dauern und schwierig sein wird. Einstweilen gibt es nur
eines - französisch lernen. Das ist hier nicht so leicht, wie man meint.
Deutsch lernen ist schon leichter in Paris. - Die Goethestraße liebe
Tante ist durch die Champs Elysees geschlagen. Ich empfehle Dir also,
Deine nächste Reise hierher zu machen. Feiert recht vergnügt beisammen
und seid alle (inklusive der gesamten Mischpoche) herzlich begrüßt von
Euren Neffen und Vetter).
An: Familie Wolf Reutlinger, alt Oberstadt,
Haigerloch/Hohenzollern Allemagne". |
|
Anmerkung: Henriette Reutlinger geb.
Levi (geb. 1857 in Haigerloch) ist am 16. Dezember 1935 in Haigerloch
gestorben; Wolf Reutlinger (geb. 1856 in Haigerloch) ist am 18. April 1941
in Haigerloch gestorben. |
| |
|
|
Postkarte
an Familie Josef Hirsch
in Haigerloch von E. Picard (1939)
(aus der Sammlung von
Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |
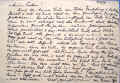 |
| |
Auf der
abgebildeten Karte schreibt E. Picard aus Paris (wie oben) an die
Familie Josef Hirsch bezüglich "Kätes Verlobung und baldiger
Heirat" seine Glückwünsche.
Käthe war die am 3. Februar 1913 in Haigerloch geborene Tochter von Josef
Hirsch (1877-?) und seiner Frau Mina geb. Katz (1884-?). Käthe ist 1937
in die USA ausgewandert (nach Bloomington, Ill) und war später eine
verheiratete Strassburger; ihre Geschwister und die
Eltern folgten ihr bis 1940. Käthe (Kate) Strassburger geb. Hirsch starb
im Januar 1991. |
| |
Ergänzend: ein
von Helmut Gabeli (Haigerloch) erstelltes Familienblatt
zur Familie Josef Hirsch |
Zum Tod von Berta Guttmann aus Hechingen (geb. und gest. in Haigerloch 1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 8. November 1933: "Haigerloch. Am Vorabend des
Schmini-Azereth starb im hiesigen Krankenhause die von hier gebürtige Frau
Berta Guttmann, Gattin des Kultusbeamten Guttmann in Hechingen. Sie wurde wunschgemäß auf dem hiesigen Friedhof beigesetzt. Nach einem Gebete des
Rabbinatsverwesers Spier, sprach Rabbinatsverweser Schmalzbach,
Hechingen herzliche Worte der Teilnahme und des Trostes. Die Beteiligung an dem
Leichenbegängnis zeugte für die große Beliebtheit der Verstorbenen." Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 8. November 1933: "Haigerloch. Am Vorabend des
Schmini-Azereth starb im hiesigen Krankenhause die von hier gebürtige Frau
Berta Guttmann, Gattin des Kultusbeamten Guttmann in Hechingen. Sie wurde wunschgemäß auf dem hiesigen Friedhof beigesetzt. Nach einem Gebete des
Rabbinatsverwesers Spier, sprach Rabbinatsverweser Schmalzbach,
Hechingen herzliche Worte der Teilnahme und des Trostes. Die Beteiligung an dem
Leichenbegängnis zeugte für die große Beliebtheit der Verstorbenen." |
85. Geburtstag von Heinrich Hilb
(1933)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 8. November 1933: Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs"
vom 8. November 1933: |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe,
Privatpersonen
sowie der Gemeinde
Matzenbäckerei zu verkaufen (1882)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1882: "Aus
Gesundheitsrücksichten meiner Frau, sehe ich mich genötigt, meine bisher
mit bestem Erfolg betriebene Matzen-Bäckerei zu verkaufen.
Dieselbe kann, da auch früher die Brotbäckerei damit betrieben wurde,
mit der ganzen Einrichtung samt Wohnung erworben werden. Es wäre hier
einem strebsamen, jungen, israelitischen Bäcker Gelegenheit geboten, sich
einen guten Erwerbszweig zu gründen. Auch würde ich die Matzen-Maschine
allein verkaufen. S. Heilbronner, in Haigerloch (Hohenzollern)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1882: "Aus
Gesundheitsrücksichten meiner Frau, sehe ich mich genötigt, meine bisher
mit bestem Erfolg betriebene Matzen-Bäckerei zu verkaufen.
Dieselbe kann, da auch früher die Brotbäckerei damit betrieben wurde,
mit der ganzen Einrichtung samt Wohnung erworben werden. Es wäre hier
einem strebsamen, jungen, israelitischen Bäcker Gelegenheit geboten, sich
einen guten Erwerbszweig zu gründen. Auch würde ich die Matzen-Maschine
allein verkaufen. S. Heilbronner, in Haigerloch (Hohenzollern)." |
Bäckerei zu verkaufen (1892)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1892: "Für
Bäcker.
Eine Bäckerei ist hier billig zu kaufen oder zu pachten. Ein tüchtiger,
zuverlässiger jüdischer Bäcker würde, da ein solcher hier fehlt,
voraussichtlich ein gutes Geschäft hier machen. Das israelitische
Vorsteheramt zu Haigerloch." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1892: "Für
Bäcker.
Eine Bäckerei ist hier billig zu kaufen oder zu pachten. Ein tüchtiger,
zuverlässiger jüdischer Bäcker würde, da ein solcher hier fehlt,
voraussichtlich ein gutes Geschäft hier machen. Das israelitische
Vorsteheramt zu Haigerloch." |
Nach
der Deportation / Emigration: Todesanzeige für Wolf Jacob Levi und Jakob Maier
Levi (beide umgekommen im Ghetto Theresienstadt 1944)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 10. März 1944: Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 10. März 1944:
"Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser geliebter Vater,
Schwiegervater, Großvater und Onkel
Wolf Jacob Levi (früher Haigerloch, Hohenzollern)
in Theresienstadt verschieden ist.
Jakob und Rosa Levi und Sohn David. 815 W. 180th Str., Apt. 7
Max und Marta Levi 36 Ellwood Street, Apt. 6a, New York
City.
---
Gleichzeitig erhielten wir die traurige Kunde vom Hinscheiden meines
lieben Mannes, Vaters und Bruders
Jakob Maier Levi (früher Haigerloch)
ebenfalls in Theresienstadt.
Im Namen der Hinterbliebenen:
Erna und Victor Cahn. 312 Adam Street Monroe,
La." |
Weitere Dokumente
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)
Eintrag
in ein Poesie-Album in Oberdorf
von S. Hohenemser aus Haigerloch (1888) |
 |
|
"Jedem
Blättchen..., jedem Vöglein..., jeder Welle.... sag ich's, dass mein
Herz Dir ewig lebt.
Dies zur freundlichen Erinnerung von Ihrem Freund S.
Hohenemser aus Haigerloch Hohenzollern. Oberdorf
1. Nov. 1888". Bei S. Hohenemser handelt es sich (nach
Angaben von Helmut Gabeli vom 10.10.2011) um den 1869 in Haigerloch geborenen
Sigmund Hohenemser. Dieser war später als Kaufmann tätig und
heiratete 1906 in Laupheim Mathilde geb. Einstein (gest. 1923 in
Haigerloch; zwei Söhne: Jakob, geb. 1911 in Haigerloch, studierte
1928-31 am Israelitischen Lehrerseminar in Würzburg, war bis 1938 Kantor
an der Hauptsynagoge in München, 1939 in die USA emigriert, wo er bis zu
seinem Tod 1964 als Kantor wirkte; Manfred, geb. 1913 in
Haigerloch, 1937 in die USA emigriert); Sigmund Hohenemser wurde 1942 im Vernichtungslager
Treblinka ermordet .
|
| |
|
|
Von
Haigerloch nach Genf
verschickte Postkarte (1899) |
 |
 |
|
Die Karte datiert
vom 4. Juni 1899 (Poststempel) und wurde an Arthur Levi in Genf
verschickt; Absender war sein Bruder Siegfried Levi in Haigerloch. Es
grüßen ihn noch Wolf Levi, ein "Salli" sowie ein Siegfried
Katz.
|
| |
|
|
Von
Moses Schwab in Haigerloch
nach Rangendingen verschickte
Postkarte (1917) |
 |
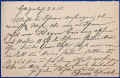 |
|
Die obige Postkarte wurde von Moses Schwab
von Haigerloch am 3. Februar 1917 nach Rangendingen verschickt. Zum
Absender: Moses Schwab (geb. 18. Oktober 1854, gest. 28. Februar
1927 und beigesetzt auf dem jüdischen Friedhof in Haigerloch, auf dem auch sein Vater
Hirsch Schwab, geb. 4. Juni 1806, gest. 24. Mai 1892 und seine
Mutter Auguste geb. Schwab bereits ihre letzte Ruhe fanden) war in erster
Ehe verheiratet mit Dorothea geb. Weil (geb. 27. Januar 1860, gest.
8. Juni 1899 in Tübingen). Das Paar hatte fünf Kinder, davon vier Söhne
(Louis, 1886; Ernst, 1887; Wilhelm, 1890; Hermann, 1895) und eine Tochter
(Bella, 1898; war verheiratet mit Karl Julius Hahn aus Karlsruhe;
am 27. November 1941 wurde sie von Haigerloch über Stuttgart nach Riga deportiert, wo
sie am 26. März 1942 erschossen wurde). Moses Schwab heiratete in zweiter
Ehe Amalia geb. Hirsch (gest. 4. Juni 1928), mit der er eine
Tochter Auguste (geb. 1902) hatte.
Quellen: http://gedenkbuch.informedia.de/index.php/PID/12/name/1466/seite/1/suche/H.html
http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?function=Ins&sel=hgl&inv=0060
Familienregister
Haigerloch Seite zu Familie Moses Schwab |
| |
|
|
Briefumschlag
und Postkarte der
Fa. J. B. Reutlinger (1921/1928)
|
 |
 |
| |
Der Brief wurde
von J. B. Reutlinger in
Haigerloch (Ölimport - Farben - Lacke -
Dachpappen und chemisch-technische
Produkte) am 1. April 1921 an das
Amtsgericht in Konstanz geschickt. |
Die Karte wurde 1928 von der
Firma
J.B. Reutlinger an die Lederleimfabrik
J. Straub in Bopfingen geschickt. |
| |
| |
|
|
Brief
der Firma Eugen Nördlinger
(1929) |
 |
|
Der Brief der Fa.
Eugen Nördlinger in Haigerloch (Öle, Fette, chem. Produkte, Dachpappe,
Wagen- und Pferdedecken) wurde am 20. Januar 1929 an die Leimfabrik J.
Straub in Bopfingen geschickt.
|
| |
|
|
|
|
|
|