|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Graben (Gemeinde Graben-Neudorf,
Kreis Karlsruhe)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zu Baden-Durlach
gehörenden Graben bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung
geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Erstmals werden 1732 Juden am Ort
genannt. 1740 lebten in Graben und Liedolsheim
zusammen drei jüdische Familien.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1801 16 jüdische Einwohner, 1825 28 (2,0 % von insgesamt 1.362), 1875 36
(1,8 % von 2.047), 1887 49, 1895 54, 1900 44 (2,1 % von 2.053), 1910 26
(1,2 % von 2.258).
An Einrichtungen hatte die Gemeinde einen Betsaal, in dem auch
den Kindern der Gemeinde der Religionsunterricht erteilt wurde. Ein eigener
Lehrer/Vorbeter/Schochet war noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
angestellt (vgl. Ausschreibungen der Stelle von 1836 bis 1855 siehe unten), später konnte sich die Gemeinde
einen eigenen Lehrer nicht mehr leisten. Seit
spätestens 1889/90 war
Graben Filiale zu Philippsburg -
der dortige Lehrer kam regelmäßig auch nach Graben (siehe Ausschreibung der
Stelle unten). Die Gemeinde gehörte seit
1827 zum Rabbinatsbezirk Karlsruhe, seit 1885 zum Bezirk Bruchsal. Die
Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Obergrombach
beigesetzt.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Hermann Baer (geb.
6.11.1887 in Graben, gef. 19.10.1914). Außerdem ist gefallen:
Sanitätsgefreiter Leo (Lazarus) Weil (geb. 30.10.1887 in Graben, vor 1914 in
Billigheim wohnhaft, gef. 14.7.1918).
Um 1924, als zur Gemeinde 23 Personen gehörten (0,9 % von insgesamt etwa
2.500 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Isak Weil und Robert Baer. Auch 1932
war Gemeindevorsteher Isak Weil; Robert Baer ist als Schriftführer eingetragen.
Als Lehrer und Kantor kam Moritz Neuburger aus Philippsburg regelmäßig nach
Graben. Hier unterrichtete er auch die 1924 noch drei jüdischen Kinder in
Religion.
Von
wirtschaftlicher Bedeutung unter den in jüdischem Besitz befindlichen Gewerbebetrieben waren bis nach
1933: Likörfabrik und Branntweinbrennerei Baer & Co. (Karlsruher Straße
61), Zigarrenfabrik Isaak Weil (Karlsruhe Straße 26). Es bestand die jüdische Gastwirtschaft
"Zur Sonne" (Rheinstraße 2-4, 1782-1936 in jüdischem Besitz; auf dem Einfahrtsbogen des Gebäudes Initialen
"LG", hebräische Inschrift und die Jahreszahl 1786).
1933 wurden noch 22 jüdische Einwohner gezählt (0,9 % von insgesamt
2.499). Auf Grund der zunehmenden Repressalien und der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts verließen die meisten der jüdischen Einwohner bis
vor Beginn der Deportationen den Ort. Einige konnten nach Argentinien
auswandern. Im Oktober 1940 wurden zwei der letzten
drei jüdischen Einwohner in das KZ Gurs in Südfrankreich deportiert. Die am Ort lebende Julchen Süß
lebte in "Mischehe" und konnte bis zu der auf den 14. Februar 1945
angesetzten Deportation in das Ghetto Theresienstadt in Graben bleiben. Sie starb danach
auf Grund eines gemeinsamen Suizid-Versuches des Ehepaares, den der Ehemann überlebte.
Von den in Graben geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Elka Bravmann geb.
Ettlinger (1892), Helene Gross geb. Neumann (1878), Johanna Held geb. Bär (1889,
"Stolperstein" in Wertheim, Marktplatz
8-10),
Max Held (1879), Sofie Herz geb. Bär
(1852), Karl Hochstetter (1872), Julius Kahn (1880), Erna Krieger geb. Hochstetter
(1900), Heinrich Levi (1870), Clara (Flora, Klara) Müller geb. Willstädter
(1897), Amalie Nachmann geb. Kahn (1892), David Prager
(1887), Johanna Prager geb. Friedmann (1899), Karoline Preis geb. Levi (1877), Julchen
Süss geb. Hochstetter (1904), Julie Weil geb. Rothschild (1884), Jakob
Willstädter (1865), Ludwig Willstädter (1895), Jennie
Windecker geb. Kahn (1881).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers und
Vorsängers (1835 / 1836 / 1847 / 1852 / 1853 / 1855)
 Anzeige
in der "Karlsruher Zeitung" vom 12. Oktober 1835: "Graben
(Dienstantrag). Die israelitische Gemeinde Graben sucht einen Lehrer für
den Religionsunterricht der Jugend. Diejenigen, welche dabei auch noch den
Vorsänger- und Schächterdienst versehen können, werden besonders
berücksichtigt. Man melde sich desfalls bei G. Holtz, israelitischer
Vorsteher." Anzeige
in der "Karlsruher Zeitung" vom 12. Oktober 1835: "Graben
(Dienstantrag). Die israelitische Gemeinde Graben sucht einen Lehrer für
den Religionsunterricht der Jugend. Diejenigen, welche dabei auch noch den
Vorsänger- und Schächterdienst versehen können, werden besonders
berücksichtigt. Man melde sich desfalls bei G. Holtz, israelitischer
Vorsteher." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom Januar 1836 S. 255 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Erledigte Stelle. Bei der
israelitischen Gemeinde Graben ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 44 Gulden nebst freier Kost und Wohnung
sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen
verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom Januar 1836 S. 255 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Erledigte Stelle. Bei der
israelitischen Gemeinde Graben ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 44 Gulden nebst freier Kost und Wohnung
sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen
verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunden und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirks-Synagoge Karlsruhe zu melden.
Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch
Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach erstandener
Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen werden.
Karlsruhe, den 7. Januar 1836.
Großherzogliche Bezirks-Synagoge." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 20. November 1847 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Vakante Schulstellen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 20. November 1847 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Vakante Schulstellen.
[Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde Graben ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Karlsruhe zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 21. Januar 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Vakante Schulstellen. Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 21. Januar 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Vakante Schulstellen. Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.
Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren
Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über
ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst
des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich
zu melden. Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder
Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte
nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 28. Juli 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.
Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren
Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über
ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst
des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich
zu melden. Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder
Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte
nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden."
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 28. Juli 1852 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 50 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.
Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren
Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über
ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst
des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich
zu melden. Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder
Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte
nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 26. Februar 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 26. Februar 1853 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.
Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren
Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über
ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst
des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich
zu melden.
Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder
Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte
nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 24. Februar 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 24. Februar 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, ist zu besetzen.
Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren
Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über
ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst
des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich
zu melden.
Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder
Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte
nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 21. November 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind, und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 21. November 1855 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Die mit einem festen Gehalte von 135 fl. und einem jährlichen
Schulgelde von 48 kr. für jedes die Religionsschule besuchende Kind, und dem Vorsängerdienste samt den davon abhängigen
Gefällen, verbundene Religionsschulstelle bei der israelitischen Gemeinde
Graben, Synagogenbezirks Karlsruhe, ist zu besetzen.
Die berechtigten Bewerber um dieselbe werden daher aufgefordert, mit ihren
Gesuchen, unter Vorlage ihrer Aufnahmeurkunden und der Zeugnisse über
ihren sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen, mittelst
des betreffenden Bezirksrabbinats, bei der Bezirkssynagoge Karlsruhe sich
zu melden.
Bei dem Abgange von Meldungen von Schul- oder
Rabbinatskandidaten, können auch andere inländische befähigte Subjekte
nach erstandener Prüfung bei dem Bezirksrabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden." |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1889 in Philippsburg
- mit Filialdienst in Graben
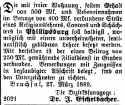 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889:
"Die mit freier Wohnung, festem Gehalt von 500 Mark und
Nebeneinnahmen im Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines
Religionslehrers, Kantors und Schächters in Philippsburg soll baldigst,
womöglich mit einem unverheirateten, seminaristisch gebildeten Lehrer
besetzt werden. Mit derselben ist der einen Beitrag von 250 Mark
gewährende Filialdienst in Graben verbunden. Bewerbungen mit
Zeugnissen in beglaubigter Abschrift belegt, sind an den Unterzeichneten
zu richten. Bruchsal, 27. März 1889. Die Bezirkssynagoge: Dr. J.
Eschelbacher".
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889:
"Die mit freier Wohnung, festem Gehalt von 500 Mark und
Nebeneinnahmen im Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines
Religionslehrers, Kantors und Schächters in Philippsburg soll baldigst,
womöglich mit einem unverheirateten, seminaristisch gebildeten Lehrer
besetzt werden. Mit derselben ist der einen Beitrag von 250 Mark
gewährende Filialdienst in Graben verbunden. Bewerbungen mit
Zeugnissen in beglaubigter Abschrift belegt, sind an den Unterzeichneten
zu richten. Bruchsal, 27. März 1889. Die Bezirkssynagoge: Dr. J.
Eschelbacher". |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Über den Soldaten Heinrich Baer im Feldzug 1870/71
 Artikel
(mit verschiedenen Kriegsberichten) in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" vom 4. Oktober 1895: "Ich stand während des
Feldzuges 1870/71 als Gemeiner beim 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment,
12. Kompanie (Garnison Karlsruhe). Bei meiner Kompanie dienten neun Juden,
von denen drei Auszeichnungen erhielten, einer den Zähringer Löwen-Orden
mit Schwertern, einer das Eiserne Kreuz 2. Klasse und ich die silberne
Verdienstmedaille und die badische Friedrich-Militärverdienstmedaille
(letztere die höchste badische Auszeichnung, die wir vor dem Feinde
erhalten können) und zwar mit dem Diplom für allgemeine Tapferkeit
während des Feldzuges. In obigem Regiment haben etwa vierzig Juden den
Feldzug mitgemacht und sind etwa dreißig Prozent dekoriert
worden. Artikel
(mit verschiedenen Kriegsberichten) in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" vom 4. Oktober 1895: "Ich stand während des
Feldzuges 1870/71 als Gemeiner beim 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment,
12. Kompanie (Garnison Karlsruhe). Bei meiner Kompanie dienten neun Juden,
von denen drei Auszeichnungen erhielten, einer den Zähringer Löwen-Orden
mit Schwertern, einer das Eiserne Kreuz 2. Klasse und ich die silberne
Verdienstmedaille und die badische Friedrich-Militärverdienstmedaille
(letztere die höchste badische Auszeichnung, die wir vor dem Feinde
erhalten können) und zwar mit dem Diplom für allgemeine Tapferkeit
während des Feldzuges. In obigem Regiment haben etwa vierzig Juden den
Feldzug mitgemacht und sind etwa dreißig Prozent dekoriert
worden.
In der Regimentsgeschichte bin ich ehrend erwähnt und ich lege Ihnen als
Beleg einen Auszug derselben bei, bestehend in einem kleinen Heft, das im
Schulunterricht gebraucht wird. Dass ich aber auch mit den Herren
Antisemiten nicht viel Federlesens mache und mir von denselben nicht viel
gefallen lasse, werden Sie aus den beiliegenden Flugblättern ersehen, die
ich seinerzeit herausgab, als ich von den Herren ohne allen Grund in
gemeinster Weise angegriffen wird. Hochachtungsvoll
Graben (Baden), 19. September
(1895)
Heinrich Baer.
In den 'Anhaltspunkten zum Unterricht über vaterländische Geschichte'
(Karlsruhe 1888) heißt es Seite 27: 'Einer der Kühnsten war Grenadier
Baer (aus Graben). Da ihm ein Granatsplitter sein Gewehr aus der Hand
geschlagen führte er ein Chasepotgewehr. Zwei Franzosen, welche er beim Sturm
auf der Bahnlinie persönlich gefangen, mussten ihm die nötige Munition
sammeln und zutragen. Gehen die Patronen auf die Neige, so ruft Baer zum
allgemeinen Gaudium immer wieder mit drollig höflicher Geberde: Allons, Messieurs,
des cartouches! Diensteifrig springen stets von Neuem die beiden
herbei." |
Über nicht nichtjüdischen Professor Heinrich Zimmern
(1862-1931)
Anmerkung: seit der Angabe im "Jüdischen Lexikon" (hg.
Georg Herlitz und Bruno Kirschner) 1927 (Nachdruck 1982) Bd. IV/2
Sp. 1572 ist an vielen Stellen zu lesen, dass Heinrich Zimmern aus einer
jüdischen Familie Grabens entstammt, später zum Christentum konvertiert ist
usw. Die Angabe stimmt jedoch (Hinweis von Guido Herzog an "Alemannia
Judaica") nicht. Heinrich Zimmerns Vater - Heinrich Konrad Johann
Zimmern (geb. 7. August 1825, getauft 17. September 1825, gest. 21. Dezember
1896) - war von 1850 bis zu seinem Tod 1896 evangelischer Pfarrer in
Graben.
Dennoch sei an den "nichtjüdischen" Professor Heinrich Zimmern
gerne erinnert:
90. Geburtstag von Gottschalk Bär (1906)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 22. Juni 1906:
"Graben (Baden). Neunzigster Geburtstag. Herr Gottschalk Bär,
der älteste Einwohner unseres Ortes, feierte am 18. dieses Monats seinen
90. Geburtstag." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 22. Juni 1906:
"Graben (Baden). Neunzigster Geburtstag. Herr Gottschalk Bär,
der älteste Einwohner unseres Ortes, feierte am 18. dieses Monats seinen
90. Geburtstag." |
Weitere Dokumente
Fotos und Dokumente aus der Familie
Bär in Graben
(erhalten von Irene Münster, Rockville/MD/USA)
Anmerkung: Robert Bär (geb. 2. Februar 1886 in Graben) war ein Sohn
von Aron Bär (geb. 26. Januar 1856 in Graben, 1878 Gründer der
Likörfabrik und Branntweinbrennerei A. Baer & Co. in Graben) und Emilie geb.
Oppenheimer (geb. 4. März 1858 in
Hoffenheim). Aron Bär hatte noch mehrere Geschwister: Heinrich Baer (geb.
25. Februar 1840 in Graben), Esther Bär (geb. 8. Mai 1850 in Graben), Sophie
Bär verh. Hertz (geb. 3. März 1852 in Graben, umgekommen auf dem Transport in
das Lager Gurs 1940), Wilhelmina Bär (geb. 10. Januar
1854), Leopold Bär (geb. 5. April 1857 in Graben), Bertha Bär (geb. 15. Februar
1860) und Karoline (Carola) Bär verh. Ott (geb. 11. Oktober 1862 in Graben,
überlebt das Lager Gurs). Der Sohn Robert hatte noch fünf Geschwister: Julius, Hermann, Johanna
verheiratete Held, Martha und Bianca verh. Brunngässer. Robert Bär heiratete
1919 Else Bär geb. Grumbacher (geb. 4. November 1889 in
Rust als Tochter von Gustav und Klara Grumbacher).
Sie hatten zwei Kinder: Hermann (geb. 31. Januar 1920 in Graben) und Marianne
(geb. 1. August 1923 in Graben, später verheiratet mit Walter Lubasch). Robert
Bär starb am 27. März 1967 in Buenos Aires/Argentinien, seine Frau ist bereits
am 3. August 1957 ebd. gestorben. Quelle:
https://www.geni.com/people/Robert-Baer/6000000008797497557.
Zur Geschichte des Betsaales/der Synagoge
Die wenigen jüdischen Familien
hatten im 19. Jahrhundert einen Betsaal in einem ihrer Wohnhäuser. Wie
schwierig es allerdings für sie war, gottesdienstliches Leben aufrecht zu
erhalten, zeigen einige erhaltene Dokumente aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Damals zählten zur Gemeinde nur fünf selbständige Mitglieder (zusammen etwa
25 Personen). Nach einem Bericht des Bezirksrabbinates vom 20. September 1850
war es schon längere Zeit nicht gelungen, für die Grabener Gemeinde einen
Lehrer und Vorsänger zu finden, sodass den jüdischen Kinder kein
Religionsunterricht erteilt und kein Gottesdienst am Schabbat gefeiert werden
konnte. Dass sich dies nachteilig auswirkte, war auch die Meinung des Grabener Bürgermeisters,
der klagte, dass auf Grund der fehlenden Gottesdienste "beständige Zerwürfnisse
dieser wenigen Personen gegeneinander" festzustellen seien. Glücklicherweise
war es im Sommer 1850 gelungen, den jungen Lehrer Maas zu verpflichten, diese
Aufgaben für einige Zeit zu übernehmen. Zum 1. September 1850 trat er seine
Stelle in Graben an und wurde vertraglich dazu verpflichtet, jeweils am Schabbat
und an den Feiertagen den Gottesdienst zu leiten und dazu einen "religiös
moralischen Vortrag" (Schiur) zu halten. Jährlich erhielt Maas für seine
Dienste 40 Gulden. Die Gemeindeglieder wurden ihrerseits verpflichtet, die
Gottesdienste rechtzeitig und regelmäßig zu besuchen, alles die Andacht Störende
zu vermeiden und auch immer bis zum Schluss der Gottesdienstes an den Plätzen
zu bleiben. Diese Verpflichtung war auch höchst notwendig, da in Graben nur
neun religionsmündige Männer wohnten, zur Feier der Gottesdienste aber jeweils
zehn anwesend sein mussten. Einen zehnten Mann holte man regelmäßig gegen
Bezahlung aus einem Nachbarort. Er wurde der Reihe nach von den jüdischen
Familien über den Schabbat beherbergt und verköstigt. Wenn von den neun
Grabener Männern einer nicht teilnehmen konnte, musste dieser auf seine Kosten
eine Vertretung besorgen. 1852/53 gab es Probleme mit J.G. Holz, da dieser an
den hohen Feiertagen im Herbst 1852 und am Pessachfest im Frühjahr 1853 nicht
erschien und für ihn ein Mann aus Bruchsal besorgt werden musste. Freilich
weigerte sich J.G. Holz, der sich selbst mehr mit der Liedolsheimer
Gemeinde verbunden fühlte, für die Kosten aufzukommen, die dem Bruchsaler
Ersatzmann bezahlt werden mussten, was im April 1853 zu einer Anzeige des
Synagogenvorstandes, Sonnenwirt Jacob Holz beim Karlsruher Landamt führte.
Lange blieb Lehrer Maas nicht in Graben. Im Juli 1851 beklagte sich
Synagogenvorstand Jacob Holz darüber, dass er schon einige Male zu spät zum
Gottesdienst erschienen sei. Im Herbst 1851 berichtete das Bezirksrabbinat
Karlsruhe, dass seit dem Weggang von Maas wieder kein Religionsunterricht
erteilt werde. Auch könne der Gottesdienst nicht mehr regelmäßig stattfinden.
Wenigstens habe man zu den hohen Feiertagen den Lehrer Durlacher aus Münzesheim
verpflichten können.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts dürfte es etwas leichter
gewesen sein, regelmäßige Gottesdienste zu feiern, da die Zahl der jüdischen
Gemeindeglieder in Graben nach 1880 auf über 50 zunahm.
1905 scheint der Betsaal neu eingerichtet und eingeweiht worden zu sein.
Hierüber wurde jedenfalls in einer Pressemitteilung berichtet:
 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Oktober 1905:
"Neue Synagogen wurden vor den Feiertagen eingeweiht in Briesen
(Westpreußen), in Graben (Baden) und in Büdingen (Ostpreußen)." Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Oktober 1905:
"Neue Synagogen wurden vor den Feiertagen eingeweiht in Briesen
(Westpreußen), in Graben (Baden) und in Büdingen (Ostpreußen)." |
| Anmerkung zu dieser Meldung: hier hat
sich ein Fehler eingeschlichen: gemeint ist das hessische Büdingen;
in Ostpreußen gab/gibt es kein Büdingen (frdl. Hinweis von Guido Herzog
vom 15.11.2011). |
Der Betsaal blieb bis
1938 erhalten und wurde eine Woche vor der Pogromnacht im November 1938
verkauft. Dadurch entging er der Zerstörung. Das Haus mit dem Betsaal wurde zu
einem Wohnhaus umgebaut, das 1972 abgebrochen wurde (Karlsruher Strasse 67, das
Grundstück wurde wieder neu bebaut).
Fotos
Historische Fotos:
|
Historische Fotos sind nicht bekannt,
eventuelle Hinweise bitte an den
Webmaster von Alemannia Judaica: Adresse siehe Eingangsseite |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Foto um 1965:
(Quelle: HStAS EA 99/001
Fotosammlung) |
 |
| |
Aufnahme des ehemaligen jüdischen Hauses, in dem sich der Betsaal
der
Gemeinde befand |
| |
|
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
 |

|
| |
Das Synagogengrundstück ist neu bebaut |
| |
|
Foto 2003:
(Foto: Hahn,
Aufnahmedatum 9.12.2003) |
 |
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 11-12. |
 | Pinkas Hakehillot. Encyclopaedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany.
Württemberg - Hohenzollern - Baden. Ed. Joseph Walk. Hg. von Yad Vashem.
Jerusalem 1986 (hebräisch) S. 292-293 |
 | Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis Karlsruhe.
Karlsruhe 1990. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Graben Baden. Jews settled in the early
18th century and reached a population of 49 in 1887 (2 % of the total),
operating a distillery and cigarette factory. Ten of the 22 Jews present in 1933
left by 1938 and most of the others after Kristallnacht (9-10 November
1938). The last three were sent to the Gurs concentration camp on 22 October
1940.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|