|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Vogelsbergkreis"
Bobenhausen II (Stadt
Ulrichstein, Vogelsbergkreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Bobenhausen II bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück.
1770 gab es fünf jüdische Familien am Ort.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie
folgt: 1828 44 jüdische Einwohner, 1861 58 (9,5 % von insgesamt 612
Einwohnern), 1880 61 (10,0 % von 608), 1900 54 (10,5 % von 516), 1910 48 (8,7 %
von 550). Die jüdischen Familienvorstände waren als Viehhändler und Kaufleute
tätig.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule
(Religionsschule), ein rituelles Bad (im Gebäude der Synagoge) und ein Friedhof.
Die Gemeinde gehörte zum Liberalen Provinzialrabbinat Oberhessen mit Sitz in
Gießen. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war - gemeinsam mit Ulrichstein
(so ein Dokument von 1857) - ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als
Vorbeter und Schochet tätig war.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Ludwig (Louis)
Hermann (geb. 7.9.1894 in Bobenhausen, gef.
12.1.1915). Sein Name steht auf dem Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege
an der Kirche in Bobenhausen II.
Um 1924, als zur Gemeinde noch 25 Personen gehörten (4,6 % von insgesamt
544 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Max Katz II, Moses Hermann und
Isaak Katz I. Als Rechner der Gemeinde wird H. Reiß genannt. 1932 waren
die Gemeindevorsteher Max Katz (1. Vors.), Levy (2. Vors.) und Moritz Aaron (3.
Vors.).
1933 lebten noch 31 jüdische Personen in Bobenhausen (in 12 Familien,
5,6 % von insgesamt 536 Einwohnern). In
den folgenden Jahren sind fast alle von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (mehrere in die USA,
darunter der Gemeindevorsitzende Max Katz, andere nach Palästina/Israel). 1939
wurden noch vier jüdische Einwohner gezählt. Diese - es handelt sich um die
Familie Sally Joseph mit seiner Frau Paula geb. Aaron, der Tochter Lydia und dem
Sohn Helmut - sind 1942 von Bobenhausen aus über Darmstadt nach Treblinka (vermutl.)
deportiert und ermordet worden (vgl. Todesanzeige von 1945 unten).
Von den in Bobenhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Liebmann Aaron
(1864), Louis Aaron (1897), Rosalie (Rosa) Berney geb. Katz (1878, vgl. Erinnerungsblatt
des "Aktiven Museums Spiegelgasse" Wiesbaden), Jenny
Gottlieb geb. Katz (1883), Rosalie Hahn (1877), Selma Hirsch geb. Katz (1876),
Hellmut Jakob Joseph (1923), Lydia Joseph (1925), Paula Joseph geb. Aaron
(1898), Sally Joseph (1893), Regina Katz (1868), Else Kugelmann geb. Katz
(1894), Amalie Levi geb. Katz (1875), Betti (Betty) Reiss (1902), Hermann Reiss
(1868), Nanny Simon geb. Katz (1882), Bertha Sternheim geb. Reiss (1872), Jetta
Vogelsang geb. Hahn (1873).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer/Vorbeter
Ausschreibungen der Stelle eines Vorbeters zu den Hohen Feiertagen (1900 / 1901)
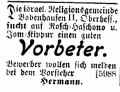 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1900:
"Die
israelitische Religionsgemeinde Bobenhausen II, Oberhessen, sucht auf
Rosch-Haschono und Jom-Kippur einen guten Vorbeter.
Bewerber wollen sich
melden bei dem Vorsteher
Hermann." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901:
"Die
Israelitische Religionsgemeinde Bobenhausen II, Oberhessen, sucht auf
Rosch-Haschono und Jom Kippur einen Vorbeter.
Honorar nach Übereinkunft. Kost und Logis frei.
Der Vorstand:
Hermann." |
Aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Spendenaufruf für notleidende Familie (1867)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1867: "Bitte
um milde Beiträge zur Unterstützung einer notleidenden israelitischen
Familie in Bobenhausen bei Ulrichstein (Vogelsberg). Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1867: "Bitte
um milde Beiträge zur Unterstützung einer notleidenden israelitischen
Familie in Bobenhausen bei Ulrichstein (Vogelsberg).
Die beiden Eltern von sechs fast noch unmündigen Kindern, wovon eins
geisteskrank, welche sich früher redlich ernährten, sind schon seit
längerer Zeit an das Krankenbett gefesselt, wodurch ihre Verdienste total
geschwunden und grenzenloses Elend eingetreten. Es ist ein
bejammernswerter Anblick, diese sechs Kinder an dem Lager ihrer schwer
erkrankten Eltern in ihrer Not sitzen zu sehen. Obwohl die unermüdliche
Tätigkeit der ortsangehörigen Israeliten lobenswürdig ist, so ist es
denselben doch nicht möglich, die Not der wahrhaft unglücklichen Familie
ganz zu stillen. Es ergeht daher die Bitte an unsere israelitischen
Mitbürger um baldige Hilfe für diese arme Familie. Der Vorstand der
israelitischen Religionsgemeinde Ulrichstein ist bereit, Gaben in
Empfang zu nehmen und wird seinerzeit Rechenschaft darüber
ablegen. Die Gaben können auch an mich gesegnet werden; ich
bin ebenfalls bereit, solche aufs Beste zu besorgen.
Moses Fröhlich, Rechner." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Über Alfred Reiss
| Arnsberg s.Lit. Bd. I S. 84: "Alfred
Reiss, geboren 1900 in Bobenhausen (b. Schotten), war bis zum Jahre
1933 als Lehrer an verschiedenen Schulen in Darmstadt tätig, dann von
1933 bis 1939 am Philanthropin in Frankfurt am Main. Im Januar 1939
wanderte er nach Palästina aus." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Nach der Deportation: Todesanzeige für die in
Theresienstadt umgekommenen Liebmann Aaron und Katinka Aaron geb. Stern (1945)
Anmerkung: der genannte Louis Aaron wurde im September 1942 von Darmstadt
nach Treblinka deportiert und ist umgekommen; die genannten Sally Joseph und
Paula Joseph geb. Aaron wurden gleichfalls im September 1942 von Darmstadt nach
Treblinka deportiert und sind umgekommen. Katinka Aaron geb. Stern steht aus
nicht im Gedenkbuch des Bundesarchives.
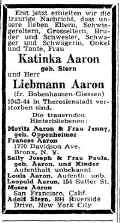 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2. November 1945: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2. November 1945:
"Erst jetzt erhielten wir die traurige Nachricht, dass unsere lieben
Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, Bruder und Schwester, Schwager und Schwägerin,
Onkel und Tante,
Frau Katinka Aaron geb. Stern und Herr Liebmann Aaron
(früher Bobenhausen - Giessen)
1943-44 in Theresienstadt verstorben sind.
Die trauernden Hinterbliebenen:
Moritz Aaron & Frau Jenny geb. Oppenheimer
Frances Aaron 1770 Davidson Ave. Bronx, N.Y.
Sally Joseph & Frau Paula geb. Aaron und Kinder, Aufenthalt
unbekannt
Louis Aaron, Aufenthalt unbekannt Leopold Aaron, 154 Sutter
St.
Moses Aaron San Francisco, Calif.
Adolf Stern, 894 Riverside Drive, New York
City." |
Nach der Emigration: Hochzeitsanzeige von Marianne geb.
Katz und Walter Mildenberg (Uruguay / USA 1949)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 22. April 1949:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 22. April 1949:
"Mr. and Mrs. Jacob Katz - Mr. and Mrs. Sol Mildenberg announce the
engagement of their children
Marianne and Walter.
Passover 5709 (April 13, 1949).
San Salvador 2122, Apt. 4 Montevideo, Uruguay (formerly Bobenhausen,
Oberhessen) -
315 Lincoln Place Brooklyn 17, New York (formerly Voehl,
Edersee). |
Zur Geschichte der Synagoge
Es ist nicht bekannt, wann die Synagoge in Bobenhausen erbaut
beziehungsweise in dem noch vorhandenen Gebäude eingerichtet wurde. Vermutlich
ist das Gebäude jedoch als Synagoge erstellt worden, da es nicht in der
Häuserfront von West nach Ost ausgerichtet ist. Es handelt sich um ein
zweigeschossiges Fachwerkbau mit Sattelbach. Im Gebäude waren die Synagoge mit
Frauenempore, eine Lehrerwohnung und das rituelle Bad untergebracht. Der
Schulraum war in einem anderem Gebäude.
1858 wurde eine Synagogenordnung erstellt. Aus der Geschichte des
Gebäudes ist nur bekannt, dass die jüdische Gemeinde 1904 in einem
Anbau an der Rückseite Abtritte eingerichtet wollte. Auf Grund von Beschwerden
des Nachbars beim Großherzoglichen Kreisamt wurde jedoch nur ein Pissoir
erlaubt.
Auf Grund der nach 1933 schnell zurückgehenden Zahl der Gemeindeglieder konnten
seit 1934 keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Dies geht aus einem
Schreiben hervor, das vom Landesverband israelitischer Religionsgemeinden
Hessens am 15. Juni 1938 an Rabbiner Dr. Paul Rieger in Stuttgart
geschickt wurde:
 Landesverband
israelitischer Religionsgemeinden Hessens Mainz an Landesverband
israelitischer Religionsgemeinden Hessens Mainz an
Sr. Ehrw. Herrn Oberrabbiner Dr. Rieger Stuttgart.
Betr. "Gottesdienst in Bobenhausen.
Sehr geehrter Herr Oberrabbiner. Ihre Anfrage beantworten wir dahin, dass
seit 4 Jahren in Bobenhausen kein Gottesdienst mehr stattfindet. Die
Synagoge befindet sich in baufälligem Zustand.
Mit bestem Gruss & gerne zu Diensten.
... Löwensberg.
Stellvertreter des Vorsitzenden". |
Das Synagogengebäude wurde kurz 1940 durch einen nichtsjüdischen Ortsbewohner erworben und zu einem Wohnhaus
umgebaut. Seit einem weiteren Umbau 1974 ist von der ehemaligen
Synagoge nichts mehr erkennbar. Bei weiteren Umbau- und Aufräumarbeiten auf dem
Dachboden wurden durch Brand geschädigte, lose Teile hebräischer Gebetbücher
gefunden. Der Dachboden diente offenbar - wie auch aus vielen anderen Orten
bekannt - als Genisa.
Adresse/Standort der Synagoge: Hoherodskopfstraße
37 (1932: Hauptstraße 34)
Fotos
(Quelle: Altaras s. Lit. 1988 S. 108; 2007² S.
253)
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge
im August 1985 |
 |
 |
| |
Durch den Umbau
des Wohnhauses und die Verkleidung des Fachwerks ist von der
ehemaligen
Synagoge nichts mehr zu erkennen |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
Juni
2020:
Verlegung von "Stolpersteinen" in Bobenhausen genehmigt |
Artikel von D.
Graulich in der "Oberhessischen Zeitung"
vom 2. Juni 2020: "Drei 'Stolpersteine' für Bobenhausen.
Ulrichsteiner Stadtverordneten tagen im großen Saal...
Ulrichstein. ... Einstimmige Zustimmung erhielt der Antrag von
Norman Kleeblatt aus New York auf Verlegung von 'Stolpersteinen' für dessen
drei Vorfahren im Gehweg der Hoherodskopfstraße 24 in Bobenhausen II.
In der Erläuterung zu dem Antrag verwies Bürgermeister Edwin Schneider
darauf, dass Ulrichstein seit dem 14. Jahrhundert eine lange jüdische
Geschichte habe. Kleeblatt habe bereits in 2017 Kontakt zu ihm aufgenommen
und auch mit einer Abordnung Ulrichstein und Bobenhausen besucht. Auch in
diesem Jahr sei er mit zwei weiteren Personen hier gewesen und habe die
jüdischen Friedhöfe, das Museum im Vorwerk und das Haus, in dem seine
Vorfahren, die Familie Aron, wohnten, in Bobenhausen II besichtigt. Der
jetzige Besitzer ist mit der Verlegung der Stolpersteine einverstanden.
Die 'Stolpersteine' sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im
Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten
'Stolpersteinen', soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in
der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben
oder in den Suizid getrieben wurden. Die quadratischen Messingtafeln mit
abgerundeten Ecken und Kanten sind mit von Hand mittels Hammer und
Schlagbuchstaben eingeschlagenen Lettern beschriftet. Die Kosten für die
Verlegung der drei 'Stolpersteine' in Höhe von rund 500 Euro werden von der
Stadt übernommen..."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 83-84. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 108. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 96. |
 | dies.: Neubearbeitung der beiden Bänden. 2007² S.
253. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 204. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 91. |
 | Katharina Jacob (Verein Landjudentum Vogelsberg): Jüdisches Familienleben in Ulrichstein".
Allgemeines zur Geschichte der Ulrichsteiner Juden. Beitrag
eingestellt als pdf-Datei (hierin auch ein Abschnitt: Die jüdische
Gemeinde in Bobenhausen). |
 |
 Hanno
Müller: Juden in Bobenhausen II. 1802-1942. Nachträge zu Juden in
Giessen. Erstellt unter Mitarbeit von Karl-H. Rudi. Hrsg. von der
Ernst Ludwig Chambré-Stiftung in Lich. Lich 2023. ISBN:
978-3-96049121-7.
http://www.fambu-oberhessen.de/ Hanno
Müller: Juden in Bobenhausen II. 1802-1942. Nachträge zu Juden in
Giessen. Erstellt unter Mitarbeit von Karl-H. Rudi. Hrsg. von der
Ernst Ludwig Chambré-Stiftung in Lich. Lich 2023. ISBN:
978-3-96049121-7.
http://www.fambu-oberhessen.de/ |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Bobenhausen
Hesse. Established in the second half of the 18th century, the community
numbered 61 (10 % of the total) in 1880 but dwindled to a handful in 1942, when
the Jews were transported to death camps.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|