|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Bayerisch Schwaben"
Bad Wörishofen (Kreis
Unterallgäu)
Jüdische Geschichte /Jüdischer Friedhof (Jüdisches Grabfeld im Kommunalen Friedhof)
Übersicht:
Zur jüdischen Geschichte in Bad Wörishofen
In Bad Wörishofen ("Bad" seit 1920) bestand zu keiner Zeit eine jüdische
Gemeinde. Doch lebten hier im 19./20. Jahrhundert einige wenige jüdische
Personen/Familien, von denen Einrichtungen betrieben wurden, damit jüdische Kurgäste
rituelle Verpflegung und Unterkunft fanden.
Seit
Ende des 19. Jahrhundert kamen auch jüdische Kurgäste nach Wörishofen. Unter
ihnen Prominente wie Baron Nathaniel von Rothschild (siehe Bericht unten),
der von Pfarrer Sebastian Kneipp persönlich behandelt wurde. Baron Rothschild
wurde zu einem der größten Wohltäter der Kneipp'schen
Stiftungen.
Die Zahl der jüdischen Einwohner blieb - ohne die jüdischen Kurgäste -
immer gering: 1910 13 jüdische Einwohner (0,4 % von insgesamt 3.103
Einwohnern), 1925 7, 1933 5 jüdische Einwohner. Um 1900/1904 waren es vor allem Mitglieder
der Familie Glasberg, 1909 wird Dr. J. Jelski in Wörishofen als Delegierter beim
IX. Zionistenkongress genannt (Zeitschrift "Die Welt" vom 10. Dezember 1909 S.
1107).
Die in Bad Wörishofen
wohnhaften jüdischen Personen gehörten offiziell zur jüdischen Gemeinde in Memmingen.
Bereits Anfang der 1920er-Jahre machte sich der Antisemitismus im überwiegend katholisch
geprägten Bad Wörishofen deutlich bemerkbar. Erste Hotels und Kureinrichtungen,
in denen jüdische Kurgäste unerwünscht waren, werden seit Anfang der
1920er-Jahre in jüdischen Zeitschriften genannt: im "Israelitischen
Familienblatt" vom 19. Mai 1921 waren es die Pension Martha, Inhaber Joh. Moosbauer; im
"Israelitischen Familienblatt" vom 10. Juni 1926 S. 4 weiterhin die Pension Martha und
nun auch die
Pension Raible. Andere Kureinrichtungen wiederum inserierten noch bis Anfang der
1930er-Jahre in jüdischen Zeitungen wie das "Hotel und Bad Kreuzer" und die
"Luftkuranstalt Sonnenbüchl" (Hotelführer des Jüdischen Jahrbuchs 1926), das "Sanatorium Wörishofen" (u.a.
in "Israelitisches Familienblatt" vom 18. Dezember 1930) oder Apotheker Martin
Eibl (in der "Central-Verein-Zeitung" vom 29. April 1932). Ihnen lag
weiterhin an der jüdischen Kundschaft.
Bei den 1933 in Bad Wörishofen lebenden jüdischen Personen
handelte es sich um die Familie von Hermann Glasberg, der sich 1895 in
Bad Wörishofen niedergelassen hatte (er war 1871 in Russland geboren) und in
der Stadt ein Geschäft in der Bahnhofstraße 4 betrieb. Er und seine Frau Emma
geb. Schulhöfer hatten sechs Töchter: Adele, Selma, Hermine, Flora, Elvira und
Martha. Die Töchter Elvira, Martha und Hermine konnten in die USA emigrieren, die
Tochter Adele zog nach Dresden und überlebte in Deutschland. Die Eltern kamen am 10. August
1942 in das jüdische Altersheim nach Augsburg, das damals Sammelplatz für die
Transporte nach Theresienstadt war, später nach Auschwitz, wo sie im Mai 1944 ermordet
wurden. Die Tochter Selma verheiratete Weissmann ist gleichfalls in Auschwitz
ermordet worden, die Tochter Flora verheiratete Wiener starb im Januar 1942 im
Ghetto Riga.
Weiter war eine in sogenannter
"privilegierter Mischehe" lebendige jüdische Frau in Bad Wörishofen. Sie starb im
November 1941.
Von den in Bad Wörishofen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma
Glasberg geb. Schulhöfer (1874), Hermann Glasberg (1871), Selma Weissmann geb.
Glasberg (1906), Flora Wiener geb. Glasberg (1910).
 Zur Erinnerung an die Familie Glasberg wurden im Mai 2015 vor dem Anwesen
Bahnhofstraße 4 zwei Stolpersteine verlegt für Emma und Hermann
Glasberg.
Zur Erinnerung an die Familie Glasberg wurden im Mai 2015 vor dem Anwesen
Bahnhofstraße 4 zwei Stolpersteine verlegt für Emma und Hermann
Glasberg.
- vgl. Artikel in der "Augsburger Allgemeinen" vom 22.
Februar 2014: "Stolpersteine sollen die Erinnerung wach halten. Bad
Wörishofen soll dem Beispiel Mindelheims folgen. Ein großer Teil der Familie
Glasberg starb im KZ..." Link
zum Artikel
- vgl. Artikel in der "Augsburger Allgemeinen" vom 28. Mai 2015
"Sich stets erinnern und niemals vergessen..." Link
zum Artikel (eingestellt als Bilddatei, © Augsburger
Allgemeine)
- Foto aus Wikimedia Commons https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stolperstein_Bad_Wörishofen_Hermann_Glasberg.jpg
siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_im_Landkreis_Unterallgäu
Von 1945 bis 1951 bestand in Bad Wörishofen ein Lager für jüdische
Displaced Persons, Überlebende der Shoa bzw. Konzentrationslagern. Der
Verwaltungssitz der "Jewish Community of Bad Wörishofen" war im Gasthof
Trautwein in der Bahnhofstraße 5. In Wörishofen lebten Ende 1945 90 jüdische DPs,
September 1946 277, März 1947 355 und Anfang 1948 Höchstzahl von 405 Personen.
Nachdem vor allem durch Auswanderung nach Israel die Zahl bis Anfang 1951 nur
noch 65 Personen zurückgegangen wurde, wurde das Lager geschlossen. Es gab in
der Zeit des DP-Lagers eine jüdische Volksschule und eine Berufsschule am Ort,
sicher einen Betraum, dazu eine koschere Küche sowie ein jüdisches
Sanatorium-Krankenhaus zur Behandlung von Folgen der Folgen der Zeiten in den
Konzentrations- und Arbeitslagern. Unter den Vereinen gab es als Fußballverein
den Hapoel Bad Wörishofen.
Vgl.
https://www.after-the-shoah.org/bad-woerishofen-juedische-dp-gemeinde-bad-woerishofen-jewish-dp-community/
https://hdbg.eu/juedisches_leben/gemeinde/bad-woerishofen/1567
Von den im DP-Lager Bad Wörishofen geborenen Personen ist Yank Azman
(geb. 1947) zu nennen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yank_Azman
Texte / Anzeigen zur jüdischen Geschichte
Um 1900: die Pension Glasberg - streng
koscher geführt
(spätestens seit 1896 und bis nach 1914 erschienen regelmäßig Anzeigen der
Pension Glasberg in Wörishofen)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1896: Wörishofen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1896: Wörishofen.
Für hiesige, streng orthodoxe Restauration wird eine israelitische
perfekte Köchin gesucht. Offerten unter G. 315 befördert A. J.
Hofmann, Buchhandlung, Frankfurt am Main." |
| |
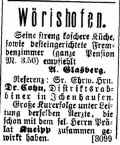 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1900: "Wörishofen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1900: "Wörishofen.
Seine streng koschere Küche, sowie besteingerichtete Fremdenzimmer (ganze
Pension Mark 3.50) empfiehlt A. Glasberg.
Referenz: Seiner Ehrwürden Herr Dr. Cohn, Distriktsrabbiner in Ichenhausen.
Große Kurerfolge unter Leitung derselben Ärzte, die schon mit dem
seligen Herrn Prälat Kneipp zusammen gewirkt haben." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1900: Wörishofen,
Pension Glasberg. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1900: Wörishofen,
Pension Glasberg.
Streng koschere Küche. Schön eingerichtete
Fremdenzimmer. Ganze Pension Mark 3.50. Referenz: Hochwürden Herr
Rabbiner Dr. Kohn - Ichenhausen. Große Kurerfolge unter Leitung derselben
Ärzte, die schon Jahre lang mit dem seligen Herrn Prälaten Kneipp
zusammen gearbeitet haben." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900: derselbe
Text wie oben. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900: derselbe
Text wie oben. |
Hinweis auf die jüdische Pension Glasberg (1904)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. April 1904: "Badegast, Neutra: In Wörishofen existiert eine
jüdische Pension. S. Glasberg, Waldstraße 83 1/2". Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. April 1904: "Badegast, Neutra: In Wörishofen existiert eine
jüdische Pension. S. Glasberg, Waldstraße 83 1/2". |
Baron Nathaniel Rothschild, "einer der größten
Wohltäter der Kneipp'schen Stiftungen" (1894) wird in der antisemitischen
Presse denunziert
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1894: "(Aus
dem Füllhorn antisemitischer Lügen!) Durch die antisemitische Presse
machte neuerdings das Märchen die Runde, Baron Nathaniel Rothschild habe
dem bekannten Wörishofer Pfarrer Kneipp für eine mehrwöchentliche Kur
nur 50 Mark Honorar gezahlt. Auf Anfrage eines Teplitzer Fabrikanten bei
Pfarrer Kneipp erhielt dieser nun folgende Antwort: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Juni 1894: "(Aus
dem Füllhorn antisemitischer Lügen!) Durch die antisemitische Presse
machte neuerdings das Märchen die Runde, Baron Nathaniel Rothschild habe
dem bekannten Wörishofer Pfarrer Kneipp für eine mehrwöchentliche Kur
nur 50 Mark Honorar gezahlt. Auf Anfrage eines Teplitzer Fabrikanten bei
Pfarrer Kneipp erhielt dieser nun folgende Antwort:
'Wörishofen, 11. Mai 1894. Euer Wohlgeboren! Auf Ihr Geehrtes, vom 8.
dieses Monats die ergebenste Mitteilung, dass ich heute dem Herrn Prälaten
den Inhalt Ihres Schreibens vorgetragen habe. Der Herr Prälat gab mir den
Auftrag, zur Steuer der Wahrheit zu Ihrer Beruhigung und zur Abwehr
ungerechter Angriffe Ihnen Folgendes mitzuteilen: Herr Baron Rothschild
machte hier die Kur nach Anweisung der Herrn Prälaten Kneipp mit gutem
Erfolge. Was der Herr Baron ihm gegeben. wird Niemand erfahren, wie
überhaupt der Herr Prälat niemals von seinen Kurgästen sagt, ob sie ihm
viel oder wenig gegeben haben. Der Herr Prälat war mit dem, was er ihm
gegeben, vollständig zufrieden. Zugleich muss noch erwähnt werden, dass
der Herr Prälat von dem Herrn Baron sagte, er sei einer der
bescheidensten Kurgäste gewesen, der ihm die wenigste Zeit hinweggenommen
und ihn öfters bat, er möchte ihm die Zeit bestimmen, wann es ihm am
gelegensten wäre, mit ihm zu verkehren, und sich ganz genau nach der ihm
bestimmten Zeit richtete, ängstlich vermeidend, ihn irgendwie zu
belästigen oder ungelegen zu sein. Obwohl der Herr Baron es sich
verbeten, so muss auf diesen Fall doch angedeutet werden, dass in neuerer
Zeit er einer der größten Wohltäter der Kneipp'schen Stiftungen
geworden ist. Der Herr Prälat bedauert sehr, dass dem Herrn Baron so
unrecht geschieht, denn ihm sind als Kurgäste alle gleich, wes Standes
und Religion sie sein mögen. Er betrachtet den Kranken, sucht ihm zu
helfen und will durchaus nicht, dass Jemandem Unrecht geschehen sollte. Im
Auftrage des hochwürdigen Herrn Prälaten hochachtungsvollst Msgr. Seb.
Kneipp's Sekretariat.'
Wo bliebe die antisemitische Wühlerei ohne ihre Hauptwaffen: Lügen und
Verleumdungen!" |
| |
 Bei
dem im obigen Artikel genannten Baron Nathaniel Rothschild handelte es
sich vermutlich um Nathaniel Meyer von Rothschild (geb. 1836 in
Frankfurt am Main, gest. 1905 in Wien), ein Sohn des Bankiers Anselm
Salomon Freiherr von Rothschild (1803-1874), dem Begründer der Creditanstalt
in Wien. Bei
dem im obigen Artikel genannten Baron Nathaniel Rothschild handelte es
sich vermutlich um Nathaniel Meyer von Rothschild (geb. 1836 in
Frankfurt am Main, gest. 1905 in Wien), ein Sohn des Bankiers Anselm
Salomon Freiherr von Rothschild (1803-1874), dem Begründer der Creditanstalt
in Wien.
Nathaniel Rotschild betätigte sich als Kunstsammler, Reiseschriftsteller,
Sportsmann, Blumenzüchter und großzügiger Gönner. |
Antisemitische Vorwürde gegen Juden in Wörishofen (1894)
 Artikel
in "Freier Blatt" vom 5. August 1894: "(Kleine Geschenke des
Pfarrers Kneipp.) Antisemitische Blätter brachten aus Wörishofen
eine förmliche Räubergeschichte. Juden sollen kleine Geschenke, die Herr
Pfarrer Kneipp aus Rom für seine Kurgäste mitgebracht habe, gewaltsam
zusammengerafft haben, in Folge dessen christliche Patienten leer
ausgegangen sind. Herr Spitzer - Weimar,
der uns immer an jenen Landsmann Vergani's erinnert, der sich 'nicht zu
erkennen geben will", mokierte sich über die Juden, welche plötzlich so
große Sehnsucht nach einem Kreuzlein verspürt hätten. Um festzustellen, was
an der Sache Wahres ist, wendeten wir uns brieflich nach Wörishofen mit dem
Ersuchen, uns den eigentlichen Sachverhalt mitzuteilen. Wir erfahren nun von
authentischer Seile, dass es allerdings bei der Verteilung der Geschenke
etwas wüst hergegangen ist und auch mancherlei Beschwerden eingelaufen sind.
Als 'gewiss' bezeichnet unser Gewährsmann, 'dass Gegenstände, welche Herr
Prälat Kneipp aus Rom seinen Kurgästen zum Andenken schenkungsweise
übermittelte, verkauft worden sind'. Wer so unanständig war, ein Geschenk zu
verkaufen, konnten wir nicht in Erfahrung bringen, denn Näheres ließ sich
trotz eifriger Nachforschungen nicht feststellen, und es sind nur
'verschiedene Gerüchte im Umlauf'. Für einen antisemitischen Scribenten ist
selbstverständlich, auch das unverbürgteste Gerücht eine 'genügende
Grundlage, um darauf eine judenfeindliche Erzählung zu stützen und den
kleinen Geschenken des Pfarrers Kneipp ein großes Hepp! Hepp!-Geschrei
folgen zu lassen." Artikel
in "Freier Blatt" vom 5. August 1894: "(Kleine Geschenke des
Pfarrers Kneipp.) Antisemitische Blätter brachten aus Wörishofen
eine förmliche Räubergeschichte. Juden sollen kleine Geschenke, die Herr
Pfarrer Kneipp aus Rom für seine Kurgäste mitgebracht habe, gewaltsam
zusammengerafft haben, in Folge dessen christliche Patienten leer
ausgegangen sind. Herr Spitzer - Weimar,
der uns immer an jenen Landsmann Vergani's erinnert, der sich 'nicht zu
erkennen geben will", mokierte sich über die Juden, welche plötzlich so
große Sehnsucht nach einem Kreuzlein verspürt hätten. Um festzustellen, was
an der Sache Wahres ist, wendeten wir uns brieflich nach Wörishofen mit dem
Ersuchen, uns den eigentlichen Sachverhalt mitzuteilen. Wir erfahren nun von
authentischer Seile, dass es allerdings bei der Verteilung der Geschenke
etwas wüst hergegangen ist und auch mancherlei Beschwerden eingelaufen sind.
Als 'gewiss' bezeichnet unser Gewährsmann, 'dass Gegenstände, welche Herr
Prälat Kneipp aus Rom seinen Kurgästen zum Andenken schenkungsweise
übermittelte, verkauft worden sind'. Wer so unanständig war, ein Geschenk zu
verkaufen, konnten wir nicht in Erfahrung bringen, denn Näheres ließ sich
trotz eifriger Nachforschungen nicht feststellen, und es sind nur
'verschiedene Gerüchte im Umlauf'. Für einen antisemitischen Scribenten ist
selbstverständlich, auch das unverbürgteste Gerücht eine 'genügende
Grundlage, um darauf eine judenfeindliche Erzählung zu stützen und den
kleinen Geschenken des Pfarrers Kneipp ein großes Hepp! Hepp!-Geschrei
folgen zu lassen." |
Vermächtnis des in Wörishofen
verstorbenen Josef Tritsch (1910)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" von 11. November
1910: "Wörishofen. Der hier verstorbene Josef Tritsch, ein
geborener Prager, hat in seinem Testament ein Kapitel von etwa 460.000 Kronen
zur Begründung von drei Stiftungen für israelitische Blinde, für Sieche
und Geisteskranke in Böhmen bestimmt. Außerdem hat er seine Einrichtung
in Obermais bei Meran im Werte von 60.000 Kronen dem Meraner
israelitischen Asyl zediert." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" von 11. November
1910: "Wörishofen. Der hier verstorbene Josef Tritsch, ein
geborener Prager, hat in seinem Testament ein Kapitel von etwa 460.000 Kronen
zur Begründung von drei Stiftungen für israelitische Blinde, für Sieche
und Geisteskranke in Böhmen bestimmt. Außerdem hat er seine Einrichtung
in Obermais bei Meran im Werte von 60.000 Kronen dem Meraner
israelitischen Asyl zediert." |
Im Ersten Weltkrieg kommen jüdische Kurgäste aus Bad Reichenhall nach Bad
Wörishofen (1915)
 Artikel
in "Das jüdische Echo" von 23. Juli 1915: "Wörishofen.
Vor geraumer Zeit sind ungefähr 40 Personen, meist russisch-polnische Juden,
aus dem Okkupationsgebiet, darunter solche, die seit Jahren regelmäßig als
Kurgäste Bad Reichenhall
aufsuchen und begütert sind, auf amtliche Weisung nach Wörishofen
übersiedelt. Die Maßnahme erklärt sich damit, dass
Bad Reichenhall seit der
Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn zum Grenzgebiet gehört, in dem
sich Angehörige des feindlichen Auslandes nicht mehr aufhalten dürfen. Aus
diesem Grunde ist nicht nur den russisch-polnischen Juden, sondern auch
allen Angehörigen des übrigen feindlichen Auslandes der weitere Aufenthalt
in Bad Reichenhall versagt worden. Artikel
in "Das jüdische Echo" von 23. Juli 1915: "Wörishofen.
Vor geraumer Zeit sind ungefähr 40 Personen, meist russisch-polnische Juden,
aus dem Okkupationsgebiet, darunter solche, die seit Jahren regelmäßig als
Kurgäste Bad Reichenhall
aufsuchen und begütert sind, auf amtliche Weisung nach Wörishofen
übersiedelt. Die Maßnahme erklärt sich damit, dass
Bad Reichenhall seit der
Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn zum Grenzgebiet gehört, in dem
sich Angehörige des feindlichen Auslandes nicht mehr aufhalten dürfen. Aus
diesem Grunde ist nicht nur den russisch-polnischen Juden, sondern auch
allen Angehörigen des übrigen feindlichen Auslandes der weitere Aufenthalt
in Bad Reichenhall versagt worden. |
Über Max Reach
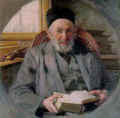 Links:
Max Reach: Ölgemälde "Alter Mann mit Buch" von 1922 (Quelle: Artnet) Links:
Max Reach: Ölgemälde "Alter Mann mit Buch" von 1922 (Quelle: Artnet)
Der Jugendstilmaler Max Reach (geb. 1872 in Prag, umgekommen 1943/44 in
Auschwitz) war mehrfach zur Kur in Bad Wörishofen. Davon berichtet
Reinhard H. Seitz in einem Beitrag (s.Lit.). |
Seit Anfang der 1920er-Jahre- Speisehaus von Rosa Kasriels (Anzeigen von 1921/24)
Anmerkung: als Heimatanschrift gibt Rosa Kasriels 1921 zunächst noch München,
Holzstraße 15 an ("Das jüdische Echo vom 15.4.1921)
 Anzeige
in "Das jüdische Echo" vom 3. Juni 1921: "Koscher. Ich habe in Anzeige
in "Das jüdische Echo" vom 3. Juni 1921: "Koscher. Ich habe in
Bad Wörishofen ein Speisehaus eröffnet
und werde bestrebt sein, meine werten Gäste zufrieden zu stellen. Um
geneigten Zuspruch bittet
Frau Rosa Kasriels, Wörishofen, Zweigstraße 11". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1922: "Ab
15. Juni eröffne in Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1922: "Ab
15. Juni eröffne in
Bad Wörishofen mein Speise-Haus - Koscher.
Um
geneigten Zuspruch bittet hochachtungsvollst
Frau Rosa Kasriels
Wörishofen, Waldstraße 6". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924: "Streng
Koscher. Ab 1. Juli ist mein Speisehaus geöffnet! Unter Aufsicht
eines von seiner Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Ehrentreu bestellten
Schomers. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924: "Streng
Koscher. Ab 1. Juli ist mein Speisehaus geöffnet! Unter Aufsicht
eines von seiner Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Ehrentreu bestellten
Schomers.
Bad Wörishofen. Habsburgerstr. 4 - Villa Novák. Frau Rosa
Kasriels." |
Jüdische Kurgäste unerwünscht (ab 1921/1930 noch in
einzelnen Pensionen, 1935 allgemeines Verbot für jüdische Kurgäste)
 Aus
einer Liste in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30.
Mai 1930: "Wörishofen: Pension Martha, Pension Raible lehnen die
Aufnahme von Juden ab." Aus
einer Liste in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30.
Mai 1930: "Wörishofen: Pension Martha, Pension Raible lehnen die
Aufnahme von Juden ab." |
| |
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1935:
"Nach Meldung des V.B. (Volksbeobachters) ist die Kurverwaltung in
Bad Wörishofen angewiesen, keinem Juden mehr eine Kurkarte auszustellen.
Etwa im Bade noch anwesende jüdische Gäste sollen zur baldigen Abreise
veranlasst werden." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1935:
"Nach Meldung des V.B. (Volksbeobachters) ist die Kurverwaltung in
Bad Wörishofen angewiesen, keinem Juden mehr eine Kurkarte auszustellen.
Etwa im Bade noch anwesende jüdische Gäste sollen zur baldigen Abreise
veranlasst werden." |
Die Fußballmannschaft von "Bar Kochba" München verliert
gegen die Mannschaft aus Bad Wörishofen (1923)
Anmerkung: nicht ganz klar ist, wie sich eine
jüdische Fußballmannschaft Bad Wörishofen zusammensetzte auf Grund der wenigen
jüdischen Einwohner des Ortes.
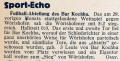 Artikel der Zeitschrift "Das
jüdische Echo"
vom 10. August 1923: "Fußball-Abteilung des Bar Kochba.
Das am 29. vorigen Monats stattgefundene Wettspiel gegen Wörishofen sah die
Wörishofener mit 5:2 siegreich. Halbzeit 0:0. Das erste und zweite Tor fiel
für Bar Kochba, worauf der Schiedsrichter in einer ganz unerhörten Weise für
Wörishofen parteiisch wurde, und sämtliche Tore, die aus 'abseits'
geschossen wurden, gab. 3 Leute von Bar Kochba wurden vom Platz verwiesen
und ein Eigentor half weiter zum 'Sieg' von Wörishofen. Ossy.". Artikel der Zeitschrift "Das
jüdische Echo"
vom 10. August 1923: "Fußball-Abteilung des Bar Kochba.
Das am 29. vorigen Monats stattgefundene Wettspiel gegen Wörishofen sah die
Wörishofener mit 5:2 siegreich. Halbzeit 0:0. Das erste und zweite Tor fiel
für Bar Kochba, worauf der Schiedsrichter in einer ganz unerhörten Weise für
Wörishofen parteiisch wurde, und sämtliche Tore, die aus 'abseits'
geschossen wurden, gab. 3 Leute von Bar Kochba wurden vom Platz verwiesen
und ein Eigentor half weiter zum 'Sieg' von Wörishofen. Ossy.". |
Zur Geschichte des jüdischen Grabfeldes im Friedhof Bad
Wörishofen
Im kommunalen Friedhof befindet
sich über einem gemeinschaftlichen Grab ein Denkmal, das im Mai 1945 von dem in Bad
Wörishofen bestehenden "Jüdischen Komitee Bad Wörishofen" (DP-Lager
siehe oben) erstellt
wurde. Es trägt die Inschrift: "Hier ruhen die Opfer des blutigen
Nazi-Regimes. Ehre ihrem Andenken! Das jüdische Komitee Bad Wörishofen im Mai
1945". Bei den in Wörishofen verstorbenen Personen handelt es
sich um 34 bisherige KZ-Häftlinge des Außenkommandos von Dachau in Türkheim
(KZ Außenlager Kaufering VI),
die nach der Befreiung in einem Hospital in Bad Wörishofen verstorben sind.
Ein weiterer Gedenkstein erinnert auf dem Friedhof an das Schicksal der Familie Glasberg
(siehe oben).
Lage des jüdischen Grabfeldes
Im kommunalen Friedhof - vom Kneipp-Mausoleum
her kommend - hinter der Friedhofskapelle (Aussegnungshalle) in der zweiten
Reihe rechts.
 |
Lage des (kommunalen) Friedhofes
in Bad Wörishofen auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und
über das
Verzeichnis der "Behörden und öffentl. Einrichtungen" zu
"Friedhof, Bad Wörishofen". |
Fotos
(Fotos: Hubert Joachim, erstellt im Sommer 2007)
Das jüdische Grabfeld im
kommunalen
Friedhof in Bad Wörishofen |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
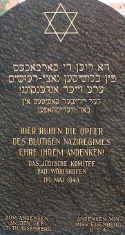 |
| |
|
Inschrift auf Grabstein |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Gernot Römer: Für die Vergessenen.
KZ-Außenlager in Schwaben. 1984 S. 188. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens
in Bayern. 1988 S. 234. |
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 461. |
 | Reinhard H. Seitz (Hrsg.): Streiflichter auf die jüngere
Geschichte von Bad Wörishofen. In: Wörishofen auf dem Weg zum
Kneippkurort, zu Bad und Stadt. Lindenberg 2004.
Darin: Martina Haggenmüller: Von Weimarer Republik,
Nationalsozialismus und Nachkriegszeit. S. 235-252.
sowie: Karl Schuster: In den dunklen Tagen der Gewaltherrschaft. S.
253-255.
sowie: Reinhard H. Seitz: Stellvertretend für eine Vielzahl von (Kur)Gästen
in Wörishofen: Johann Okic - Max Reach - Katherine Mansfield. S. 219-234
[zum jüdischen Kunstmaler und Schriftsteller Max Reach: 1872 Prag - 1943/44
Auschwitz]. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge
nächste Synagoge



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
|