|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Groß-Gerau"
Worfelden mit
Klein-Gerau (Gemeinde
Büttelborn, Kreis Gross-Gerau)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Worfelden bestand eine kleine jüdische
Gemeinde bis 1937/38. Die Entstehung der Gemeinde geht in die Zeit
des 18. Jahrhunderts zurück. 1770 wird in Worfelden Salomon Kahn
geboren, der Stammvater der Worfelder Kahns. Zur jüdischen Gemeinde Worfelden gehörten
auch die in Klein-Gerau lebenden jüdischen Einwohner.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen
Einwohner der Orte wie folgt: Worfelden: 1854 10, 1878 21,
1895: 31, 1900 32, 1905 27 jüdische Einwohner (2,98 % der Einwohnerschaft von
906 Personen); Klein-Gerau: 1830 27, 1905 12 jüdische Einwohner.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der jüdischen Einwohner an
den beiden Orten nicht mehr zu durch Abwanderung und Auswanderung. So sind in
den 1860er-Jahren aus Klein-Gerau Angehörige der Familien Gottschall und
Guckenheimer in die USA ausgewandert.
An
Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) mit Schulzimmer
und rituellem Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Groß-Gerau
beigesetzt.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Unteroffizier Albert Kahn
(geb. 27.9.1891 in Worfelden, gef. 16.8.1918). Sein Name steht auf dem Worfelder
Kriegerdenkmal.
Um 1924 wurden in Worfelden 17 jüdische Einwohner in vier Haushaltungen gezählt (1,7 % von
insgesamt etwa 980 Einwohnern). Die Vorsteher der Gemeinde waren Leopold Kahn,
Rudolph Kahn und Siegfried Kahn. Die Gemeinde gehörte zum orthodoxen
Bezirksrabbinat Darmstadt II. Bis nach 1933 waren Mitglieder der Familien Rudolf Kahn, Max Mann, Leopold Kahn und Max
Kahn am Ort.
Nach 1933 ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder (1933: 15 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. So verzog Familie
Rudolf Kahn 1934 nach Groß-Gerau und emigrierte 1937 in die USA.
Von den in Worfelden geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945". ergänzt durch Angaben bei Schleindl S. 100): Albert Kahn (1888),
Eva Kahn geb. Selig (1891), Johanna (Hanna) Kahn geb. Kahn (1895), Karl Kahn (1892), Salli Kahn
(1891), Leopold Kahn (1889), Ludwig Kahn (1892), Else Mann geb. Kahn (1897),
Inge(borg) Mann (1927), Max Mann (1894), Betty Marx geb. Kahn (1902), Frieda Westerfeld geb. Kahn (1898).
Aus Klein-Gerau sind umgekommen: Bertha Collin geb. Gottschall (1880),
Hermann Gottschall (1878), Rebekka Gottschall geb. Kahn (1886), Willy Kaufmann
(1880 in Rotenburg a.d. Fulda), Jenny Landmann geb. Hirsch (1895), Karoline Weil
geb. Guckenheimer (1855).
1988 wurde am alten Rathaus Worfelden eine Gedenktafel für die deportierten und
ermordeten Juden angebracht.
Das ehemalige Haus der Familie Gottschall gegenüber dem Kriegerdenkmal an der
Klein-Gerauer Hauptstraße (erbaut von der Metzgerfamilie Gottschall 1910) wurde
gegen die engagierten Bemühungen einer Bürgerinitiative auf Beschluss des
Gemeinderates ausgerechnet am nationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2000 abgebrochen.
Im Gebäude befand sich im 1. Stock eine
Laubhütte. Für die Familie Gottschall wurden am 22. Februar 2012 vier
Stolpersteine an der Hauptstraße neben der Ausfahrt des Gebäudes der
Klein-Gerauer Freiwilligen Feuerwehr verlegt. Eine Bruchsteinmauer, bestehend
aus Sockelsteinen des alten Hauses erinnert zugleich an die Familie Gottschall
sowie andere jüdische Einwohner (vgl. Fotos unten).
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Wurstfabrik Hermann Gottschall 1924)
Anmerkung: beim Inhaber handelt es sich um Hermann Gottschall, der 1942 mit
seiner Ehefrau Rebekka geb. Kahn in Auschwitz ermordet wurde. Hermann Gottschall hatte
eine Metzgerei / Wurstfabrik in Klein-Geraus in der Hauptstraße. Im Februar
2012 wurden "Stolpersteine" vor dem Haus für das Ehepaar und die
Söhne Herbert und Arthur verlegt, die beide durch die Flucht aus
Nazi-Deutschland überlebt haben: der ältere Sohn Herbert (geb. 1908) war
bereits 1933 nach Amsterdam ausgewandert und starb am 6. Februar 1938 an einer
Hirnblutung. Seine Frau bekam von ihm noch einen nach seinem Tod am 25. März
1938 geborenen Sohn Hans (in den USA Harold), der später in die USA
ausgewandert ist und in Palm Beach FL lebt. Der jüngere Sohn von Hermann und
Rebekka Gottschall war Arthur (geb. 8. Oktober 1911). Dieser ist 1936
nach Amsterdam ausgewandert, dann aus den Niederlanden geflohen und nach 1945
wieder nach Amsterdam zurückgekommen, wo er mit seiner Frau Josephine geb.
Delmonte lebte. Die beiden hatten zwei Tochter: Lizette Eijsbouts-Gottschall
und Betty Ria Berson-Gottschall. Arthur Gottschall starb am 29. Oktober 1982
(Informationen von Lizette Eijsbouts-Gottschall vom 11. Juni 2018).
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 20. März 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 20. März 1924:
"Wo bekommen Sie die echte Hausmacher-Landwurst - Koscher -
garantiert wasserrein und zusatzfrei, zum billigsten Tagespreis? In der
Wurstfabrik von
Hermann Gottschall, Klein-Gerau bei Darmstadt (Hessen). Telephon:
Amt Groß-Gerau Nr. 311". |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
für Therese Kahn
(geb. in Worfelden) |

|
|
| |
Kennkarte (Mainz) für
Therese Kahn geb. Kahn (geb. 2. August 1882 in Worfelden) |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge konnte am 6. September 1893 eingeweiht
werden. Die Pläne waren von Kreiszeichner (Kreistechniker) Johannes Lohr im Frühjahr 1893
gezeichnet worden. Er plante ein einfaches, aber für die kleine Gemeinde
repräsentatives Gebäude mit einem treppenförmigen Fries am Schaugiebel. Die
Baugenehmigung wurde der Israelitischen Religionsgemeinde Worfelden vom
Großherzoglichen Kreisbauamt Groß-Gerau am 6. April 1893 erteilt. Das
einstöckige Gebäude war 7,60 m breit und 9,00 m lang. Der Schaugiebel hatte
einen treppenförmigen Fries (siehe Pläne unten). Der größte Raum hatte 37 qm
(Betsaal), die beiden anderen Räume (jeweils 6 qm) sind im Plan als Badzimmer
(Raum der Mikwe) und als Schulzimmer bezeichnet.
Die Einweihung der Synagoge (1893)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. September 1893:
"Worfelden, 7. September (1893). Gestern wurde hier die neu erbaute
Synagoge feierlichst eingeweiht. Es ist anzuerkennen, dass die nur aus sieben
Familien bestehende hiesige israelitische Gemeinde durch großen Opfermut die
Errichtung eines würdigen Gotteshauses herbeiführte. Der Bau ist, den
Verhältnissen entsprechend, nicht groß, aber sehr schmuck und würdig
ausgestattet. Die Feier der Einweihung wurde durch Herrn Rabbiner Dr. Selver aus
Darmstadt vollzogen, welcher durch das Weihegebet, sowie darauf folgende Predigt
mit Gebet für Kaiser, Großherzog und Vaterland die versammelte Gemeinde in
feierlichste Stimmung versetzte. An der Feier beteiligte sich die christliche
Bevölkerung sehr stark, wobei insbesondere die Anwesenheit des Bürgermeisters
mit dem Ortsvorstand, des Baumeisters und der beiden evangelischen Lehrer
erwähnt werden soll. Der evangelische Pfarrer gab in einem Schreiben an den
Vorstand seinem Bedauern Ausdruck, durch die auf gestern anberaumt gewesene
Dekanats-Konferenz an der Teilnahme verhindert zu sein. Ein erfreuliches Bild
lieferte die Einweihung von der Eintracht, welche unter den Bekennern der
verschiedenen Konfessionen herrscht." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. September 1893:
"Worfelden, 7. September (1893). Gestern wurde hier die neu erbaute
Synagoge feierlichst eingeweiht. Es ist anzuerkennen, dass die nur aus sieben
Familien bestehende hiesige israelitische Gemeinde durch großen Opfermut die
Errichtung eines würdigen Gotteshauses herbeiführte. Der Bau ist, den
Verhältnissen entsprechend, nicht groß, aber sehr schmuck und würdig
ausgestattet. Die Feier der Einweihung wurde durch Herrn Rabbiner Dr. Selver aus
Darmstadt vollzogen, welcher durch das Weihegebet, sowie darauf folgende Predigt
mit Gebet für Kaiser, Großherzog und Vaterland die versammelte Gemeinde in
feierlichste Stimmung versetzte. An der Feier beteiligte sich die christliche
Bevölkerung sehr stark, wobei insbesondere die Anwesenheit des Bürgermeisters
mit dem Ortsvorstand, des Baumeisters und der beiden evangelischen Lehrer
erwähnt werden soll. Der evangelische Pfarrer gab in einem Schreiben an den
Vorstand seinem Bedauern Ausdruck, durch die auf gestern anberaumt gewesene
Dekanats-Konferenz an der Teilnahme verhindert zu sein. Ein erfreuliches Bild
lieferte die Einweihung von der Eintracht, welche unter den Bekennern der
verschiedenen Konfessionen herrscht." |
1937 wurde das Synagogengebäude für 300 RM an eine Privatperson
(Heinrich Engel) verkauft und entging damit einer Zerstörung beim Novemberpogrom 1938.
1940 stellte Engel den Antrag auf Umbau des Gebäudes. Beim Umbau zu dem bis heute erhaltenen Wohnhaus
wurden äußerlich die Erinnerungen an die frühere Synagoge beseitigt, vor
allem wurde ein
Stockwerk aufgesetzt, ein Kellergeschoss eingebaut und das Gebäude durch Anbauten
stark verändert.
Adresse/Standort der Synagoge: Sackgasse 4
Fotos
(Quelle: Pläne von 1893 bei A. Schleindl s. Lit. und Thea Altaras s. Lit.)
Die Pläne von 1893
des Kreiszeichners Johannes Lohr
(alle drei Abb. bei Schleindl S. 330) |
 |
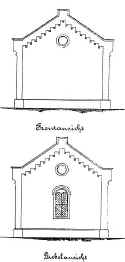 |
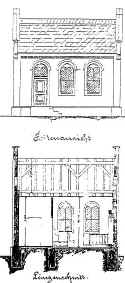 |
|
| |
Schnitt und Grundriss
(eingezeichnet auch
das Schulzimmer und
das rituelle Bad) |
Frontansicht und
Giebelansicht |
Seitenansicht und
Längenschnitt |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
Rekonstruktionsskizzen
der ehemaligen Synagoge
(Abb. bei Altaras 2007 S. 308-309) |
 |
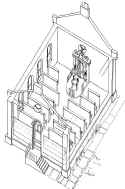 |
|
Ansichten:
Perspektive links, Isometrie rechts; es handelt sich nach Thea Altaras
"um Rekonstruktionszeichnungen anhand von Studien schriftlicher
und zeichnerischer archivalischer Unterlagen und Aussage von Augenzeugen";
unklar ist jedoch, wieso hier seitlich vier Fenster und nicht wie
auf den Plänen von Kreiszeichner Lohr auf den Traufseiten drei Fenster
bzw. zwei Fenster und Türe zu sehen sind.
|
| |
|
| |
|
Das ehemalige
Synagogengebäude
um 1990 |
 |
 |
| |
Das Gebäude der
ehemaligen Synagoge um 1990; bei Gelegenheit werden neue Fotos
eingestellt;
über Zusendungen freut sich der Webmaster: Adresse siehe Eingangsseite |
| |
|
|
| |
|
|
Gedenken in
Klein-Gerau am Standort des Hauses Gottschall
(Fotos von Lisette Eijsbouts, August 2017) |
|

|
 |
 |
| Am
Standort des Hauses der Familie Gottschall in Klein-Gerau, Hauptstraße
wurde aus Steinen des abgebrochenen Hauses eine Gedenkmauer errichtet
mit einer Gedenktafel und der Inschrift: "Am 9. November 1938 begann
mit der Reichspogromnacht die Verfolgung und Vernichtung der Menschen
jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammlung. Bis 1945 fielen der
staatlichen organisierten Verfolgung über sechs Millionen Menschen zum
Opfer. 1933 lebten in Klein-Gerau: Von der Familie Gottschall: Hermann und
Frau Rebekka, Herbert und Arthur. Von der Familie Feist Hirsch: Johanna
Hirsch, Willy Kugelmann und Frau Auguste geb. Hirsch, Freddy, Arthur und
Harold. Wir gedenken aller Opfer aus unserer Gemeinde. Hermann Gottschall,
deportiert nach Auschwitz, für tot erklärt, Rebekka Gottschall, verschollen.
9. November 1988". Rechts die 2002 verlegten "Stolpersteine" für
Hermann Gottschall (1878), Rebekka Gottschall geb. Kahn (1886), Herbert
Gottschall (1908), Arthur Gottschall (1911). |
| |
|
|
Rechts: Foto der
Baergo-Metzgerei, die Herbert Gottschall aus Klein-Gerau 1933 zusammen mit
seinem Freund Ernst Baer in der Van Baerlestraat 104 in Amsterdam eröffnete
(zwangsweise geschlossen nach der deutschen Besetzung der Niederlande)
(Foto erhalten von Lisette Eijsbouts) |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
Januar 2012:
In Klein-Gerau werden
"Stolpersteine" verlegt
Anmerkung: Die vier Stolpersteine
für die Familie Gottschall wurden am 22. Februar 2012 bei der Feuerwehr an
der Hauptstraße verlegt. |
Artikel von Wulf-Ingo Gilbert in "Echo
online" vom 4. Januar 2012: "Eltern in Auschwitz ermordet.
Erinnerung - Für die jüdische Familie Gottschall werden in der
Klein-Gerauer Hauptstraße vier Stolpersteine verlegt..."
Link
zum Artikel |
Informationen zum Beitrag von Heinrich
Klingler bei der Verlegung der "Stolpersteine": "Heinrich Klingler vom
Verein Heimatpflege, der als Kind seine Nachbarn Hermann und Rebekka
Gottschall persönlich kannte, erinnerte daran, dass der Name Gottschall
erstmals 1752 im Gemeindearchiv zu lesen war. Damals seien die Gottschalls
Makler für Getreide und Vieh gewesen, für Juden fast die einzige
Möglichkeit, sich beruflich zu betätigen. Anfangs habe die Familie in der
Hauptstraße 11 gewohnt, ehe Hermann Gottschalls Vater Moses das Grundstück
Nummer 14 kaufte. Sein Sohn errichtete darauf ein Wohn- und Geschäftshaus.
Die Metzgerfamilie, die ihre koscheren Würste bis nach New York lieferte,
sei in Klein-Gerau völlig integriert gewesen. Hermann war in der Feuerwehr
aktiv, in allen Vereinen Mitglied. Zum Wohnhaus habe eine Laubhütte gehört.
Mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft habe sich die
wirtschaftliche Lage der Metzgerei verschlechtert, bis 1938 kaum noch
geschlachtet werden konnte.
Herbert Gottschall sei bereits 1933 nach einer Auseinandersetzung mit
SA-Leuten nach Holland geflohen. Sein Bruder Arthur sei ebenfalls geflohen,
zunächst über Spanien in die Karibik, dann nach Kanada, von wo aus er als
Soldat an der Landung der Alliierten in Frankreich teilnahm. Später habe er
auch in Holland gelebt, sagte Klingler. Ihre Eltern, die sich 1938 in
Frankfurt Anonymität versprachen, misslang die Flucht. Aus dem belgischen
SS-Lager Mechelen wurden sie 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Als letzten Hinweis fand Heinrich Klingler eine Notiz an den Klein-Gerauer
Bürgermeister, in der Gottschall bat, entsprechend einer Anordnung des
Reichsinnenministers seinem Namen 'Israel' hinzuzufügen."
Quelle |
| |
| Februar 2014:
Zweite Verlegung von
"Stolpersteinen" in Klein-Gerau |
Am Mittwoch, den 19. Februar 2014 wurde in
Klein-Gerau auf der Hauptstraße 32 eine weitere Stolpersteinverlegung durch
Gunter Demnig für Familie Kugelmann durchgeführt. Die Stolpersteine erinnern
in der Hauptstraße 32 an Willi und Auguste Kugelmann, die mit ihren Kindern
Fred, Arthur und Harold 1937 in die USA fliehen konnten. Dabei wurde die
Familie von Augustes Schwester Johanna begleitet. Unter den rund 80
Bürgerinnen und Bürgern nahm auch Bürgermeister Andreas Rotzinger teil und
eröffnete die Stolpersteinverlegung mit einer Ansprache. Heimatforscher
Heinrich Klingler berichtete aus dem Leben der Familie Kugelmann und ihrer
Vertreiben durch die Nationalsozialsten. Die Grundschulkinder
der Schule in Klein-Gerau leisteten einen Beitrag zu der Verlegung und
wirkten aktiv mit. Bei dieser Stolpersteinverlegung gab es erstmals Musik
von dem jüdischen Liedermacher Dany Bober.
Quelle |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 90-92 (wenige Angaben innerhalb
des Artikels zu Mörfelden). |
 | Thea Altaras: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 119-121. |
 | 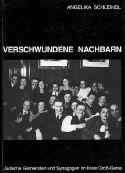 Angelika
Schleindl: Verschwundene Nachbarn. Jüdische Gemeinden und Synagogen
im Kreis Groß-Gerau. Hg. vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 1990 S. 96-100.331. Angelika
Schleindl: Verschwundene Nachbarn. Jüdische Gemeinden und Synagogen
im Kreis Groß-Gerau. Hg. vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 1990 S. 96-100.331. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 155-156. |
 | 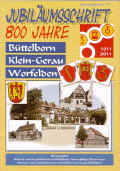 Heimat-
und Geschichtsverein Büttelborn, Heimatpflege Klein-Gerau, Heimat- und
Geschichtsverein Worfelden, Gemeinde Büttelborn (Hrsg.):
Jubiläumsschrift - 800 Jahre Büttelborn - Klein-Gerau - Worfelden. 1211 -
2011. Heimat-
und Geschichtsverein Büttelborn, Heimatpflege Klein-Gerau, Heimat- und
Geschichtsverein Worfelden, Gemeinde Büttelborn (Hrsg.):
Jubiläumsschrift - 800 Jahre Büttelborn - Klein-Gerau - Worfelden. 1211 -
2011.
Darin u.a. für die jüdische Geschichte von Interesse:
S. 46-57: Auswanderung nach Amerika im 19. Jahrhundert.
S. 59: Klein-Gerauer Emigranten in der Zeit des Nationalsozialismus.
S. 60-61: Israeliten in Worfelden. Die Worfelder
Kahn-Familie. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|