|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Groß-Gerau"
Büttelborn (Kreis
Groß-Gerau)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Büttelborn bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis 1937/38. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück, als erstmals 1725
drei jüdische Einwohner genannt werden. Aus dem Jahr 1748 ist ein
Grabstein einer Büttelborner Frau (Breile, Frau des Leiser Büttelborn),
bekannt, die auf dem jüdischen
Friedhof in Dieburg beigesetzt wurde. 1770 waren zwei jüdische Familien am
Ort, 1815 vier.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der jüdischen
Einwohner wie folgt: 1828 14 jüdische Einwohner, 1861 42 (3,5 % der
Gesamteinwohnerschaft von 1.195 Personen, in acht Familien), 1875 39, 1880
35 (3.3 % von 1.060), 1893 sieben jüdische Familien, 1900 19 jüdische
Einwohner (1,3 % von 1.492), 1905 27 (1,7 % von 1.592). Die jüdischen Familien
lebten vom Handel mit Vieh, doch gab es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch
jüdische Handwerker (Schneider, Sattler) und einige Kaufläden im Besitz jüdischer
Familien am Ort.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (siehe unten)
und eine Religionsschule (Raum für den Unterricht). Zur Besorgung religiöser
Aufgaben in der Gemeinde war wohl zu keiner Zeit ein eigener Lehrer am Ort, die
jüdischen Kinder wurden durch auswärtige Lehrer unterrichtet. Die Toten der
jüdischen Gemeinde wurden im jüdischen
Friedhof Groß-Gerau beigesetzt.
Die Zahl der jüdischen Einwohner nahm seit der Mitte des 19. Jahrhunderts durch
Aus- und Abwanderung nicht mehr wesentlich zu. Unter den Auswanderern waren
insbesondere Angehörige der Familien Seelig und Sonn (Auswanderungen von
zusammen 16 Personen in den Jahren 1882 und 1887).
1924 lebten 27 jüdische Einwohner am Ort. Vorsteher der jüdischen
Gemeinde war damals Ferdinand Seelig. Die Gemeinde gehörte zum orthodoxen
Bezirksrabbinat Darmstadt II. 1925 und 1933 wurden jeweils 23 Personen gezählt.
Der letzte jüdische Gemeindevorsteher war Sigmund Selig.
Nach 1933 ist ein Teil der jüdischen
Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien
weggezogen (Familie Leopold und Johanna Hirsch nach Crumstadt) beziehungsweise
ausgewandert. Anfang 1938 lebten noch zehn meist ältere jüdische Personen in Büttelborn.
Beim Novemberpogrom 1938 stürmten SA-Leute die Wohnung und das Textil-
und Kurzwarengeschäft von Betty Seelig (Schulstraße 34), verbrannten die Geschäftsbücher,
zerstörten das Inventar und misshandelten die fast 70-jährige, gehbehinderte
Frau.
Von den in Büttelbronn geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben bei A. Schleindl
s. Lit. S. 86): Johanna Hirsch geb.
Bruchfeld (1890), Leopold Hirsch (1886), Erna Schnapper geb. Grünewald (1912),
Betty Seelig (1865), Frieda Seelig (1904), Flora Seelig (1876), Margaretha Seelig geb.
Hirsch (1879), Siegmund Seelig (1872), Hermann Stein (1883), Lina Stein geb. David (1892), Selma Stein
geb. Stein (1894).
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
| Erinnerungen
an die Familie Leopold und Johanna Hirsch |
Erhalten blieben Fotos aus
der Familie von Leopold und Johanna Hirsch
(nachstehende Informationen von A.
Schleindl s. Lit. S. 78-87.224-225; ergänzt durch neue Informationen von
Elsie Levy geb. Hirsch):
Informationen zur Familie: Leopold Hirsch ist am 13. April 1886 geboren; er war verheiratet mit
Johanna geb. Bruchfeld, die am 6. Januar 1890 in Crumstadt geboren ist.
Das Ehepaar hatte drei Kinder:
- Ferdinand Hirsch (Ferdy, geb. 24. Juni 1913), emigrierte 1935 in die
USA.
- Ludwig Hirsch (geb. 16. September 1914), emigrierte 1936 in die USA, ist im Oktober 1983 in Englewood, Bergen, NJ gestorben.
- Elsie Hirsch (geb. 2.7.1917 in Büttelborn), emigrierte 1938 in die USA, dort verheiratet mit Carl Levy, war 1988 zu Besuch in Groß-Gerau; Brief von ihr bei
A. Schleindl s.Lit. S. 84-85; lebt in den USA, konnte 2020 ihren 103.
Geburtstag feiern.
Familie Hirsch lebte in Büttelborn in der Weiterstädter Straße 12, wo Leopold Hirsch einen Eisenwarenhandel betrieb. 1937 verkauften die Eltern das Haus in Büttelborn und zogen mit der Tochter Elsie (die Brüder waren schon in den USA) in ihr (= Johannas) Elternhaus (Abraham Bruchfeld III) nach
Crumstadt, wo sie bis zur Pogromnacht im November 1938 blieben und in dieser Nacht
auf Grund der Ausschreitungen fliehen mussten. Sie lebten danach in
Darmstadt, Wilhelmstraße 10.
Die erhaltenen Fotos und Gebetbücher der Familie wurden in Darmstadt einer
im selben Hause wohnenden, nichtjüdischen Familie offenbar unmittelbar vor der drohenden Deportation übergeben. Die Nachbarfamilie solle
es bis zur Rückkehr aufbewahren.
1942 wurden Leopold und Johanna Hirsch von Darmstadt nach Theresienstadt deportiert und später nach Auschwitz, wo sie ermordet wurden.
Im Mai 2011 wurden die Fotos und Gebetbücher an Frau Elsie Levy geb.
Hirsch zurückgeschickt (siehe Bericht unten). |
| Einige Fotos und Karten aus
dem Familienalbum der Familie Hirsch: |
 |
 |
 |
 |
 |
Leopold Hirsch als Soldat
im Ersten Weltkrieg |
Die Söhne Ferdinand
und Ludwig Hirsch 1915 |
Familie Hirsch
1919 |
Ferdinand, Ludwig und
Elsie Hirsch 1921 |
Elsie, Ludwig und
Ferdinand Hirsch 1925 |
|
|
 In einem Presseartikel
von Elaine Alexander in "St. Louis Jewish Light" vom 25. Mai
2011 wird über die Geschichte der Rückgabe der Dokumente
berichtet (Link
zum Bericht): "Survivor reunited with long-lost family artifacts. In einem Presseartikel
von Elaine Alexander in "St. Louis Jewish Light" vom 25. Mai
2011 wird über die Geschichte der Rückgabe der Dokumente
berichtet (Link
zum Bericht): "Survivor reunited with long-lost family artifacts.
Earlier this month, 94-year-old Elsie Hirsch Levy received an astonishing phone call from Buettelborn, Germany, the town her family had fled during the Nazi era. The excited caller was Levy's grade school classmate, Marie Beisswenger, with whom Levy has been in frequent contact. Apparently, for seven decades, Levy has had a date with destiny. And the singular moment had just
arrived.
In 1941, before Levy's parents were deported by the Nazis to Theresienstadt, a concentration camp in Czechoslovakia, a fellow neighbor named Marie Specht had received a box from them for
safekeeping.
Specht passed away in 1987, leaving "The Box" in the hands of her daughter, Irma Bund, and her family. In it, the Bunds found some two-dozen photographs and a set of Hebrew-German makhzorim (prayer books) printed in 1907 and dedicated to different holidays of the Jewish calendar. Interested in seeing these artifacts returned to their owner, Irma's son, Axel, went about trying to fulfill this mission.
Addresses and persons named on the back of the photos, including Elsie Levy's grandfather, Abraham Bruchfeld III, led Axel to Joachim Hahn. Hahn is the author of numerous books on the Jews of southern Germany, a leader in Christian-Jewish relations and webmaster of a Jewish-German history
website.
Elsie Levy, herself, planted the trail from Joachim Hahn. In 1988, after much soul-searching, Levy was convinced by her late husband, Carl, who "always had Germany in his head" to attend a Buettelborn commemoration for victims on the 50-year anniversary of the Kristallnacht Pogrom (when synagogues, Jewish homes and businesses and Jews themselves were assaulted throughout Germany and Austria). Hahn had acquired the memorial book from the event, which included an interview with Levy about her Bruchfeld-Hirsch family history. Hahn's website subsequently included some of that
information.
After Axel Bund contacted Hahn, he in turn reached out to the mayor of Buettelborn to see if he could help find someone who could identify the people in the picture. The mayor visited the elderly Beisswenger, Elsie Levy's good childhood friend, and showed her the black-and-white, family portrait photographed in 1919. Beisswenger immediately recognized the adults in the photo as Levy's parents, Leopold and Johanna Bruchfeld Hirsch.
 On May 17, Levy, a resident of Olivette, and a 2010 Unsung Hero of the Jewish Light, was at her door, shaking with emotion as she signed for The Box. It seemed to have finally reached her through the magic of the Internet and the compassion of strangers. On May 17, Levy, a resident of Olivette, and a 2010 Unsung Hero of the Jewish Light, was at her door, shaking with emotion as she signed for The Box. It seemed to have finally reached her through the magic of the Internet and the compassion of strangers.
When the 21-year-old Levy and her two brothers had said good-bye to their parents to come to America in 1938, Levy was confident her entire family would soon be reunited here. But then in 1941, she and her brothers received crushing news: their mother had been granted a visa, but on account of ill health, their father's had been
denied.
Levy received one letter from Theresienstadt, and then "we never heard from them again." Inquiries by the Red Cross on Levy's behalf proved that her parents were later murdered at Auschwitz.
Hahn said the Bunds almost couldn't believe that a daughter of the Hirschs still lives in the States. "They always hoped that somebody of the family [would some day] get The Box," Hahn
said. Hahn commenting about the Bunds' reaction to their successful investigation, said they were very happy. "They almost couldn't believe it, that a daughter of the Hirschs still lives in the
States."
Axel Bund, who said he is a customs officer at the Frankfurt Airport, said he is disturbed when during his interactions with strangers from "from all over the world," the word Nazi rises easily to their lips. For Bund and his parents, it is a matter of conscience to honor the German-Jewish past. "The Jews were Germans [fundamentally equal in every way to non-Jews]" he said.
The Box has stirred gratitude for "good German people," which Levy has expressed by phone to Irma Bund. By the same token, the family artifacts have also revived bitter memories of Germany and sparked tears over her parents' execution for the "crime of being Jewish."
The nine prayer books are slightly more than pocket sized, with lavish, gilt artwork on the spines and covers. Dr. Ethan Schuman, local dentist and chazzan (cantor) at Nusach Hari B'nai Zion Congregation, from a digital image, recognized the "beautiful makhzorim" as a publication of "the famous house of Roedelheim near Frankfurt." Schuman, who grew up in a shul that used Roedelheim siddurim," said their style and quality is
unmistakable.
Elsie Levy believes that including the prayer books in a box of treasures was her parents', eleventh-hour act of reverence-to keep holy texts from being desecrated. She considers the books and family photos a legacy of the two things her parents held most precious and
irreplaceable." |
| |
| Rechts Fotos
von Kristi Forster: Holocaust survivor Elsie Levy née Hirsch, of
Olivette, holds some of the family artifacts sent to her from Germany. During the Nazi
era, Levy’s parents left a box of family artifacts with a neighbor for
safe-keeping. The family only recently discovered the rightful owner of the contents of the
box. |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
Ein weiterer Presseartikel erschien am 23.
Juli 2011 in "Echo-Online.de" (Link
zum Artikel; eingestellt
als pdf-Datei) unter der Überschrift: "Gebetbuch kehrt zurück". |
|
|
|
Dezember 2020 / Januar 2021:
Zum Tod von Elsie Levy s.A.
|
 Artikel/Nachruf von Ulrich Trumpold in den "Büttelborner Nachrichten" vom
22. Januar 2021: "Ehemalige Büttelbornerin verstorben. Im Alter von 103
Jahren verstarb Elsie Levy in den USA
Artikel/Nachruf von Ulrich Trumpold in den "Büttelborner Nachrichten" vom
22. Januar 2021: "Ehemalige Büttelbornerin verstorben. Im Alter von 103
Jahren verstarb Elsie Levy in den USA
Die Arbeitsgruppe Stolpersteine in Büttelborn verliert nach Marie Beißwenger,
die bereits 2014 verstarb, die letzte Zeitzeugin aus den Jahren 1933 bis
1945. Elsie Levy geb. Hirsch aus der Weiterstädter Straße 12 verstarb am 19.
Dezember 2020 in einer Seniorenresidenz in St. Louis, USA. Sie wurde am 2.
Juli 1917 in Büttelborn als drittes Kind der Eheleute Leopold und Johanna
Hirsch geboren. Der älteste Sohn Ferdinand hatte das Glück, durch Freunde
der Familie eine Bürgschaft für die USA zu erhalten, wohin er 1935
auswanderte. Sein Bruder Ludwig folgte ein Jahr später; beide lebten in New
York. 1937 verkauften die Eheleute Hirsch ihr Anwesen und zogen nach
Crumstadt zum damals kranken Vater der
Ehefrau Johanna, einer geborenen Bruchfeld. Die Tochter Elsie gelangte 1938
vor dem 9. November durch ihre Brüder ebenfalls nach New York, wo die
gelernte Schneiderin ihren Lebensunterhalt mit Nähen verdiente. Noch in
Deutschland hatte sie den aus Trebur
stammenden Juden Carl Levy kennengelernt. Er war ebenfalls in die USA
geflohen und lebte in St. Louis. Als er hörte, dass Elsie Hirsch in New York
war, schrieb er ihr, sie möge zu ihm kommen, was sie auch tat und ihn dort
heiratete; er verstarb 2008. Die Eltern Leopold und Johanna Hirsch bemühten
sich um ein Visum für die USA, das die Mutter erhielt, für den Vater jedoch
wegen seines Magenleidens abgelehnt wurde; er hätte eine Einreisegenehmigung
erhalten, wenn für ihn eine hohe Kaution hinterlegt worden wäre, die seine
Kinder aber nicht aufbringen konnten. So blieb auch die Mutter. Beide wurden
über Darmstadt nach Theresienstadt und später nach Auschwitz verschleppt, wo
sie verschollen sind. Elsie Levy stand seit Kriegsende in regem Kontakt zu
ihrer Freundin aus Kindertagen in Büttelborn, Marie Beißwenger, die die
Familie Hirsch trotz aller Gefahren unterstützte, solange diese in
Büttelborn wohnte. Während Frau Beißwenger ihre Freundin sieben Mal in St.
Louis besuchte, weigerte sich Elsie Levy zunächst, Deutschland wieder zu
betreten. Erst im November 1988 anlässlich des 50. Jahrestages der
Reichspogromnacht kamen sie und ihr Ehemann auf Einladung der Gemeinde
Büttelborn und der damaligen Friedensgruppe in ihren Heimatort. Die Eheleute
Levy besuchten auch Trebur, wo noch zahlreiche Bekannte von Carl lebten, die
ihn herzlich begrüßten. Für die Familie Hirsch wurden 2011 Stolpersteine
verlegt. An der Zeremonie nahmen Enkel und weitere Verwandte von Elsie Levy
teil. An Carl Levy und seine Familie wurde 2014 mit Stolpersteinen in
Trebur erinnert. In den folgenden Jahren
besuchten die Enkel von Frau Levy mehrmals Büttelborn. Umgekehrt waren
Mitglieder der Stolpersteingruppe Büttelborn öfter Gast bei Elsie Levy in
St. Louis, zunächst in deren eigenem Haus, später in ihrer Seniorenresidenz.
Der Kontakt zu ihren Nachkommen, die wiederholt in Büttelborn waren, besteht
und wird wohl auch fortdauern.
Elsie war eine lebenspraktische Frau mit feinem Humor, die sich in den USA
stets nur als Gast fühlte. Den Verlust ihrer Heimat hatte sie niemals
verschmerzt. Umso wichtiger war ihr der Kontakt zu ihrer Schulfreundin und
später zur Stolpersteingruppe. Auch der Umstand, dass sie nicht in der Lage
war, die Kaution für ihren Vater aufzubringen, belastete sie stets mit
Schuldgefühlen. Ihren Frieden mit der 'Obrigkeit' in Deutschland machte sie
erst, als sich der damalige Bürgermeister Horst Gölzenleuchter anlässlich
der Stolpersteinverlegung 2011 für die im Nationalsozialismus verübten
Verbrechen entschuldigte. Eine Videoaufnahme seiner Rede schaute sie sich
immer wieder an. An der Trauerfeier auf dem Friedhof nahmen wegen der
Corona-Einschränkungen nur wenige Menschen teil; man konnte sie per Zoom
live miterleben. Im Lebenslauf von Elsie Levy ging die Rabbi sehr
ausführlich auf das Vertreibungsschicksal der Familie Hirsch ein, aber auch
auf die Bedeutung, die die Verlegung der Stolpersteine und die
Erinnerungskultur in Büttelborn für Elsie hatte. Der am Abend stattfindende
Schiwa-Minjan (der Beginn der siebentägigen Trauer) fand ebenso per
Videoschaltung statt. Die Familie bedankte sich danach ausdrücklich bei der
Stolpersteingruppe Büttelborn für die langjährigen Kontakte zu Frau Levy,
die ihr viel bedeutet hätten."
Link
zum Artikel |
| |
 |
 |

|
 |
 |
Artikel im
"Groß-Gerauer Echo"
vom 15.1.2021 |
|
Fotos
von der Beisetzung von Elsie Levy in St. Louis
Quelle:
https://boxcast.tv/view/elsie-levy-funeral-service-282176 |
|
Anzeigen jüdischer
Gewerbebetriebe (vor 1933)
(Kopien erhalten von Elsie Levy geb. Hirsch, St. Louis/USA)
 |
 |
 |
Anzeige der Eisenhandlung
Leopold Hirsch,
Weiterstädter Straße |
Anzeige der Rindsmetzgerei
Ferdinand Seelig, Schulstraße |
Anzeige der Manufaktur-,
Weiß- und
Wollwarenhandlung Hermann Stein |
Zur Geschichte der Synagoge
Die Synagoge wurde 1873 erbaut und eingeweiht. Die
jüdische Gemeinde hatte die Schmiedewerkstätte des Adam Friedmann erworben und
das Gebäude zu einer Synagoge umgebaut. In diesem Gebäude befand sich auch ein
Schulzimmer für den Religionsunterricht der Kinder. Die jüdische Gemeinde
hatte zwei Torarollen.
In der NS-Zeit war die Synagoge alsbald
Ziel von nationalsozialistischen Anschlägen. 1936 war nach Angaben des
letzten Vorstehers der jüdischen Gemeinde Sigmund Selig "vollkommen
demoliert"; aus diesem Grund bat er beim Rabbinat Darmstadt um eine Genehmigung zum Verkauf
der Synagoge: 'Durch vollkommene Demolierung unserer Synagoge sehen wir uns
leider gezwungen, unsere Synagoge zu verkaufen, Da diese heilige Stätte nun
nicht mehr der Abhaltung eines Gottesdienstes durch vollkommen unwürdiges
Aussehen unseren Religionsgesetzen ... entspricht, bitten wir höflichst um
Genehmigung des Verkaufs". Die Genehmigung wurde erteilt, der Verkauf des
Gebäudes fand am 2. Juli 1936 statt. Der neue Besitzer ließ die
Synagoge abbrechen, um sein Geschäftshaus zu erweitern.
Adresse/Standort der Synagoge: Schulstraße 11
Fotos
(Fotos: Historisches Fotos des Hauses der Familie Stein - Repro
Alexander Heimann, aus der Website des "Fördervereins Jüdische Geschichte
und Kultur im Kreis Groß-Gerau e.V., Seite
zur Verlegung von "Stolpersteinen" in Büttelborn; neueres Foto
des Synagogengrundstückes: Hahn, Aufnahmedatum 6.7.2007; neuere Fotos vom
ehemaligen Haus der Familie Stein und des Alten Rathauses mit der Gedenktafel:
Hahn, Aufnahmedatum 24.10.2011)
| Das ehemalige Haus der Familie Stein
(Mainzer Straße 10) |
|
 |
 |
 |
Das Haus in den
1930er-Jahren |
Das Haus nach Umbau
zum "Gasthof zum Löwen" |
Die "Stolpersteine"
für
die Familie Stein |
| |
|
|
Blick auf das Grundstück
der
ehemaligen Synagoge Schulstraße 11 |
 |
|
| |
|
|
| Gedenken am alten
Rathaus |
|
|
 |
 |
 |
Das alte Rathaus in
Büttelborn mit der Gedenktafel und der Inschrift:
"Am 9. November 1938 begann mit der Reichspogromnacht die
systematische Verfolgung und Vernichtung der Menschen jüdischen Glaubens
und jüdischer Abstammung. Bis 1945 fielen der staatlich organisierten
Verfolgung über sechs Millionen Menschen zum Opfer.
1933 lebten in Büttelborn 6 jüdische Familien: Familie Sigmund
Grünewald, Familie Leopold Hirsch, Familie Sigmund Hirsch, Familie
Ferdinand Seelig, Familie Sigmund Seelig, Familie Hermann Stein.
Wir gedenken aller Opfer aus unserer Gemeinde:
Leopold Hirsch, verschollen, Auschwitz - Erna Schnapper geb. Grünewald,
verschollen, unbekannt - Bettchen Seelig, gest. 12.2.1943, Theresienstadt
- Frieda Seelig, verschollen, Osten - Sigmund Seelig + 7.1.1943,
Theresienstadt - Margarethe Seelig geb. Hirsch, für tot erklärt, Polen -
Hermann Stein, für tot erklärt, unbekannt - Selma Stein geb. Stein,
verschollen, Polen. 9. November 1933". |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
Hinweis: Chronologie zur Verlegung von
"Stolpersteinen" in Büttelborn und Ortsteilen
Klein-Gerau und
Worfelden:
1. Verlegung, 30. März 2011: Büttelborn, Mainzer Str. 10, Familie Stein
2. Verlegung, 24. Oktober 2011: Büttelborn, Weiterstädter Str. 12, Familie
Leopold Hirsch
3. Verlegung, 22. Februar 2012: Klein-Gerau, Hauptstr. 14, Familie
Gottschall
4. Verlegung, 3. Juli 2012: Büttelborn, Schulstr. 34, Betty Seelig;
Büttelborn, Darmstädter Str. 19, Familie Sigmund Seelig
5. Verlegung, 24. Juni 2013: Büttelborn, Mainzer Str. 1, Familie
Sigmund Hirsch
6. Verlegung, 19. Februar 2014: Klein-Gerau, Hauptstr. 32, Familie
Kugelmann/Hirsch
7. Verlegung, 4. Februar 2015: Worfelden, Unterdorf 33 und 34,
Familien Kahn/Mann
8. Verlegung, 25. Oktober 2018: Büttelborn, Ludwigstr. 14, Familie
Grünewald
9. Verlegung 26. Oktober 2019: Worfelden, Borngasse 13 und Neustr. 30,
Familien Kahn. |
| |
| November 2009:
Initiative für die Verlegung von
"Stolpersteinen" in Büttelborn |
Artikel in "Echo-Online.de" vom 1.
Dezember 2009 (Artikel,
dirk):
"Erinnerung an die Opfer - Stolpersteine: Büttelborn will im kommenden Frühjahr mit der Arbeit beginnen - Grundsatzentscheidung steht.
BÜTTELBORN. Sechs Millionen. So viele Menschen jüdischen Glaubens hat das Hitler-Regime in seinem Rassenwahn ermorden lassen. Es ist eine riesige, unvorstellbare Zahl. Doch sechs Millionen Opfer bedeuten ebenso viele Einzelschicksale. Beschäftigt man sich mit diesen Lebensgeschichten, bekommt der Holocaust ein Gesicht.
'Gerade für junge Leute ist das unheimlich spannend', sagte Hans-Jürgen Vorndran im Büttelborner Kulturausschuss..." |
| |
| März 2011: Erste "Stolpersteine"
wurden in Büttelborn verlegt |
Artikel - unter Übernahme eines Artikels
aus dem "Groß-Gerauer Echo" vom 1. April 2011 aus der Website
der Gemeinde Büttelborn (Seite
zur Verlegung): "Erste Stolpersteine gegen das Vergessen verlegt.
800 Jahre Gemeinde Büttelborn.
Das Gross-Gerauer Echo schreibt (Artikel
von Marvi Mensch, Link zum Artikel):
'Ich wohne in einem Judenhaus', erklärte Ulrich Trumpold am Mittwoch als
Eigentümer des Anwesens Mainzer Straße 10. Beim Hauskauf vor mehr als
drei Jahrzehnten erfuhr er vom Schicksal der früheren Bewohner...". |
| |
| Eingestellt: Rede
von Dr. Ulrich Trumpold zur Verlegung der "Stolpersteine" in
Büttelborn als pdf-Datei |
| |
|
Oktober 2011:
Verlegung von Stolpersteinen in Büttelborn:
Flyer
zur Verlegung von "Stolpersteinen" am 24. Oktober 2011 in
Büttelborn (in etwas reduzierter Qualität)
Link
zum Flyer in höherer Auflösung (4 MB) |
| |
Vorbericht
zu Verlegung der "Stolpersteine" in "Echo-online.de" vom 22. Oktober
2011: "Gedenken an die Familie Hirsch. Gedenken: Künstler
Gunter Demnig verlegt am Montag in Büttelborn fünf
Stolpersteine..."
Link
zum Artikel. |
Fotos zur "Stolpersteine"-Verlegung
in Büttelborn am 24. Oktober 2011
(Fotos: Hahn)
Pressebericht von Marvi Mensch in "Echo-online.de" vom
25. Oktober 2011: "Büttelborn - Wo Schicksale sichtbar werden.
Gedenken: Gunter Demnig verlegt in Büttelborn für die Familie Hirsch
fünf weitere Stolpersteine gegen das Vergessen..."
Link
zum Artikel - auch eingestellt als pdf-Datei |
 |
 |
 |
 |
|
Die
"Stolpersteine" wurden vor dem ehemaligen Haus der
Familie Leopold Hirsch und Johanna geb. Bruchfeld verlegt |
Zahlreiche
Interessierte waren zur Verlegung
der "Stolpersteine" erschienen |
|
| |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
| Gunter Demnig bei
der Verlegung der "Stolpersteine" |
Nach der Verlegung |
|
|
| |
|
|
|
|
| Juli 2012: Weitere
"Stolpersteine"-Verlegung |
| Am 3. Juli 2012 wurden
"Stolpersteine" verlegt vor den Häusern Betty Seelig
(Schulstraße 34) und Sigmund Seelig (Darmstädter Straße
19). |
| |
| Juni 2013: Weitere
"Stolpersteine"-Verlegung |
Am 24. Juni 2013 gab es eine weitere
Verlegung von "Stolpersteinen" in der Mainzer Straße 1 für die
dort früher lebende Familie Hirsch.
Links zu Presseartikeln:
http://www.echo-online.de/region/gross-gerau/buettelborn/Die-Spur-verliert-sich-in-Amerika;art1235,4058174
http://buettelborn.de/magazin/artikel.php?artikel=3607&type=&menuid=194&topmenu=194
(auch eingestellt
als pdf-Datei) |
| |
|
Oktober 2018:
Weitere "Stolpersteine"-Verlegung
|
Artikel in "echo-online.de" vom Oktober
2018: "Stolpersteine in der Büttelborner Ludwigstraße verlegt
In der Ludwigstraße 14 erinnern acht Quader nun an die von den Nazis
gedemütigten, zur Flucht gezwungenen sowie deportierten Mitglieder der
jüdischen Familie Grünewald aus Büttelborn.
BÜTTELBORN - Weithin waren die Hammerschläge zu hören, mit denen der
Kölner Künstler Gunter Demnig am Donnerstag acht Stolpersteine wider das
Vergessen festklopfte: Vor dem Haus an der Ludwigstraße 14 erinnern die
Quader nun an die von den Nazis gedemütigten, zur Flucht gezwungenen sowie
deportierten Mitglieder der jüdischen Familie Grünewald aus Büttelborn.
Zur Familie gehörten Sigmund Grünewald und seine Frau Amalie ('Malchen')
sowie an deren Kinder Lina, Henni, Jakob, Erna und Betty und die 1937 erst
zweijährige Ruth Grünewald. Das Gedenken an die Büttelborner ist nun am Ort,
von dem sie 1938 unter grauenhaften Umständen fast ohne Hab und Gut flüchten
mussten, manifestiert.
'Vergangenheit vergeht niemals'. Es war die letzte
Stolpersteinverlegung in der Kommune, mit der hier seit 2011 gemeinsam mit
dem Förderverein Jüdische Geschichte und Kultur im Kreis sowie dem Dekanat
zwölf Familien der Kerngemeinde, Klein-Geraus und Worfeldens gedacht wurde.
'Am Rande der Gesellschaft gibt es heute Bewegungen, die die
Stolpersteinverlegung umso wesentlicher machen', sagte Bürgermeister Andreas
Rotzinger (CDU) zu den versammelten Bürgern sowie Paten der Stolpersteine.
'Wir verlegen hier Steine für die Opfer der Nazis – doch zu den Opfern
gehörten auch Täter. Es gab keine Stunde Null, die Tätergeschichte geht
weiter. Die zwölf Jahre des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 wirken
nach. Denn Vergangenheit vergeht niemals – nachwachsende Generationen, die
Ausreden nicht mehr akzeptieren, stellen neue Fragen. Was hier geschah war
das ganz normale Pogrom – auf lokaler Ebene', ergänzte Walter Ullrich,
Vorsitzender des Fördervereins Jüdische Geschichte. Landrat Thomas Will
(SPD) schlug ebenfalls deutlich den Bogen in die Gegenwart: 'Dass wir
gedanklich stolpern, das sollen die Stolpersteine bewirken. Menschen wurden
wegen ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Denkweise verfolgt, gefoltert,
ermordet. Heute müssen wir feststellen, dass die Sprache, die damals benutzt
wurde, wieder gesellschaftsfähig wird.' Dagegen müsse jeder Demokrat
aufstehen, müsse stolpern über das, was damals geschah und was heute
geschieht, betonte Will. 'Nie wieder darf es zu dem kommen, was Millionen
Menschen, auch der Familie Grünewald, geschah', so Will. Ulrich Trumpold vom
Förderverein Jüdische Geschichte berichtete vom Leid und Vertreibung der
Familie Grünewald – teils konnte die Familie emigrieren, teils hielt sie
sich versteckt. Tochter Erna, wiewohl mit einem Nichtjuden verheiratet,
wurde 1942 deportiert, ihr Schicksal blieb unbekannt. Petra Kunik von der
jüdischen Gemeinde Frankfurt zitierte eindrückliche Verse aus dem Gedicht
'Steh auf, Abel' von Hilde Domin: 'Wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll
die Antwort, diese einzig wichtige Antwort sich je verändern? Steh auf,
Abel, damit wir es täglich vor uns haben, dieses Ja, ich bin hier.' Zum
Abschluss sprach sie das jüdische Totengebet und bat um Schutz für die
Seelen der Verstorbenen. Stolpersteinpaten und Gäste legten weiße Rosen auf
die golden schimmernden Steine vorm Haus Nummer 14."
Link zum Artikel |
| |
|
April 2019:
Die "Stolpersteine" werden
gereinigt |
Artikel von Marc Schüler in "echo-online.de"
vom 11. April 2019: "Erinnerung an ehemalige jüdische Bürger wach halten
In Büttelborn wurden die Stolpersteine für die Familie Hirsch in der
Weiterstädter Straße von Konfirmanden und vom Förderverein Jüdische
Geschichte und Kultur gereinigt.
BÜTTELBORN - Ein Zeichen gegen das Vergessen setzten der Förderverein
Jüdische Geschichte und Kultur im Kreis Groß-Gerau und die Konfirmanden der
evangelischen Gemeinde Büttelborn am Dienstagnachmittag. Sie reinigten die
Stolpersteine vor dem ehemaligen Haus der Familie Hirsch in der
Weiterstädter Straße 12 und gedachten der vertriebenen Mitbürger. 'In
Büttelborn und Klein-Gerau haben wir im vergangenen Oktober die letzten
Stolpersteine verlegt, in Worfelden werden wir voraussichtlich im kommenden
Oktober vor den letzten beiden Häusern die noch fehlenden Stolpersteine
verlegen', erklärte Ulrich Trumpold vom Förderverein. 29 Stolpersteine
wurden seit 2009 in der Gemeinde verlegt, so auch vor dem ehemaligen Haus
der Familie Leopold und Johanna Hirsch. Während ihren Kindern Ferdinand,
Ludwig und Elsie die Flucht in die USA gelang, wurden die Eltern nach
Theresienstadt deportiert und in Auschwitz ermordet. 'Wir haben uns bewusst
dieses Haus als erstes für die Stolpersteinverlegung und -reinigung
ausgesucht, da wir über diese Familie gut informiert sind', erklärte
Trumpold. In einem Brief an ihre Freundin Erika Bopp hatte Elsie Levy
(geborene Hirsch) von ihrer Jugend in Büttelborn und der Flucht in die USA
berichtet. Diesen Brief verlasen die Konfirmanden bei der
Stolpersteinreinigung und erinnerten so an die damaligen Ereignisse. Sie
befassten sich mit Pfarrer Burkhard Lusky mit der Verfolgung und Vertreibung
der jüdischen Bürger und erkannten dabei, dass Ereignisse wie diese damals
auch vor ihrem heutigen Lebensmittelpunkt nicht Halt machten.
'Elsie Levy lebt in St. Louis und ist 102 Jahre alt', berichtete Ulrich
Trumpold. Zur Stolpersteinverlegung 2011 sei ihr Enkel Mike mit seiner
Familie gekommen. Am wichtigsten sei ihnen damals gewesen, dass sich mit dem
damaligen Bürgermeister Horst Gölzenleuchter ein Repräsentant der Gemeinde
offiziell entschuldigt hat. Trumpold: 'Wichtig ist es, der Opfer des
Nationalsozialismus zu gedenken, denn Gedenken hält die Erinnerungen wach.'
Dank der Unterstützung von Paten wurden seit 2009 für 29 ehemalige jüdische
Mitbürger Stolpersteine verlegt. 'Damit ist das Gedenken aber sicher nicht
beendet, vielmehr geht es auch darum uns zu erinnern, damit so etwas nie
wieder passieren kann', sagte Bürgermeister Andreas Rotzinger in seiner
Ansprache. Anschließend machte sich Ulrich Trumpold mit den
Stolperstein-Paten und Konfirmanden an die Reinigung der Gedenksteine.
Danach wurden die Steine noch mit weißen Rosen geschmückt."
Link zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 102. |
 | 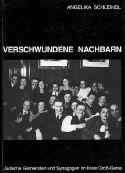 Angelika
Schleindl: Verschwundene Nachbarn. Jüdische Gemeinden und Synagogen
im Kreis Groß-Gerau. Hg. vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 1990 S. 78-87.329. Angelika
Schleindl: Verschwundene Nachbarn. Jüdische Gemeinden und Synagogen
im Kreis Groß-Gerau. Hg. vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 1990 S. 78-87.329. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 155-156. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 101.
|
 |  Friedensgruppe
Büttelborn (Hg.): "Juden sind keine mehr vorhanden". Fünfzig
Jahre nach der Reichspogromnacht. Eine Dokumentation 1990. Friedensgruppe
Büttelborn (Hg.): "Juden sind keine mehr vorhanden". Fünfzig
Jahre nach der Reichspogromnacht. Eine Dokumentation 1990. |
 | 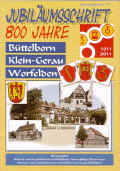 Heimat-
und Geschichtsverein Büttelborn, Heimatpflege Klein-Gerau, Heimat- und
Geschichtsverein Worfelden, Gemeinde Büttelborn (Hrsg.):
Jubiläumsschrift - 800 Jahre Büttelborn - Klein-Gerau - Worfelden. 1211 -
2011. Heimat-
und Geschichtsverein Büttelborn, Heimatpflege Klein-Gerau, Heimat- und
Geschichtsverein Worfelden, Gemeinde Büttelborn (Hrsg.):
Jubiläumsschrift - 800 Jahre Büttelborn - Klein-Gerau - Worfelden. 1211 -
2011.
Darin u.a. für die jüdische Geschichte von Interesse:
S. 46-57: Auswanderung nach Amerika im 19. Jahrhundert.
S. 56-58: Büttelborner Emigranten in der Zeit des Nationalsozialismus (von
Ulrich Trumpold). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Buettelborn Hesse. The community,
numbering 42 (3.5 % of the total) in 1861, had practically disappeared by Kristallnacht,
when the synagogue was vandalized.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|