|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Bergstraße"
Viernheim
(Kreis Bergstraße)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Harry
Siegert, Viernheim)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Viernheim bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts
zurück. Erstmals wird 1609 ein jüdischer Einwohner genannt. Um die
Mitte des 17. Jahrhunderts ließen sich auch jüdische Flüchtlinge aus Wien in
Viernheim nieder (die beiden Familien mit dem späteren Familiennahmen
Sternheimer und Kaufmann). 1713 und 1721 werden gleichfalls Juden
genannt. 1795 lebten bereits zehn jüdische Familien in Viernheim.
Im 19.
Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder
wie folgt: 1806 29 jüdische Einwohner, 1828 60, 1861 114 (3,2 % von insgesamt
3.577 Einwohnern), 1880 115 (2,3 % von 4.912), 1900: 123 (1,7 % von 7.226), 1910
110 (1,2 % von 9.238). Die
jüdischen Familien lebten im 17./18. Jahrhundert fast ausschließlich vom
Viehhandel. Später kam der Tabakhandel dazu. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts
gehörten jüdischen Gewerbetreibenden mehrere für das wirtschaftliche Leben
des Ortes bedeutende Handlungen
und Geschäfte, aber auch Zigarrenfabriken (Heinrich Jakob & Comp., Isaak Weissmann).
An Einrichtungen hatte die Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Religionsschule
sowie ein rituelles Bad (1897 instandgesetzt, siehe Bericht unten). Die Toten
der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Hemsbach
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl.
Stellenausschreibungen unten). An Lehrern
werden genannt: um 1840 Feist Traub, nach 1864 bis 1875 Jacob Gottschall aus Griesheim bei
Darmstadt (danach in Michelstadt), 1890 Lazarus Tannenwald,
vor 1921 bis 1937 Heinrich Loew. Die jüdische
Gemeinde gehörte seit 1895 zum liberalen Rabbinat Darmstadt I.
Im Ersten Weltkrieg
fielen aus der jüdischen Gemeinde Jakob Kaufmann (geb. 4.3.1892 in
Viernheim, gef. 24.8.1914) und Vizefeldwebel Ludwig Weißmann (geb. 26.5.1885 in
Viernheim, gef. 28.3.1918).
Um 1925, als noch 100 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (0,8 % von
insgesamt etwa 12.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde: Hermann
Weißmann, Willi Gernsheimer und Isak Kaufmann. Als Lehrer, Kantor und Schochet
war der bereits genannte Heinrich Loew tätig (noch bis 1937, als er auch die Kinder in Rimbach
unterrichtete). Er erteilte damals sechs Kindern
Religionsunterricht und war zugleich als Mohel (Beschneider) in Viernheim und
Umgebung tätig (siehe Anzeige unten). An jüdischen Vereinen gab es einen
Armenverein, einen
Frauenverein und den Töchterausstattungsverein.
Nach 1933 ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder (1933: 69 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen (Mannheim) beziehungsweise ausgewandert (20). Beim Novemberpogrom
1938 wurde die Synagoge niedergebrannt, aber auch zahlreiche Geschäfte und
Wohnungen jüdischer Familien geplündert und demoliert (u.a. die Wohnung des
jüdischen Lehrers Heinrich Loew in der Hügelstraße 4). SA- und SS-Leute waren
mit Beilen in die Wohnungen eingedrungen. Die nach Mannheim verzogenen
jüdischen Gemeindeglieder wurden bereits im Oktober 1940 nach Gurs deportiert.
Die in Viernheim verbliebenen mehr als zehn, meist alten Menschen wurden im März
beziehungsweise September 1942 in Vernichtungslager nach Polen und nach
Theresienstadt deportiert.
Von den in Viernheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Alice
Engel geb. Weissmann (1893), Emil Fischer (1881), Emilie Fischer (1881), Rosa
Fischer geb. Gernsheimer (1883), Siegmund Gernsheimer (1880), Erna Grünebaum
geb. Kaufmann (1896), Max Herzfeld (1865), Rosa Holzmann geb. Kaufmann (1869),
Bertha Kahn geb. Kaufmann (1871), Alfred Kaufmann (1934), Auguste Kaufmann geb.
Jakobsohn (1864), Elsa Kaufmann geb. Jakob (1907), Moses Kaufmann (1889), Ruth
Kaufmann (1930), Auguste Mayer (1883), Babette Mayer (1878), Ferdinand Siegmund
Mayer (1863), Luzia Mayer (1903), Sara Mayer geb. Speyer (1867), Theodor Mayer
(1881), Wolf Mayer (1883), Hilda (Hildegard) Rosenthal geb. Lublin (1904), Josef
Rosenthal (1936), Hermann Schindler (1922 oder 1924), Sara Schindler geb.
Schiffer (1865), Auguste Schönberger geb. Weißmann (1894), Friederike Seewald
geb. Lublin (1896), Regina Silberthau geb. Sternheimer (1866), Hugo Sternheimer
(1897), Jettchen Sternheimer geb. Herzfeld (1870), Leopold Sternheimer (1859),
Fanny Ullmann (1886), Max Friedrich Ullmann (1882), Minna Ullmann geb. Ullmann
(1882), Hugo Weissmann (1858), Robert Weissmann (1864), Albert (Adolf) Wolf
(1886), Auguste Zehner geb. Schiffer (1897), Selma Zehner (1924).
Am 25. Juni 2013 wurden insgesamt 18 "Stolpersteine"
durch den Künstler Gunter Demnig in Viernheim zur Erinnerung an mehrere der
genannten Personen verlegt. Die "Stolpersteine" liegen an folgenden
Standorten: Spitalplatz (ehemals Spitalstraße 2), Rathausstraße 51 (ehemals Nr. 43),
Hügelstraße 7 (ehemals Nr. 5), Hügelstraße 18, Mannheimer Straße 1/ Ecke Karl-Marx-Straße,
ehemals Mannheimer Str. 9. Weitere zehn "Stolpersteine" wurden am 13.
Juli 2014 verlegt in der Lampertheimer Straße 22 für Johannes und Luise
Lamberth (bis 1933 nichtjüdischer Bürgermeister und seine Frau, gegen NS
eingestellt), in der Molitorstraße 1 für die jüdische Familie Familie
Schindler sowie in der Hügelstraße 4 und 6 für die jüdische Familie Familie Weißmann.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des
Religionslehrers/Vorbeters/Schächters 1876 / 1884 / 1886
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1876:
"Konkurrenz-Eröffnung. Die Stelle eines Religionslehrers,
Vorbeters und Schächters in der hiesigen israelitischen Gemeinde ist
vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 800 bis 1.000
Mark; Akzidenzien ca. 600 Mark nebst freier Wohnung. Lusttragende Bewerber
wollen sich bei dem Unterzeichneten melden. Viernheim, den 19. November
1876. Der Vorstand Lazarus Lublin." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1876:
"Konkurrenz-Eröffnung. Die Stelle eines Religionslehrers,
Vorbeters und Schächters in der hiesigen israelitischen Gemeinde ist
vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 800 bis 1.000
Mark; Akzidenzien ca. 600 Mark nebst freier Wohnung. Lusttragende Bewerber
wollen sich bei dem Unterzeichneten melden. Viernheim, den 19. November
1876. Der Vorstand Lazarus Lublin." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1884:
"Die Viernheimer Religionslehrer-, Schächter- und Vorsänger-Stelle
soll bis zum 1. Januar 1885 neu besetzt werden. Die Stelle trägt
inklusive Nebenverdienste ca. 1.500 Mark ein. Solche, welche das Seminar
besucht und gute Zeugnisse aufzuweisen haben, erhalten den Vorzug. Samuel
Gernsheimer, Vorsteher." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1884:
"Die Viernheimer Religionslehrer-, Schächter- und Vorsänger-Stelle
soll bis zum 1. Januar 1885 neu besetzt werden. Die Stelle trägt
inklusive Nebenverdienste ca. 1.500 Mark ein. Solche, welche das Seminar
besucht und gute Zeugnisse aufzuweisen haben, erhalten den Vorzug. Samuel
Gernsheimer, Vorsteher." |
| |
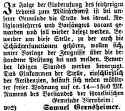 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1886:
"In Folge der Einberufung des seitherigen Lehrers zum Militärdienst
ist bei unserer Gemeinde die Stelle der israelitischen Religionslehrers
und Vorsängers vakant geworden und soll wieder besetzt werden. Bewerber
um diese Stelle, zu der auch die Schächterfunktionen gehören, wollen
sich, unter Vorlage der Zeugnisse über die bestandene Prüfung bei uns
melden. Bewerber ledigen Standes werden bevorzugt. Das Einkommen der
Stelle, einschließlich der Akzidenzien, beläuft sich neben möblierter
freier Wohnung auf ca. 14-1500 Mark. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1886:
"In Folge der Einberufung des seitherigen Lehrers zum Militärdienst
ist bei unserer Gemeinde die Stelle der israelitischen Religionslehrers
und Vorsängers vakant geworden und soll wieder besetzt werden. Bewerber
um diese Stelle, zu der auch die Schächterfunktionen gehören, wollen
sich, unter Vorlage der Zeugnisse über die bestandene Prüfung bei uns
melden. Bewerber ledigen Standes werden bevorzugt. Das Einkommen der
Stelle, einschließlich der Akzidenzien, beläuft sich neben möblierter
freier Wohnung auf ca. 14-1500 Mark.
Namens des Vorstandes der israelitischen Gemeinde Viernheim: Samuel
Gernsheimer." |
Der jüdische Lehrer gerät in den Streit zwischen
orthodoxen und liberalen Gruppen (1855)
Anmerkung: Mitte des 19. Jahrhundert gab es zwischen orthodoxen und
liberalen Richtungen im Judentum immer wieder starke Auseinandersetzungen, die
(z.B. anlässlich der Einrichtung einer Synagoge mit einer Orgel) bis hin zu
Spaltungen in zahlreichen städtischen Gemeinden führten. Aber auch in
kleineren Gemeinden fanden Auseinandersetzungen statt, wie der Fall des
Viernheimer Lehrers zeigt. Nach seiner Entlassung wurde in der liberal
gesonnenen Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" ein
scharfer Artikel gegen die für die Entlassung verantwortlichen orthodoxen
Kreise geschrieben.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom
Januar 1855: "Aus dem Großherzogtum Hessen. - Wieder ist einer
unserer Lehrer, und zwar ein Mann mit zahlreicher Familie, ein Opfer des
zelotischen Eifers und pharisäischen Verfolgungsgeistes geworden - es ist
dieses der zuletzt in Viernheim gestandene Lehrer R...t. Derselbe war der
Unterlassung unbedeutender religiöser Observanzen gerüchtsweise Angeklagte, unter Anderem habe er - für seine kranke Frau! - am Sabbat
eine Suppe kochen lassen. Darauf hin wurde ihm von dem betreffenden
Rabbiner, bei welchem der religiöse Eifer oft das Mitglied überwuchert,
das Schächten untersagt; die betreffende Gemeinde warf ihn in Folge
dessen buchstäblich aus der Schule hinaus, und der arme Mann irrt nun mit
Weib und Kindern brotlos und trostlos umher! - Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom
Januar 1855: "Aus dem Großherzogtum Hessen. - Wieder ist einer
unserer Lehrer, und zwar ein Mann mit zahlreicher Familie, ein Opfer des
zelotischen Eifers und pharisäischen Verfolgungsgeistes geworden - es ist
dieses der zuletzt in Viernheim gestandene Lehrer R...t. Derselbe war der
Unterlassung unbedeutender religiöser Observanzen gerüchtsweise Angeklagte, unter Anderem habe er - für seine kranke Frau! - am Sabbat
eine Suppe kochen lassen. Darauf hin wurde ihm von dem betreffenden
Rabbiner, bei welchem der religiöse Eifer oft das Mitglied überwuchert,
das Schächten untersagt; die betreffende Gemeinde warf ihn in Folge
dessen buchstäblich aus der Schule hinaus, und der arme Mann irrt nun mit
Weib und Kindern brotlos und trostlos umher! - |
Lehrer Heinrich Loew empfiehlt sich das Mohel
(Beschneider) (1924)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924:
"Viernheim, Hessen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924:
"Viernheim, Hessen.
Als geprüfter Mohel empfiehlt sich
H. Loew, Lehrer." |
Lehrer Heinrich Loew sucht einen Zahnarzt für
Viernheim (1926)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 15. April 1926: "Zahnarzt - Existenz.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 15. April 1926: "Zahnarzt - Existenz.
Tüchtigem jungen Zahnarzt (Dr.) ist gute Existenz geboten. Ort 12.000
Einwohner.
Angebote an H. Loew, Lehrer, Viernheim,
Hessen." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Instandsetzung der Mikwe (1897)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1897:
"Viernheim, im Dezember (1897). Den edlen Bemühungen des Herrn
Lehrers Goldschmidt, im Verein mit dem ehemaligen Klausrabbiner Herrn Dr.
Rosenthal aus Mannheim, ist es endlich gelungen, das seit langem in
Verfall geratene rituelle Frauenbad in hiesiger Gemeinde seinem heiligen
Zwecke wieder zu übergeben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1897:
"Viernheim, im Dezember (1897). Den edlen Bemühungen des Herrn
Lehrers Goldschmidt, im Verein mit dem ehemaligen Klausrabbiner Herrn Dr.
Rosenthal aus Mannheim, ist es endlich gelungen, das seit langem in
Verfall geratene rituelle Frauenbad in hiesiger Gemeinde seinem heiligen
Zwecke wieder zu übergeben." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Unteroffizier Ludwig Oppenheimer erhält das Eiserne Kreuz (1915)
 Mitteilung
in "Dr. Blochs österreichische Wochenschrift" vom 22. Oktober 1915: "...
Viernheim. Unteroffizier Ludwig Oppenheimer." Mitteilung
in "Dr. Blochs österreichische Wochenschrift" vom 22. Oktober 1915: "...
Viernheim. Unteroffizier Ludwig Oppenheimer." |
Zum Tod von Adolf Gernsheimer (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921:
"Viernheim (Hessen), 28. April (1921). Adolf Gernsheimer hat am 4.
Pessachtag, kaum 33-jährig, das Zeitliche gesegnet. Wer ihn kannte,
weiß, was wir alle an ihm besessen, was wir alle an ihm verloren. Ein edel
und redlich denkender Mensch, aus einem altehrwürdigen, frommen Hause
stammend, verstand er es von frühesten Jugend an, alle, die ihm näher
getreten, für sich zu gewinnen. Sie alle werden dem ehrlichen braven
Menschen, der bis noch vor wenigen Tagen mit dem stillen Mute der
Entsagung, den nur Gottesfurcht gibt, sein Geschick getragen,
ehrendes Andenken bewahren. Die große Trauerversammlung gab Beweis,
welchen großen Wohltäter und liebevollen Menschen wir zu Grabe getragen.
Herr Lehrer Loew ließ noch einmal das Lebensbild des Verstorbenen in
kurzen Worten an uns vorüberziehen. Seine Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1921:
"Viernheim (Hessen), 28. April (1921). Adolf Gernsheimer hat am 4.
Pessachtag, kaum 33-jährig, das Zeitliche gesegnet. Wer ihn kannte,
weiß, was wir alle an ihm besessen, was wir alle an ihm verloren. Ein edel
und redlich denkender Mensch, aus einem altehrwürdigen, frommen Hause
stammend, verstand er es von frühesten Jugend an, alle, die ihm näher
getreten, für sich zu gewinnen. Sie alle werden dem ehrlichen braven
Menschen, der bis noch vor wenigen Tagen mit dem stillen Mute der
Entsagung, den nur Gottesfurcht gibt, sein Geschick getragen,
ehrendes Andenken bewahren. Die große Trauerversammlung gab Beweis,
welchen großen Wohltäter und liebevollen Menschen wir zu Grabe getragen.
Herr Lehrer Loew ließ noch einmal das Lebensbild des Verstorbenen in
kurzen Worten an uns vorüberziehen. Seine Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens." |
Nach 1945: Todesanzeige von Alfred Lublin (1949 in den
USA)
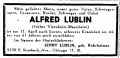 Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 22. April 1949:
"Mein geliebter Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel
Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 22. April 1949:
"Mein geliebter Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel
Alfred Lublin
(früher Viernheim-Mannheim) ist am 15. April nach kurzer, schwerer
Krankheit im Alter von 61 Jahren sanft entschlafen. Im Namen der
Hinterbliebenen: Jenny Lublin geb. Rohrheimer.
5530 S. Kimbark Ave., Chicago 15, Ill." |
Über Max Liebster (1915-2008)
 Artikel
von Harry Siegert im "Viernheimer Tageblatt" vom 29. Juli 2008:
"Gesellschaft: Zeitzeuge Viernheimer Geschichte gestorben. Max
Liebster im Alter von 93 Jahren verstorben. Artikel
von Harry Siegert im "Viernheimer Tageblatt" vom 29. Juli 2008:
"Gesellschaft: Zeitzeuge Viernheimer Geschichte gestorben. Max
Liebster im Alter von 93 Jahren verstorben.
Aix-les-Bains/Viernheim (kt) - Wie erst in diesen Tagen bekannt wurde,
ist in seinem Haus im französischen Kurort Aix-les-Bains ein Zeitzeuge
der Nazizeit in Viernheim, Max Liebster, im Alter von 93 Jahren
gestorben. Max Liebster wurde 1915 in
Reichenbach im Odenwald in eine streng gläubige jüdische Familie
geboren. Bevor er im Jahre 1929 eine Lehre im Textilgeschäft seiner
Cousins Julius und Hugo Oppenheimer in Viernheim begann, besuchte Max
Liebster die Volksschule in Reichenbach..." Zum weiteren Lesen des
Artikels bitte anklicken. |
In der jüdischen Presse fand auch der (nichtjüdische) Lehrer, dann
Schuldirektor Fiedler Beachtung:
Zum Tod des kaiserlichen Schuldirektors a.D. Fiedler (vermutl. bis 1871
Volksschullehrer in Viernheim, 1898)
Anmerkung: Lehrer Fiedler war offenbar bis 1871 als Lehrer in Viernheim
tätig, danach als Direktor der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Rufach,
Oberelsass; im Ruhestand lebte er in Darmstadt. Beachtlich sind seine geradezu
prophetischen Worte über die Antisemitenbewegung (unten kursiv/fett
markiert).
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898: "Darmstadt.
Am 26. August starb an einem Herzschlag im Alter von 72 Jahren der sehr
verdienstvolle und in weiten Kreisen bekannte Schulmann, der kaiserliche
Schuldirektor a.D. Fiedler in Darmstadt. Früher war er Volksschullehrer
in Viernheim bei Mannheim und einer der Mitbegründer des
hessischen Landeslehrervereins. Seine Wirksamkeit auf landwirtschaftlichem
Gebiete veranlasste im Jahre 1871 seine Berufung als Lehrer an die neu
gegründete landwirtschaftliche Lehranstalt in Rufach im
Oberelsass, zu deren Direktor er später ernannt wurde und an der er eine
Reihe von Jahren segensreich wirkte. Nach seiner Versetzung in den
Ruhestand siedelte er nach Darmstadt über, wo er sich jedoch nicht
beschaulicher Ruhe hingab, sondern sich eifrig an gemeinnützigen
Bestrebungen beteiligt. So war er u.a. Vorsitzender des
Volksbildungsvereins und Vorstandsmitglied des Gartenbauvereins, in dem er
häufig Vorträge hielt. Er war ein makelloser Charakter und ehrenhafter
Mann, der aus seiner liberalen Gesinnung niemals ein Hehl machte, weshalb
er zur Zeit der Reaktion unter der Regierung Dalwigks vielfach zu leiden
gehabt hatte. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898: "Darmstadt.
Am 26. August starb an einem Herzschlag im Alter von 72 Jahren der sehr
verdienstvolle und in weiten Kreisen bekannte Schulmann, der kaiserliche
Schuldirektor a.D. Fiedler in Darmstadt. Früher war er Volksschullehrer
in Viernheim bei Mannheim und einer der Mitbegründer des
hessischen Landeslehrervereins. Seine Wirksamkeit auf landwirtschaftlichem
Gebiete veranlasste im Jahre 1871 seine Berufung als Lehrer an die neu
gegründete landwirtschaftliche Lehranstalt in Rufach im
Oberelsass, zu deren Direktor er später ernannt wurde und an der er eine
Reihe von Jahren segensreich wirkte. Nach seiner Versetzung in den
Ruhestand siedelte er nach Darmstadt über, wo er sich jedoch nicht
beschaulicher Ruhe hingab, sondern sich eifrig an gemeinnützigen
Bestrebungen beteiligt. So war er u.a. Vorsitzender des
Volksbildungsvereins und Vorstandsmitglied des Gartenbauvereins, in dem er
häufig Vorträge hielt. Er war ein makelloser Charakter und ehrenhafter
Mann, der aus seiner liberalen Gesinnung niemals ein Hehl machte, weshalb
er zur Zeit der Reaktion unter der Regierung Dalwigks vielfach zu leiden
gehabt hatte.
Fiedler ist auch in Wort und Schrift energisch zugunsten unserer
Glaubensgenossen eingetreten. Namentlich in Hessen hat sein Wort und
Beispiel schön gewirkt. So hat er in der Bezirkslehrerversammlung zu
Darmstadt am 17. Januar 1891 einen Vortrag gehalten über 'die
Antisemitenbewegung in Deutschland in ihren Ursachen und Folgen.'
(erschien in Darmstadt bei H. Schmitt.). Darin heißt es:
'Deutsche Männer aller Bekenntnisse, täuschen wir uns nicht über den
Ernst der Zeit. Die Totengräber des religiösen Friedens sind zugleich
die Totengräber des deutschen Reichs. Und dieser Friede liegt schwer
geschädigt darnieder. Die ersten Spatenstiche zum Grabe desselben sind
bereits aufgeworfen. Und schon stehe der Kondukt, der den Leichenzug des
religiösen Friedens feierlich leiten möchte, marschbereit an den Toren
des Vaterlandes.
Wir können und dürfen nicht zugeben, dass das bereits angefangene Werk
Vollendung findet. Das auf den Schlachtfeldern für Deutschlands Einheit
und Größe geflossene Blut würde gegen uns zum Himmel um Rache
schreien!
Darum ist es Pflicht Aller, deren Väter, Brüder oder Söhne in den
heiligen Kämpfen für Deutschlands Einheit gefallen sind; Aller, die in
jenen furchtbaren Kämpfen mitgerungen haben; Aller, welche die Folgen der
Antisemiten-Bewegung zu überschauen vermögen, dass sie zusammentreten,
um diesen verderblichen Strom in sichere Ufer einzudämmen.
Und wenn manche unter uns sein sollten, welche von Juden Unbilligkeiten
erfahren haben, so mögen sie das eigene Weg vergessen gegenüber dem
Unheil, welches der ganzen deutschen Bevölkerung durch einen Sieg der
Antisemiten droht.'
Aus lauterem Herzen geboren, mögen diese Worte lautere Herzen gewinnen.
Besser kann die Erinnerung an den edlen Mann nicht bewahrt
werden!" |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen jüdischer Zigarrenfabrikanten 1899 und 1904
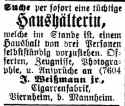 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:
"Suche per sofort eine tüchtige
Haushälterin,
welche
imstande ist, einem Haushalt von drei Personen selbständig vorzustehen.
Offerten, Zeugnisse, Photographie und Ansprüche an
J. Weißmann, jr.,
Zigarrenfabrik, Viernheim bei Mannheim." |
| |
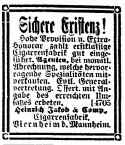 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1904:
"Sichere
Existenz!
Hohe Provision und Extra-Honorar zahlt erstklassige
Zigarrenfabrik gut eingeführt. Agenten, bei monatliche Abrechnung, welche
hervorragende Spezialitäten mitverkaufen. Eventuell Generalvertretung.
Offerten mit Angabe des erreichten Umsatzes erbeten.
Heinrich Jakob
& Comp.,
Zigarrenfabrik, Viernheim bei Mannheim". |
Anzeige von J. Weißmann (1902)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Oktober 1902:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Oktober 1902:
"Für einen Jungen, aus guter Familie, ist eine
Lehrstelle zu vergeben. Näheres
J. Weißmann, Viernheim bei Mannheim." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betsaal in einem jüdischen Privathaus
vorhanden. 1821 beantragte die jüdische Gemeinde bei den Behörden den
Bau einer Synagoge. Die Genehmigung wurde erteilt und eine Synagoge konnte 1826/27
erbaut und im August 1827 eingeweiht werden. Sie war Mittelpunkt bis jüdischen Gemeindelebens bis zur
Zerstörung in der NS-Zeit. Mehrfach wurde sie renoviert und erweitert,
insbesondere 1865, 1902 und zum 100jährigen Bestehen 1927. Aus
der Geschichte der Synagoge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt
ein ungewöhnlicher Berichte aus dem Jahr 1880 vor:
Der Polizeidiener muss für Ordnung
in der Synagoge sorgen (1880)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1880:
"Bonn, 21. März (1880). 'Der Starkenburger Bote' meldet, dass
in Viernheim der gewiss seltene Fall eingetreten, dass ein
Polizeidiener in der Synagoge die Ordnung aufrecht erhalten muss. Es kamen
nämlich daselbst während des Gottesdienstes derartige Ruhestörungen und
Ungehörigkeiten vor, dass auf erhaltene Anzeige sich das Kreisamt zu der
erwähnten Maßregel veranlasst sah, wofür die israelitische Gemeinde den
Polizeidiener besonders honorieren muss. Wegen des angegebenen
Ärgernisses meiden viele Israeliten die dortige Synagoge jetzt
gänzlich." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1880:
"Bonn, 21. März (1880). 'Der Starkenburger Bote' meldet, dass
in Viernheim der gewiss seltene Fall eingetreten, dass ein
Polizeidiener in der Synagoge die Ordnung aufrecht erhalten muss. Es kamen
nämlich daselbst während des Gottesdienstes derartige Ruhestörungen und
Ungehörigkeiten vor, dass auf erhaltene Anzeige sich das Kreisamt zu der
erwähnten Maßregel veranlasst sah, wofür die israelitische Gemeinde den
Polizeidiener besonders honorieren muss. Wegen des angegebenen
Ärgernisses meiden viele Israeliten die dortige Synagoge jetzt
gänzlich." |
Über
die Feier zur Wiedereinweihung der Synagoge mit Rabbiner Dr. Italiener aus
Darmstadt im August 1927 liegen Berichte aus der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 8. September 1927 und aus der "Jüdischen Wochenzeitung
für Kassel, Kurhessen und Waldeck" vom 26. August 1927 vor:
 "Viernheim,
22. August (1927). Am Sonntag beging die israelitische Gemeinde Viernheim das
hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem Festgottesdienst. Nach einer
Begründungsrede des Lehrers Loew hielt Rabbiner Dr. Italiener - Darmstadt die
Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die
dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres
Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto
innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die
Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim. "Viernheim,
22. August (1927). Am Sonntag beging die israelitische Gemeinde Viernheim das
hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem Festgottesdienst. Nach einer
Begründungsrede des Lehrers Loew hielt Rabbiner Dr. Italiener - Darmstadt die
Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die
dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres
Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto
innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die
Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim.
Im Namen der Gemeinde Viernheim erklärte Bürgermeister Lamberth, dass er
eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um an dieser bedeutungsvollen Feier
teilzunehmen. Es sei ihm ein Bedürfnis, den vorbildlichen Beziehungen aller
Konfessionen in der Gemeinde Vierheim Ausdruck zu geben. Kaplan Oestreicher
überbrachte die Glückwünsche zugleich im Namen des Herrn geistlichen Rat
Wolf, der gesamten Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstands und der katholischen
Gemeinde. Er begann in hebräischer Sprache mit dem Psalmwort: "Wenn der
Herr nicht wacht, wacht der Wächter umsonst."
Direktor Benjamin - Darmstadt überbrachte die Glückwünsche des Landesverbands
der Israelitischen Religionsgemeinden Hessens, Syndikus Erwin Baer - Frankfurt
a.M. diejenigen des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
Polizeioberwachtmeister Kühne die der Polizeibehörde, ein Mitglied des
Synagogenrats die der Gemeinde Mannheim, Rektor Mayer - Viernheim überbrachte
die Glückwünsche der Schule.
Prachtvolle Chöre des Klaussynagogenchors, Mannheim, mit Solis des Oberkantors
Eppstein umrahmten weihevoll die Ansprachen.
Zu dieser Feier wurde eine Festschrift, verfasst von Herrn Lehrer Loew -
Viernheim, herausgegeben, die interessantes geschichtliches Material enthält." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 26. August 1927: "Viernheim. Am
Sonntag, den 21. August dieses Jahres, beging die Israelitische Gemeinde
Viernheim das hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem
Festgottesdienst. Nach einer Begrüßungsrede des Lehrers Loew
hielt Rabbiner Dr. Italiener (Darmstadt) die Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die
dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres
Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto
innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die
Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim. Er
schilderte, wie die Schicksale des deutschen Volkes überhaupt im
Weltkriege waren. Er erhob Anklage gegen diejenigen, die den deutschen
Juden die Treue zum Vaterland damit lohnen, dass sie eigens Parteien zu
ihrer Bekämpfung bildeten. Mit dem Gelöbnis, das Andenken unserer Toten
nie zu vergessen, enthüllte er die Kriegergedenktafel. Die Fahnen der
Abordnungen der Kriegerverbände 'Hassia' und 'Teutonia' und des
'Reichsbundes Schwarz-Rot-Gold' senkten sich zu Ehren der Gefallenen.
Im Namen der Gemeinde Viernheim erklärte Bürgermeister Lamberth, dass er
eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um an dieser bedeutungsvollen Feier
teilzunehmen. Möge überall eine solche Verbundenheit unter den Konfessionen,
eine wahre Volksgemeinschaft, herrschen, nur so lässt sich der
Wiederaufbau unseres Vaterlandes durchführen. Kaplan Oestreicher
überbrachte die Glückwünsche zugleich im Namen des Herrn geistlichen Rat
Wolf, der gesamten Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstands und der katholischen
Gemeinde. Er begann in hebräischer Sprache mit dem Psalmwort: 'Wenn der
Herr nicht wacht, wacht der Wächter umsonst.' Einigkeit, Treue und
Nächstenliebe sollen, so wünschte er, die Menschen erfüllen, und
schloss mit der Fürbitte, dass der Herr dieses Gotteshaus schützenh
möge. Regierungsrat Dr. Jann (Heppenheim an der Bergstraße)
überbrachte die Glückwünsche des hessischen Kreisamtes und gab
interessante Einzelheiten aus den Akten des Kreisamtes von vor hundert
Jahren über den Synagogenbau zur Kenntnis, die er eigens aus dieser
Veranlassung hervorgesucht hatte.
Direktor Benjamin - Darmstadt überbrachte die Glückwünsche des
Landesverbandes
der Israelitischen Religionsgemeinden Hessens, Syndikus Erwin Baer - Frankfurt
a.M. diejenigen des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
Polizeioberwachtmeister Kühne die der Polizeibehörde, ein Mitglied des
Synagogenrats die der Gemeinde Mannheim. Rektor Mayer - Viernheim überbrachte
die Glückwünsche der Schule und betonte, dass der Grundstein zu der Harmonie
aller Bekenntnisse in dem gemeinsamen Schulbesucht gelegt wurde. Die
evangelische Gemeinde, deren Vorsitzender wegen auswärtigen Dienst am
Erscheinen verhinderte war, hatte ihre Glückwünsche vorher schriftlich
übermittelt.
Prachtvolle Chöre des Klaussynagogenchors, Mannheim, mit Solis des Oberkantors
Eppstein umrahmten weihevoll die Ansprachen. Mit dem Kaddischgebet
endete die auf die zahlreichen jüdischen und christlichen Teilnehmer
tiefen Eindruck machende Feier.
Zu dieser Feier wurde eine Festschrift, verfasst von Herrn Lehrer Loew -
Viernheim, herausgegeben, die interessantes geschichtliches Material enthältt Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 26. August 1927: "Viernheim. Am
Sonntag, den 21. August dieses Jahres, beging die Israelitische Gemeinde
Viernheim das hundertjährige Bestehen ihrer Synagoge mit einem
Festgottesdienst. Nach einer Begrüßungsrede des Lehrers Loew
hielt Rabbiner Dr. Italiener (Darmstadt) die Festpredigt. Kraft, Stolz und Geduld erfülle den Juden, der der Väter, die
dieses Gotteshaus errichteten, gedenkt. Von ihrer Tat ging um so größeres
Licht aus, als bis damals die Juden von außen unterdrückt und im Ghetto
innerlich verkümmert waren. Oberarzt Dr. Fried - Worms hielt die
Gedächtnisrede für die im Weltkrieg gefallenen Juden der Gemeinde Viernheim. Er
schilderte, wie die Schicksale des deutschen Volkes überhaupt im
Weltkriege waren. Er erhob Anklage gegen diejenigen, die den deutschen
Juden die Treue zum Vaterland damit lohnen, dass sie eigens Parteien zu
ihrer Bekämpfung bildeten. Mit dem Gelöbnis, das Andenken unserer Toten
nie zu vergessen, enthüllte er die Kriegergedenktafel. Die Fahnen der
Abordnungen der Kriegerverbände 'Hassia' und 'Teutonia' und des
'Reichsbundes Schwarz-Rot-Gold' senkten sich zu Ehren der Gefallenen.
Im Namen der Gemeinde Viernheim erklärte Bürgermeister Lamberth, dass er
eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um an dieser bedeutungsvollen Feier
teilzunehmen. Möge überall eine solche Verbundenheit unter den Konfessionen,
eine wahre Volksgemeinschaft, herrschen, nur so lässt sich der
Wiederaufbau unseres Vaterlandes durchführen. Kaplan Oestreicher
überbrachte die Glückwünsche zugleich im Namen des Herrn geistlichen Rat
Wolf, der gesamten Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstands und der katholischen
Gemeinde. Er begann in hebräischer Sprache mit dem Psalmwort: 'Wenn der
Herr nicht wacht, wacht der Wächter umsonst.' Einigkeit, Treue und
Nächstenliebe sollen, so wünschte er, die Menschen erfüllen, und
schloss mit der Fürbitte, dass der Herr dieses Gotteshaus schützenh
möge. Regierungsrat Dr. Jann (Heppenheim an der Bergstraße)
überbrachte die Glückwünsche des hessischen Kreisamtes und gab
interessante Einzelheiten aus den Akten des Kreisamtes von vor hundert
Jahren über den Synagogenbau zur Kenntnis, die er eigens aus dieser
Veranlassung hervorgesucht hatte.
Direktor Benjamin - Darmstadt überbrachte die Glückwünsche des
Landesverbandes
der Israelitischen Religionsgemeinden Hessens, Syndikus Erwin Baer - Frankfurt
a.M. diejenigen des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
Polizeioberwachtmeister Kühne die der Polizeibehörde, ein Mitglied des
Synagogenrats die der Gemeinde Mannheim. Rektor Mayer - Viernheim überbrachte
die Glückwünsche der Schule und betonte, dass der Grundstein zu der Harmonie
aller Bekenntnisse in dem gemeinsamen Schulbesucht gelegt wurde. Die
evangelische Gemeinde, deren Vorsitzender wegen auswärtigen Dienst am
Erscheinen verhinderte war, hatte ihre Glückwünsche vorher schriftlich
übermittelt.
Prachtvolle Chöre des Klaussynagogenchors, Mannheim, mit Solis des Oberkantors
Eppstein umrahmten weihevoll die Ansprachen. Mit dem Kaddischgebet
endete die auf die zahlreichen jüdischen und christlichen Teilnehmer
tiefen Eindruck machende Feier.
Zu dieser Feier wurde eine Festschrift, verfasst von Herrn Lehrer Loew -
Viernheim, herausgegeben, die interessantes geschichtliches Material enthältt |
| Hinweis: Die Abschrift
der genannten Festschrift ist online zugänglich. |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge am
10. November zerstört. Bereits am Vormittag dieses Tages wurde eine
Brandstiftung versucht, die misslang. Am Mittag brachen drei SS-Männer
gewaltsam in die Synagoge ein, raubten Davidstern, Opferstock und silberne
Leuchter, übergossen die Torarollen und andere Kultgegenstände mit Benzin und
entfachten ein Feuer. Die Synagoge brannte völlig nieder. Die Brandruine wurde
wenig später abgebrochen.
Bei den Gerichtsprozessen 1946-1952 auf Grund der Gewaltaktionen gegen
die Synagoge Viernheim vor dem Landgericht Darmstadt wurde nur ein Täter
verurteilt, die übrigen Angeklagten mangels Beweisen freigesprochen.
Das Grundstück der ehemaligen Synagoge lag im
Bereich des heutigen Grundstückes Hügelstraße 5. Ein
Denkmal für die zerstörte Synagoge wurde etwa 200 m von ihrem
Standort am Ende der Hügelstraße angebracht. Im Bereich des
Synagogengrundstückes wurde ein
Neubau (heutiges Wohnhaus Hügelstraße 5) erstellt, der jedoch baulich nichts
mit der ehemaligen Synagoge zu tun hat, von der seinerzeit auch die Grundmauern
geschleift wurden. Genaue Pläne der Bebauung vor 1938 wurden noch nicht
gefunden.
Adresse/Standort der Synagoge: im Bereich des
heutigen Grundstückes Hügelstraße
5
Fotos
| Historische Fotos |
 |
 |
| |
Gemeindevorstand und Lehrer
Loew
im Jahr des Synagogenjubiläums 1927 |
Innenansicht der Synagoge
in
Viernheim |
| |
|
|
 |
 |
 |
Rekonstruktion /
Zeichnung der Synagoge in Viernheim von Harry Siegert (Viernheim) anhand
einer Skizze eines (bereits verstorbenen)
Herrn Fischer, Beschreibungen
(Festschrift Heinrich Loew) und der Erzählungen von Zeitzeugen. |
| |
|
|
Der Standort der ehemaligen
Synagoge
und das Denkmal im Sommer 2007
(Fotos: Harry Siegert, Viernheim) |
 |
 |
| |
Blick auf das
Grundstück der ehemaligen Synagoge. Hinweis: das
heutige
Gebäude Hügelstraße 5 hat nichts mit der ehemaligen Synagoge zu
tun. |
| |
|
 |
 |
 |
Gedenkstein mit
Abbildung der ehemaligen Synagoge und Inschrift: "In dieser Strasse
stand von 1828-1938 die Synagoge
der ehemaligen jüdischen Gemeinde
Viernheim. Sie wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938
zerstört." |
| |
|
|
Neue Tafel des
Gedenksteines
(Foto: Michael Ohmsen,
Aufnahme September 2010) |
 |
| |
Inschrift:
"In der Hügelstraße 5 stand seit 1827 die Synagoge der jüdischen
Gemeinde
Viernheim. Nationalsozialisten zerstörten sie am 10. November
1938". |
| |
|
|
Gedenken an die jüdischen
Familien
Viernheims am Gebäude
der Stadtbibliothek
(Fotos: Michael Ohmsen; Aufnahmen
vom September 2010) |
 |
 |
| |
Die Tafel befindet
sich links des Eingangs in die Stadtbibliothek mit der Überschrift:
"Viernheims jüdische Familien in den 1930er-Jahren. Mit der Diktatur
der
Nationalsozialisten (1933-1945) gab Deutschland die Menschenrecht auf.
Viernheim
verlor seine jüdischen Mitbürger und mit ihnen einen Teil
seiner Tradition und Kultur".
Es folgen die Namen der jüdischen Familien. |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Juni 2013:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Viernheim |
Artikel u.a. in region-bergstrasse.de vom
22. Juni 2013, Link
zum Artikel, weiterer
Link): "Andenken an sechs ermordete jüdische Familien bewahren!
Nachkommen der Weissmann-Familie aus Kalifornien nehmen an der Steineverlegung teil.
Mark und Tara Weissmann sind 'ambassadors of peace and forgivness'.
Die Viernheimer Bevölkerung ist zur Teilnahme an der Stolperstein-Verlegung am kommenden Dienstag herzlich eingeladen
Vor über 70 Jahren ist Henry Weissmann vor den Nazischergen nach Amerika geflohen. Dadurch konnte er sein Leben und das seiner Eltern Siegfried und Erna Weissmann retten. Das KZ ist ihnen erspart geblieben. Andere jüdische Viernheimer Familien konnten sich nicht mehr rechtzeitig ins Ausland absetzen, wurden verhaftet, deportiert, vergast. Genau 73 Jahre nach der Flucht nach Amerika kommt nächste Woche der in Redwood (Kalifornien, USA) lebende Sohn von Henry Weissmann, Mark Weissmann nach Viernheim, in die Heimat seiner Vorfahren.
Im Internet hat er von der Viernheimer Aktion 'Stolpersteine' gelesen und will bei der Verlegung am kommenden Dienstag zusammen mit seiner Frau Tara persönlich dabei sein. Er und seine Frau zeigen sich außerordentlich interessiert, wollen Viernheim und seine Bevölkerung näher kennenlernen, die Beweggründe für die Stolperstein-Aktion wissen und näheres über die Schicksale von anderen jüdischen Viernheimer Familien erfahren. Seine Mutter Carol und sein Bruder Scott sind ebenso berührt von dieser Viernheimer Aktion, können aber leider nicht nach Viernheim kommen. In einer Mail an die Viernheimer Stadtverwaltung heißt es, die Familie schickt Mark und Tara als Botschafter von Frieden und Vergebung
('ambassadors of peace and forgiveness').
Bürgermeister Matthias Baaß freut sich sehr über die Teilnahme von Mark und Tara Weissmann bei der Verlegung der
'Stolpersteine' am kommenden Dienstag: 'Die Anwesenheit von direkten Nachkommen ehemaliger jüdischer Viernheimer Familien verleiht unserer Aktion, dem Gedenken an die ermordeten jüdischen Familien unserer Stadt, eine besondere Tiefe und Bedeutung. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo immer noch viele Menschen judenfeindlich denken, ist Erinnerung außerordentlich wichtig. Wir müssen Flagge zeigen und immer wieder an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnern. Es muss sein! Denn das große Vergessen darf sich in unserer Gesellschaft nicht breitmachen. Viele junge Erwachsene können mit dem Begriff Auschwitz nichts mehr anfangen. Deshalb sind Aktionen wie die Viernheimer Aktion
'Stolpersteine' so wichtig. Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu
wiederholen!'
Mark ist der Sohn von Henry Weissmann. Henry (Heinrich) war Jahrgang 1936 und flüchtete mit seinen Eltern Siegfried und Erna Weissmann 1940 in die USA, zuvor waren sie 1939 nach Steinfurth verzogen. Siegfried war 1938 im KZ Dachau, 1939 musste er sein Anwesen in der Spitalstraße 2 an einen "arischen" Viehhändler verkaufen.
Weitere Informationen: www.viernheim.de:
unter "Stolpersteine".
Ansprechpartnerin: Gisela Wittemann, Tel. 929207-3, E-Mail
bzw. Gisela.Wittemann[et}]viernheim.de |
| |
| Juli 2014:
Neue Formen der Erinnerung über digitale Medien |
Artikel von Kathrin Miedniak im morgenweb.de
(Südhessen morgen) vom 5. Juli 2014: "Museum: Stolpersteine erhalten Platz in Dauerausstellung / Besucher können in E-Book Schicksale jüdischer Familien nachlesen
Blättern im digitalen Geschichtsbuch.
Viernheim. Schnell wischt Gisela Wittemann über den Bildschirm ihres iPads. Eine Berührung mit der Fingerspitze und ein Bild von Jean Lamberth taucht auf. Ein leichtes Tippen auf ein Wort, und ein Glossar öffnet sich mit Erklärungen zur Verfolgung des Viernheimer Bürgermeisters in der NS-Zeit.
'Wir haben schon länger überlegt, wie wir im Museum digitale Medien einbinden können', erzählt die Museumsleiterin.
'Dann ist uns klar geworden, dass sich das Stolpersteine-Projekt
anbietet.' Das Ergebnis ist ein E-Book, in dem die Schicksale von mittlerweile elf jüdischen Familien aus Viernheim nachgelesen werden können..."
Link
zum Artikel |
| |
| Juli 2014:
Weitere Verlegung von "Stolpersteinen" |
Artikel von Kathrin Miedniak im morgenweb.de
(Südhessen morgen) vom Juli 2014: "AvH: Projektgruppe erforscht Leben zweier jüdischer Familien und des Ehepaars Lamberth aus Viernheim / Verlegung neuer Stolpersteine am Sonntag
'Diese Schicksale sind echt heftig'
Viernheim. Es ist das Leben von Sara Schindler, das Marina besonders nahe geht. "Sie ist aus Ostgalizien nach Viernheim gekommen, weil sie dachte, dass sie hier sicher ist", erzählt die Schülerin. Tatsächlich muss die Jüdin 1940 aber aus ihrem neuen Heim in der Molitorstraße fliehen und sucht mit Tochter Augusta in Belgien Unterschlupf. Beide werden entdeckt, in einer Kaserne in Mechelen interniert, nach Auschwitz deportiert und 1942 ermordet. "Das ist sehr traurig", sagt Marina..."
Link
zum Artikel |
| |
|
November 2019:
Erinnerung an den Novemberpogrom 1938 |
Artikel in "Südhessen Morgen" vom 6.
November 2019: "Viernheim. Pogromnacht Gedenkfeier in der Kulturscheune.
Erinnerung an jüdische Schicksale
Viernheim.Ein Zeichen setzen gegen Hass und Intoleranz – dies möchte
die Stadt mit dem Gedenken an die Reichspogromnacht am Samstag, 9. November,
18.30 Uhr, in der Kulturscheune (Satonévri-Platz). Die Feierstunde beginnt
mit dem Glockengeläut aller Viernheimer Kirchen. Mitgetragen wird die
Veranstaltung von dem jüdischen Religions- und Kulturverein 'Schalom', dem
Ausländerbeirat und dem Forum der Religionen. Der jüdische
Religionswissenschaftler Yuval Lapide gestaltet mit Jugendlichen der
Alexander-von-Humboldt-Schule an dem Abend den Gastvortrag. Lapide engagiert
sich europaweit im jüdisch-christlichen Dialog. Die Schülergruppe
beschäftigt sich mit dem Schicksal von Juden, die unter dem Druck des
Nationalsozialismus zur Emigration gezwungen waren.
Heimat und Leben verloren. Eine Viernheimerin, die nicht rechtzeitig
fliehen konnte, ist Dina Weißmann. Ihr wurde 1997 auf Beschluss von
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung ein Straßennamen im Gebiet
Bannholzgraben gewidmet. Die Parlamentarier sahen diesen Beschluss auch als
Beitrag zur Erinnerung an alle Viernheimer, die unter der NS-Diktatur ihre
Heimat und ihr Leben verloren, heißt es in einer Mitteilung der städtischen
Presse- und Informationsstelle."
Link zum Artikel |
| |
|
Januar 2020:
Die "Stolpersteine" werden geputzt
- Öffentlicher Stadtrundgang zu den "Stolpersteinen" zum Holocaust-Gedenktag
|
Artikel im "Südhessen Morgen" vom 20. Januar
2020: "Viernheim. Grüne Jugendgruppe lädt zu Stadtrundgang ein.
Stolpersteine werden geputzt
Viernheim. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags möchte die
Jugendorganisation der Grünen auf die über 200 im Kreis Bergstraße verlegten
Stolpersteine und damit auf die Schicksale der hier beheimateten Juden
aufmerksam machen. 'Die Messingtafeln dunkeln mit der Zeit stark nach',
heißt es in der Ankündigung. 'Darum haben wir uns vorgenommen, die
Stolpersteine in Viernheim zu putzen, damit sie wieder besser wahrgenommen
werden.' Im Anschluss an diese interne Aktion ist am Samstag, 25. Januar,
ein öffentlicher Stadtrundgang geplant. Um 15 Uhr treffen sich die
Teilnehmer vor der Stadtbücherei am Satonévri-Platz. Geschlossen passiert
die Gruppe dann sieben Stationen in der Innenstadt, wobei an jedem dieser
Halte über eine Person oder Familie referiert wird. Die Teilnahme ist
kostenlos. 'Wir gedenken einigen der Viernheimer Opfer des
Nationalsozialismus, deren politische Orientierung oder religiöse
Zugehörigkeit zu ihrer Vertreibung oder ihrem Tod führte', erklärt Laura
Neu, Schatzmeisterin der Grünen Jugend. 'Wir müssen uns das Geschehene auch
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder vor Augen führen,
damit sich so etwas wie der Holocaust nicht wiederholt', betont sie. Allein
in Viernheim seien 70 Stolpersteine verlegt worden, die heute im gesamten
Stadtgebiet an die Namen und Schicksale von NS-Opfern erinnern."
Link zum Artikel |
Artikel von Felix Disson im "Südhessen
Morgen" vom 27. Januar 2020: "Gedenktag Grüne Jugend Bergstraße erinnert
an die Schicksale vom NS-Regime verfolgter Juden / Öffentlicher
Stadtrundgang zu Stolpersteinen. Spur verliert sich im polnischen Ghetto
Viernheim.'Wir als Grüne Jugend haben die Stolpersteine in der
Innenstadt heute geputzt, weil die Messingtafeln mit der Zeit dunkler
werden. Beim Gedenken an den Holocaust geht es vor allem darum, die
Erinnerungen an Schicksale vom NS-Regime verfolgter Juden wachzuhalten und
zu pflegen', sagte Moritz Müller, Sprecher der Grünen Jugend Bergstraße. Bei
einem Rundgang durch die Innenstadt zum 75. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz blickte die politische Jugendorganisation auf
die Schicksale jüdischer Mitbürger. An jeder Station legten die Teilnehmer
zudem eine Rose nieder und baten um einen kurzen Moment des Innehaltens. Die
Idee für die Aktion zum Gedenken an die im Dritten Reich verfolgten Juden
bestand schon seit längerem, wie Sprecher Moritz Müller berichtete: 'Unsere
Beisitzerin Jessica Kruhmann hatte an ihrem Studienort Gießen bereits
ähnliche Stadtrundgänge miterlebt und brachte die Idee ein, im Kreis
Bergstraße ebenfalls einen solchen Rundgang zu organisieren.' Da in
Viernheim bereits 70 Stolpersteine an verschiedenen Orten im Gehweg
eingearbeitet sind, lag es für die jungen Erwachsenen nahe, das Vorhaben in
der Brundtlandstadt zu verwirklichen. Im Vorfeld der Veranstaltung polierten
die Vertreter der Grünen Jugend die aus Messing gearbeiteten Gedenksteine im
Stadtzentrum. Ausgangspunkt war das Mahnmal zur Bücherverbrennung, das sich
vor dem Eingang der Stadtbücherei befindet. Moritz Müller betonte, dass
Erinnerungen an die Opfer des NS-Terrors immer wieder erneuert und gepflegt
werden müssten. Nur so könne man sicherstellen, dass antisemitisches
Gedankengut in Deutschland und Europa nie wieder salonfähig werde. Die rund
30 teilnehmenden Bürger gingen dann durch die Wasserstraße und die Repsgasse,
über die Blauehut- und Hofmannstraße zurück in die Fußgängerzone bis zur
Apostelkirche. Dort endete die Tour nach sieben Stationen.
Nach Dachau verschleppt. In der Blauehutstraße nahm die Gruppe Anteil
am Schicksal der Familie Gernsheimer. Sigmund Gernsheimer, geboren im Jahr
1880, geriet in der Pogromnacht 1938 in die Fänge der Nationalsozialisten
und wurde kurz nach seiner Verhaftung für einige Wochen ins
Konzentrationslager Dachau verschleppt. Daraufhin emigrierten die verwitwete
Lina Gernsheimer und ihr Sohn Sally Anfang März 1939 über Rotterdam per
Schiff in die USA, um nicht genauso wie ihr Onkel Sigmund in ein KZ
verschleppt zu werden. Dabei ließen die beiden auch ihre Tabakhandlung in
Viernheim zurück, die Sally und Sigmund nach dem Tod des 1936 verstorbenen
Wilhelm Gernsheimer trotz der Repressalien des NS-Regimes weiterzuführen
versuchten. Sigmund Gernsheimer kehrte nach seiner kurzen Internierung in
Dachau noch einmal nach Viernheim zurück, wo er sich darum bemühte, das
Tabakgeschäft zu retten. Im März 1942 erfolgte schließlich Sigmund
Gernsheimers Deportation ins polnische Ghetto Piaski, wo sich seine Spur
verliert. Nach mehrjähriger Wartezeit erfolgte schließlich im Jahr 1944 die
Einbürgerung von Sally und Lina Gernsheimer, die somit die amerikanische
Staatsbürgerschaft annahmen. In New York knüpften viele jüdische Emigranten
mit Schicksalsgenossen aus benachbarten Orten oder Regionen schnell
Kontakte. So lernte Sally Gernsheimer dort die aus Heppenheim stammende
Kindergärtnerin Lotte Mainzer kennen, die mit ihrer Familie bereits 1933 ins
Elsass und von dort aus vier Jahre später in die USA emigriert war. Die
beiden heirateten im Oktober 1941 und verbrachten mehr als drei Jahrzehnte
als Ehepaar in New York. Sally starb im Oktober 1973 im Alter von 71 Jahren,
Lotte Gernsheimer im März 1995. Sallys Mutter Lina lebte noch bis Ende der
1950er Jahre in New York, ihr genaues Sterbedatum ist nicht bekannt.
Die Geschichte der Familie Gernsheimer stellt ein Beispiel für die mehr als
140 000 jüdischen Emigranten dar, die vor der Judenverfolgung im Dritten
Reich in die USA flohen und dort eine neue Bleibe fanden. Voraussetzung
hierfür waren in der Regel Verwandte in den Vereinigten Staaten, die dann
bei der Organisation der Einreise und der späteren Einbürgerung Hilfe
leisteten. Im Falle der Familie Gernsheimer war dies Sallys Schwester Nelly,
die bereits 1936 nach der Heirat mit Max Oppenheimer nach New York emigriert
war."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Heinrich Loew: Die israelitische Religions-Gemeinde
Viernheim (Hessen). Festschrift zur Jahrhundertfeier des Synagogenbaues im
August 1927. Viernheim 1927. Abschrift
online zugänglich (interne Seite). |
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 321-324. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 193. |
 | Brigitte Perker: Viernheim zwischen Weimar und Bonn.
Demokratie und Diktatur in einer deutschen Kleinstadt 1918-1949. Hg.
Magistrat der Stadt Viernheim. Viernheim 1988. |
 | Franz Haas: Die Juden in Viernheim. in: 777-1977.
Zwölfhundert Jahre Viernheim. Viernheim 1977 S. 99-108. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 27-28. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 275-277. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Viernheim
Hesse. Jews lived there from the 17th century and established a community
numbering 60 in 1828. Jews prospered in the tobacco and livestock trade. The
community became affiliated with the Liberal rabbinate of Darmstadt. By 1900 the
Jewish population had grown to 123 (2 % of the total). In the wake of the Nazi
boycott campaign, Jews started leaving before Kristallnacht (9-10
November 1938), when stormtroopers burned down the synagogue and organized the
looting or destruction of Jewish property. During the years 1933-39, at least 28
of the 60 Jews in Viernheim emigrated (17 to the United States). Those who
remained were mostly deported in 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|