|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Zu den
Friedhöfen im Regierungsbezirk Schwaben
Augsburg
Jüdische Friedhöfe
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
Siehe Seite zur Synagoge in Augsburg (interner
Link)
Zur Geschichte der jüdischen Friedhöfe in Augsburg
Mittelalterlicher Friedhof
In Augsburg hatte bereits die mittelalterliche jüdische Gemeinde einen Friedhof
(genannt "Judenkirchhof"). Vor und nach den
Verfolgungen 1348 lag dieser außerhalb der Stadt am nordwestlichen Rand der
Frauenvorstadt westlich der am Heilig-Kreuz-Kloster vorbeiführenden Straße,
nahe dem Scheitelpunkt der heutigen Straße "An der Blauen Kappe". Nach der
Ausweisung der Juden aus der Stadt 1438/39 wurde der Friedhof durch die Stadt
konfisziert und abgeräumt. Die Grabsteine wurden zu Bauten am Rathaus
verwendet. Ausführliche Informationen zu diesem Friedhof im nachstehenden
Beitrag von Yehuda Shenef:
 Eingestellt
im Oktober 2011: Eingestellt
im Oktober 2011:
Beitrag (englisch) von
Yehuda Shenef (Jüdisch-Historischer Verein Augsburg) über den
mittelalterlichen "Judenkirchhof" in Augsburg:
"When even cedars fall in flames". Some explanatory notes on
history and remnants of the Medieval Jewish Cemetery of Augsburg called Judenkirchhof
by Yehuda Shenef. 48 p. Augsburg 2006/2011.
(online
eingestellt als pdf-Datei) |
| |
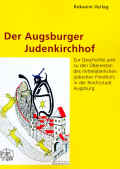 Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu
den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der
Reichsstadt Augsburg.
Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu
den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der
Reichsstadt Augsburg.
Kokawim-Verlag Augsburg 2013. 176 S. 29,50 €. ISBN-13:
978-3944092-01-0.
vgl. unten in der Literaturliste. |
Friedhof des 19./20. Jahrhunderts im Stadtbezirk Hochfeld
Ab 1806 konnten sich Juden wieder in
Augsburg niederlassen. Ihre Toten wurden zunächst auf dem jüdischen Friedhof
in Kriegshaber
beigesetzt, bis 1867 ein eigener jüdischer Friedhof in Augsburg angelegt werden
konnte. Auf ihm wurde auch eine Leichenhalle erstellt (nach 1945 durch einen
modernen Neubau ersetzt). Der Friedhof ist bereits vor und in der NS-Zeit
mehrfach geschändet worden (1924, 1930, 1935). Er ist von einer Backsteinmauer
umgeben. Das Haupttor befindet sich an der Haunstetter Straße; ein weiteres Tor
am Alten Postweg. Der Friedhof wird bis zur Gegenwart von der Augsburger
Jüdischen Gemeinde belegt. An der linken Mauer befindet sich seit 1920 die
Gedenkstätte
für die gefallenen jüdischen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Weitere
Gedenksteine erinnern an die in der NS-Zeit ermordeten Juden der Stadt.
Einweihung
eines Gefallenendenkmals auf dem Israelitischen Friedhof (1920)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. August
1920: "Augsburg, 1. August (1920). Am Freitag, den
30. Juli (1920), wurde auf dem hiesigen Israelitischen Friedhof in der
Haunstetter Straße dem Gemeindevorstand das Denkmal übergeben,
welches zu Ehren der im Kriege gefallenen Augsburger israelitischen
Mitbürger von der Gemeinde erstellt worden ist. Durch Herrn Architekt
Julius Th. Schweighart ist in sehr glücklicher Form die Anordnung
getroffen worden, dass auf dem Friedhof selbst gewissermaßen ein
Kriegerehrenfriedhof geschaffen wurde. Die Grabstätten der nach der
Heimat übergeführten Gefallenen, die in einer Ehrenreihe hier ihre
letzte Ruhe gefunden haben, wurden räumlich durch eine Hecke in einen
kleinen stimmungsvollen Innenhof zusammengefasst. In diesem fand auch das
Denkmal zu Ehren der sämtlichen 24 gefallenen Gemeindemitglieder
Aufstellung. Zwei kräftige Steinpfeiler bilden die Zugangspforte zu der
Anlage. Diese ist einheitlich aus Tuffstein hergestellt, nur die
Gedenktafeln sind aus Treuchtlinger Marmor. Der bildhauerische Schmuck ist
von Herrn Prof. Kindler (München), die Ausführung erfolgte durch Steinmetzmeister
Brenner in Göggingen, die Bronzeschrift stammt aus den Werkstätten
des bekannten Augsburger Meisters Rehle. Die Leitung der
Ausführung oblag unserem Augsburger Architekten Herrn Julius Th.
Schweighart. Durch eine einfach Gedenkfeier wurde das Denkmal seiner
Bestimmung übergeben. Es kann in seiner Schlichtheit als
Segenswürdigkeit Augsburgs bezeichnet werden." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. August
1920: "Augsburg, 1. August (1920). Am Freitag, den
30. Juli (1920), wurde auf dem hiesigen Israelitischen Friedhof in der
Haunstetter Straße dem Gemeindevorstand das Denkmal übergeben,
welches zu Ehren der im Kriege gefallenen Augsburger israelitischen
Mitbürger von der Gemeinde erstellt worden ist. Durch Herrn Architekt
Julius Th. Schweighart ist in sehr glücklicher Form die Anordnung
getroffen worden, dass auf dem Friedhof selbst gewissermaßen ein
Kriegerehrenfriedhof geschaffen wurde. Die Grabstätten der nach der
Heimat übergeführten Gefallenen, die in einer Ehrenreihe hier ihre
letzte Ruhe gefunden haben, wurden räumlich durch eine Hecke in einen
kleinen stimmungsvollen Innenhof zusammengefasst. In diesem fand auch das
Denkmal zu Ehren der sämtlichen 24 gefallenen Gemeindemitglieder
Aufstellung. Zwei kräftige Steinpfeiler bilden die Zugangspforte zu der
Anlage. Diese ist einheitlich aus Tuffstein hergestellt, nur die
Gedenktafeln sind aus Treuchtlinger Marmor. Der bildhauerische Schmuck ist
von Herrn Prof. Kindler (München), die Ausführung erfolgte durch Steinmetzmeister
Brenner in Göggingen, die Bronzeschrift stammt aus den Werkstätten
des bekannten Augsburger Meisters Rehle. Die Leitung der
Ausführung oblag unserem Augsburger Architekten Herrn Julius Th.
Schweighart. Durch eine einfach Gedenkfeier wurde das Denkmal seiner
Bestimmung übergeben. Es kann in seiner Schlichtheit als
Segenswürdigkeit Augsburgs bezeichnet werden." |
Lage des Friedhofes
Im südlichen Stadtrandbezirk "Hochfeld" an der
Haunstetter Straße.

|
Lage des jüdischen Friedhofes
in Augsburg auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und über das
Verzeichnis der "Behörden und öffentl. Einrichtungen" zu
"Friedhof, israel. (Alter Postweg)". |
Cemetery Documentation / Dokumentation des Friedhofes
| Jewish Cemetery Augsburg at Haunstetter Strasse:
|
| |
 Neu in 2018: JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on
original vital records 1867 - 1940s.
Neu in 2018: JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on
original vital records 1867 - 1940s.
Researched and displayed by Rolf Hofmann and Herbert Immenkötter.
2018. Als e-book zum
Download eingestellt (18 MB) |
Fotos
(Fotos von Rolf Hofmann; Aufnahmen vom März 2011 und - Aufnahmen
mit Schnee - vom Januar 2015)
 |
 |
 |
In der Mitte Grabstein
für
Josef Heilbronner und
Fanny Heilbronner geb. Levi (S13/9),
rechts für Max Dick (S13/10) |
Grabstein
für Selma Stiel geb. Strauss
(S50/8), rechts dahinter für
Ludwig Epstein mit Gedenkinschrift
für seine Frau Hedwig Epstein
geb. Gunz (S51/8) |
Grabstein
rechts für Hermann Heilbronner
(N2/4), Mitte für Isak Herzfelder und
Luise Herzfelder geb. Loewenbach (N2/3),
links für Abraham Strauss und
Lina Strauss geb. Bauer (N2/2) |
| |
| |
|
|
 |
  |
 |
Grabstein für Ludwig
Bauer,
Ernestine Bauer geb. Eisenberg
und ihr Sohn Max Bauer (S42/9)
(Foto in
höherer Auflösung) |
Grabsteine für
Jacob Waitzfelder (geb. 1844
in Mönchsdeggingen-1903) und Deborah
Waitzfelder geb. Oettinger (geb. 1854 in
Thalmässing) (N3/2), rechts davon
für
Sigmund Reis und Sofie Reis geb. Gallinger
(N3/3) |
Grabstein für Heinrich
Schwarz
(S46/5)
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein für Josef
Heilbronner und
Fanny Heilbronner geb. Levi (S13/9) |
Grabstein für Thea Dann geb.
Stein
und Ludwig Dann (N6/5) |
Großer Palmzweig
auf Grabstein-Obelisk |
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein für Laura Polatschek
(1900-1922, N34/7) |
Grabstein für Abraham Strauss
und
Lina Strauss geb. Bauer (N2/2) |
Grabstein für Emma Bendel
geb. Gunz (S25/3) |
| |
|
|
 |
 |
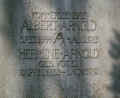 |
Grabinschrift für
Grete Arnold
(1889-1941) und Arthur Arnold
(1880-1941 im KZ Dachau) |
Grabinschrift für Julius
Fuchs und
Emma Fuchs geb. Freundlich (N11/3) |
Grabinschrift für
Kommerzienrat
Albert Arnold, Hermine Arnold geb. Vogel
und Dr. Friedrich Dessauer (S41/2a) |
| |
| |
|
|
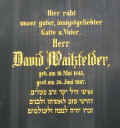 |
 |
 |
Grabstein für David
Waitzfelder
(1843-1897, N10/6) |
Grabstein für Amson Model
(Name in hebräisch) (N19/12) |
Grabstein für Oskar Lustig
(1896-1942;
im KZ Buchenwald umgekommen) |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein für Gitta Kleeblatt
geb. Victor
(geb. 1878 in Burghaun, gest. 1940
in Kempten im Allgäu (N46/14) |
Grabstein für Berta Kutz
geb. Höchstädter und
Hirsch Kutz (N35/5) |
Grabstein für Caroline Kahn
geb. Kohn
aus Paris (geb. in Steppach, gest.
in Göggingen (N17/6) |
| |
|
|
 |
  |
 |
Grabstein für Rosa
Heymann
geb. Lang (1866-1928) und
Albert Heymann (1859-1929) |
Grabstein links
für Alexander Neuburger
(1843-1906) und Betty Neuburger geb.
Binswanger (1855-1920) mit
Gedenkinschrift für Otto und
Lilly Neuburger (1942) |
Grabstein für Benno
Heymann
(1848-1900) und Ida Heymann
geb. Feistmann (1855-1942) |
| |
|
| |
|
|
 |
  |
 |
Grabsteine für Bernhard Blumgart
(gest.
1900) und Sarah Blumgart (gest. 1890) |
Grabstein für David Feist
(1838-1881)
und Julie Feist geb. Gunz (1848-1918) |
Grabstein für Gustav
Oberndorf,
Amerikanischer Konsul (1843-1906) |
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein
links für Hermann Höchstädter
(1879-1965) und Amalie Höchstädter
geb. Bach (1891-1982), rechts für
Walter Höchstädter (1914-2007) |
Kindergräber: vordere
Reihe Mitte
Grabstein für
Robert-Max Landauer (1912) |
Grabstein für
Mieczysław Pemper
(1920-2011), Ehrenbürger der Stadt
Augsburg, weitere Informationen zur Person
s. Wikipedia-Artikel
"Mieczysław Pemper" |
| |
| |
|
|

 |

 |
 |
Grabstein für den Publizisten
Ernst Cramer (1913-2010)
und Marianne Cramer geb. Untermayer
(1916-2008), vgl. Wikipedia-Artikel |
Grabstein für Mieczyslaw
Pemper
(1920-2011), Ehrenbürger der Stadt Augsburg
vgl. Wikipedia-Artikel |
Oben: Schäden des
Zweiten Weltkrieges
an vielen Grabsteinen
|
| |
|
|

 |
 |
Rosen-/Pflanzendekorationen
auf Grabsteinen
|
Gedenktafel
für namenlose Kindergräber am Eingang zum Friedhof |
| |
| |
|
|
| |
|
|
Ehrenmal für KZ-Opfer auf
dem
Augsburger Westfriedhof |
 |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
Auf dem Augsburger
Westfriedhof gibt es ein Ehrenmal für hier bestattete KZ-Opfer und
Häftlinge, die in Augsburg ums Leben gekommen sind. Viele der ums Leben
gekommenen, bei Bombenangriffen getöteten oder von den
SS-Wachmannschaften ermordeten KZ-Häftlinge sind auf dem Westfriedhof
bestattet. Auf einer der Tafeln des Gräberfeldes stehen Namen von
jüdischen Umgekommenen (Tafel rechts). Informationen nach der Seite www.weltkriegsopfer.de.
Fotos erstellt durch Hubert Joachim im Mai 2008. |
| |
|
|
Einzelne Presseberichte
| März 2010: Leonid
Zamskoy und der jüdische Friedhof an der Haunstetter Straße
|
Artikel von Miriam Zissler in der "Augsburger Allgemeinen" vom
13. März 2010 (Artikel): "Den Gräbern wieder einen Namen gegeben.
1176 Gräber sind auf dem Jüdischen Friedhof an der Haunstetter Straße belegt. Leonid Zamskoy kennt jedes Einzelne. Unzählige Mal ist er die schmalen Reihen abgelaufen, hat die Gräber aufgelistet, einen Plan skizziert. Als der Bauingenieur vor acht Jahren zur jüdischen Gemeinde in Augsburg stieß, gab es keinerlei Unterlagen, kein Belegungsplan, welche sterblichen Überreste sich unter den teilweise verblassten Steinen befinden.
Erste Beerdigung 1886. 1886 wurde die erste Person auf dem lang gezogenen Areal an der Haunstetter Straße beerdigt. Seither sind 1494 Menschen dazugekommen. Doch die Zeit hat an etwa 200 Grabsteinen alle Spuren verwischt. Durch Witterungseinflüsse verwitterten die Schriftzüge auf dem weichen Sandstein. Leonid Zamskoy hat sich auf die Spur nach den Namen gemacht. Die Suche war nicht einfach. Viele Unterlagen der Synagoge wurden während des Zweiten Weltkrieges zerstört.
Der gebürtige Ukrainer kümmert sich mit viel Engagement und Hingabe um die Bauvorhaben der Jüdischen Gemeinde. Für seine Recherchen auf dem Friedhof nutzte er eine Liste der Toten, die 1940 die Nazis erstellt hatten.
'Sie haben alles gründlich untersucht und niedergeschrieben. Familiennamen, Geburts- und
Sterbedaten', erzählt er.
Liste auf Mikrofilm entdeckt. Der Historiker Yehuda Schnepf vom Jüdischen Historischen Verein aus Augsburg hat die Liste auf einem Mikrofilm in einem Archiv entdeckt, berichtet Zamskoy, er selber habe sie ausgewertet. Lückenlos könne er nun mit einem Handgriff bestimmen, wer wo liegt. Waitzfelder neben Strauss oder Binswanger neben
Lautermayer. Manchmal erreichen ihn Anfragen aus dem Ausland. Juden aus den Vereinigten Staaten oder Australien hätten erfahren, dass ihre Vorfahren auf dem Friedhof beerdigt wurden.
'Jetzt kann ich ihnen innerhalb von Minuten sagen, ob das stimmt. Oft mache ich ein Bild von dem Grab und sende es ihnen per
E-Mail', sagt der 53-Jährige.
Zwei- bis dreimal die Woche sieht er auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück nach dem Rechten. Er erhält aber auch Hilfe von städtischen Mitarbeitern. 60 bis 70 Kubikmeter Laub lassen die alten Bäume auf dem Gelände im Herbst fallen.
'Wenn wir die alle alleine beseitigen müssten, dann wäre das eine
Katastrophe', sagt Zamskoy. Außerdem ist er bei allen Beerdigungen anwesend.
'Wir haben im Schnitt 25 im Jahr', sagt er. Das hört sich nicht viel an. Es ist aber viel für die kleine Gemeinde. Rituale müssen eingehalten werden. Wenn ein Jude stirbt, kommt die Chewra Kadischa zusammen. Das ist eine Beerdigungsbrüderschaft. Nach jüdischem Glauben soll niemand einen Vorteil von dem Tod eines Menschen haben. Deshalb kümmern sich ehrenamtliche Helfer um die Toten, waschen sie, kleiden sie in ein einfaches weißes Sterbekleid aus Leinen. Das lauwarme Wasser, das für die Leichenwaschung im Taharahaus benötigt wird, fließt erst seit diesem Winter aus dem Hahn.
'Davor habe ich das Wasser in der kalten Jahreszeit kanisterweise mitbringen müssen', so Zamskoy.
Sanierung kostete 120 000 Euro. Viel Geld und Arbeit hat die Gemeinde in die Sanierung des Gebäudes gesteckt. 1962 wurde es errichtet. Für 120 000 Euro wurden unter anderem das Dach und die Fassade saniert, die sanitären Anlagen erneuert, Warmwasserleitungen installiert. Löcher im blauen Fensterglas hinter dem großen Davidstern trüben den Blick auf das sonst schmucke Gebäude.
'Nach Unruhen in Israel wurden sie im vergangenen Mai eingeworfen', so Leonid Zamskoy. Der Übeltäter musste gut werfen können. Nur die Angehörigen der Verstorbenen erhalten einen Schlüssel. Für Fremde bleibt der Friedhof verschlossen.
Bald wird er gänzlich die Vergangenheit verwahren. Es sind nicht mehr viele freie Grabstätten vorhanden. Ein neues Areal wurde der Gemeinde von der Stadt angrenzend an den Neuen Ostfriedhof in Lechhausen in Aussicht gestellt. Leonid Zamskoy findet diese Lösung gut. Doch noch ist ein wenig Zeit: Rund 150 Mitglieder der jüdischen Gemeinde werden an der Haunstetter Straße ihre letzte Ruhe finden.
Zuletzt wurde der Augsburger Ehrenbürger Ernst Cramer auf dem Friedhof beerdigt. Cramer flüchtete vor den Nazis in die USA, kehrte als Soldat nach Deutschland zurück und lebte später als Publizist und Weggefährte Axel Springers in Berlin. Auf eine Trauerfeier verzichtete er. Seine Eltern und sein Bruder starben im Konzentrationslager. Sie hätten auch keine Trauerfeier gehabt, war seine Begründung.
Bei der Beerdigung zierte nur ein kleines Blechschild das Grab Cramers. Dr. Ernst Cramer stand darauf. Sein Sohn bat Leonid Zamskoy vor der Trauerfeier, den Akademikertitel zu entfernen.
Zamskoy: 'Er sagte mir, dass das sein Vater nicht gewollt hätte. Denn im KZ waren alle Menschen gleich. Ob Akademiker oder
nicht.'" |
| |
|
Juni 2019:
Dokumentation zum jüdischen
Friedhof ist erschienen |
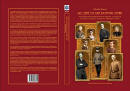 Artikel
von Stefanie Schöne in der "Augsburger Allgemeinen" vom 22. Juni 2019 (Link
zum Artikel): "Geschichte. Was
der jüdische Friedhof zu erzählen hat. Artikel
von Stefanie Schöne in der "Augsburger Allgemeinen" vom 22. Juni 2019 (Link
zum Artikel): "Geschichte. Was
der jüdische Friedhof zu erzählen hat.
Der Historiker Yehuda Shenef erforscht schon lange die jüdischen Friedhöfe
Augsburgs. Jetzt legt er eine Monografie über die 1800 Gräber im Hochfeld
vor.
Grabsteine geben eine Ahnung von der eigenen Endlichkeit und legen spannende
Fährten in die Vergangenheit. Auf den drei jüdischen Friedhöfen in Augsburg
verdichten sich die persönlichen Erinnerungen unzähliger Familien zu
insgesamt 550 Jahren Stadtgeschichte. Sie zeigen das Auf und Ab, Erfolg und
Verfolgung der jüdischen Minderheit über die Jahrhunderte. Mit 150 Jahren
ist die Ruhestätte im Hochfeld die jüngste und derzeit die einzige, die von
der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) betrieben wird. Der mittelalterliche
Friedhof am Eisstadion hat keine Spuren hinterlassen, der in Kriegshaber ist
voll und kann nicht weiter belegt werden.
Hunderte Fotos zeigen den Hochfelder Friedhof. Der Historiker Yehuda
Shenef, der 1995 von Israel nach Augsburg zog, erforschte die Gräber,
Denkmäler, Grabsteinmode und Steinmetze über 20 Jahre. Jetzt hat er bei
Books on demand einen Band über den Hochfelder Friedhof veröffentlicht.
Hunderte Fotos zeigen die jüdischen Familien, von Nationalsozialisten
abgeräumte Kindergräber, Grabinschriften und die von den Bomben der
Alliierten zerstörte Leichenhalle im Zentrum des Friedhofs. Ein
50-seitiges Register der etwa 1800 Gräber, ein alphabetisches Verzeichnis
der Bestatteten sowie ihrer in den Konzentrationslagern ermordeten
Verwandten und 53 Porträts jüdischer Augsburger ermöglichen eine gezielte
Personensuche, laden aber auch ein zu einer Lesereise in die jüngere
Augsburger Stadtgeschichte.
Eine Oase im städtischen Trubel. Das Grundstück selbst hatte Carl von
Obermayer, der damalige Vorsitzende der IKG, Mitte des vorletzten
Jahrhunderts erworben. 1867 lag der Bereich außerhalb der Stadtmauern,
ringsum nichts als Landschaft. Heute ist der nur 40 Meter breite, aber 117
Meter lange Grund eine Oase im städtischen Trubel – im Westen und Osten
eingezwängt zwischen den Verkehrsachsen Haunstetter Straße und Altem
Postweg, im Norden und Süden zwischen Berufsschule und Kleingartenanlage.
Carl von Obermayer (1811-1889) war in Augsburg kein Unbekannter. Die
Generation seines Vaters gründete Bayerns erste Bank mit, finanzierte die
Anfänge mehrerer Textilfabriken in der Lechstadt sowie die Eisenbahnstrecke
nach München. Carl selbst war Kommandant der Augsburger Landwehr, studierte
Militärstrategien kreuz und quer in Europa und den USA, ging beim Berliner
Kaiser- und im bayerischen Königshaus ein und aus.
Eine bayernweit einmalige Synagogenorgel. Als die USA ihn zum Konsul
für Bayern ernannten, richtete Obermayer in seinem heute als Standesamt
bekannten Obermayer-Palais in der Maximilianstraße seinen Amtssitz ein. Kurz
darauf verkaufte er das Haus an den ihm nachfolgenden IKG-Vorsitzenden. 1938
wurde es 'arisiert'. Carl von Obermayer selbst ließ sich allerdings
nicht auf 'seinem' neuen Friedhof, sondern auf dem ebenfalls noch offenen
Kriegshaber Friedhof bestatten. Die Reformgemeinde in Augsburg war ihm – so
schreibt Shenef – mit ihrer bayernweit einmaligen Synagogenorgel, ihrem Chor
und der deutschen Predigt zu modern.
1800 Eintragungen auf dem Hochfelder Friedhof. Insgesamt 13
Obermayers jedoch liegen laut Shenefs umfangreichen Grabregister mit 1800
Eintragungen auf dem Hochfelder Friedhof. Max Obermayer, Carls Cousin,
Grabnummer 168, starb 1886. Im Adressbuch der Stadt wird er als 'Commerzien-Rath,
Bankier, Consul' geführt, er wohnte in der Maximilianstraße, besaß jedoch
auch ein Haus in der Schaezlerstraße. Er war ebenfalls amerikanischer Konsul
und arbeitete in Argentinien, Japan und Belgien. Das Augsburger
Naturkundemuseum verdankt ihm eine Reihe von Mitbringseln aus diesen
exotischen Regionen der Welt.
Mietek Pemper rettete 1000 Juden vor den Gaskammern. Überhaupt
versammelt der Friedhof, auf dem sich zu Beginn auch Münchener beisetzen
ließen, eine Reihe von VIPs: Die Eltern von Fritz Landauer, dem berühmten
Synagogen-Architekten. Landauer selbst floh vor den
Nationalsozialisten nach England, wo er 1968 starb. Für den Hochfelder
Friedhof entwarf er noch mehrere Denkmäler, darunter den Grabstein seiner
Eltern. Nicht mit ihm verwandt, aber gleichen Namens: Samuel Landauer
(1846-1937), Grabnummer 1152. Er war Professor, Linguist und Orientalist.
Laut städtischem Adressbuch lebte er in der Völkstraße 34, 1. Stock. Mietek
Pemper (1920-2011) der zusammen mit Oskar Schindler 1000 Juden vor den
Gaskammern rettete, liegt hier ebenso wie die bekannte Pferdehändlerdynastie
der Neuburgers aus Fischach. Von Salomon Neuburger (1818-1887) ist auf dem
Dachspitz seines Hauses am Perlachberg, Ecke Maximilianstraße, zudem eine
gusseiserne Pferdefigur erhalten.
Grundlagenforschung über den Friedhof. Diese Spuren und Zeugnisse
jüdischen Alltags in Augsburg sichtbar zu machen, das ist das Verdienst von
Shenefs Buch. Der Band ist wegen seiner systematischen Grab- und
Sterberegister nicht nur ein Nachschlagewerk für die in alle Welt
verstreuten Nachfahren der ermordeten oder verjagten Augsburger Juden. Er
zeigt auch das neue jüdische Leben: Im hinteren Drittel des beinah voll
belegten Friedhofs ruht bereits die erste Generation der seit 1991 aus der
Ex-Sowjetunion eingewanderten jüdischen Kontingentflüchtlinge.
Zwar existierten online und in anderen Publikationen bereits Informationen
zu den drei Augsburger Friedhöfen. Auch Grabregister gab es bereits. Yehuda
Shenef, der auch Vorsitzender des Jüdischen Historischen Vereins Augsburg
ist, hat nach seinen insgesamt 13 Publikationen zum schwäbischen Judentum
sowie zum mittelalterlichen Friedhof am Eisstadion (2013) und zum
Kriegshaber Friedhof (2013) jetzt erstmals auch die Grundlagenforschungen
über diese Ruhestätte kompakt zwischen schöne Buchdeckel gepackt." |
Der neue jüdische Friedhof im Neuen Ostfriedhof Lechhausen
Schon mehrere Jahre hatte es sich abgezeichnet, dass der Friedhof an der
Haunstetter Straße voll belegt sein würde. Eine Erweiterung des Friedhofes war
nicht möglich. 2019 konnte die jüdische Gemeinde einen neuen Friedhof in
Lechhausen (Teil des Neuen Ostfriedhofes Lechhausen) feierlich einweihen. Auf
dem neuen Begräbnisplatz können etwa 1000 Gräber angelegt werden.
Der Neue Ostfriedhof ist seit 1952 geplant worden. Er wurde jedoch
erst am14. Februar 1964 eingeweiht. Er umfasst im Endzustand eine Fläche in
insgesamt 22,9 ha. Die erste Beisetzung war am 26. Februar 1964. Der
Haupteingang zum Friedhof ist an der Zugspitzstraße 104. Auf dem Friedhof
besteht neben dem allgemeinen Teil seit 1997 auch ein islamisches Grabfeld
(erste Belegung 1998; das islamische Grabfeld umfasst die Abteilungen 32, 36 und
37; rückseitiger Zugang an der Blücherstraße).
Lage des neuen Friedhofes
Im südlichen Stadtrandbezirk "Hochfeld" an der
Haunstetter Straße.

|
Lage des jüdischen Friedhofes
in Augsburg auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und über das
Verzeichnis der "Behörden und öffentl. Einrichtungen" zu
"Friedhof, Neuer Ostfriedhof". |
Einzelne Berichte
|
Herbst 2019:
Der neue Friedhof wird
eingeweiht
|
 Artikel
von V. Shaykhit und L. Kyrey in "Jüdisches Leben in Bayern" Jg. 24 Nr. 140
vom 19. Dezember 2019 S. 31: "Ein neuer Friedhof..." Artikel
von V. Shaykhit und L. Kyrey in "Jüdisches Leben in Bayern" Jg. 24 Nr. 140
vom 19. Dezember 2019 S. 31: "Ein neuer Friedhof..."
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica III,1 S. 39-65. |
 | Yehuda Shenef: "When even cedarfs fall in
flames...". Some explanatory notes on history and remnants of the
Medieval Jewish Cemetery of Augsburg called Judenkirchhof. 48 p. Augsburg
2006/2011 (online
zugänglich - als pdf-Datei eingestellt). |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens
in Bayern. 1988 S. 229-230. |
 | 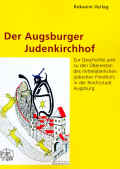 Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu
den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der
Reichsstadt Augsburg. Kokawim-Verlag Augsburg 2013. 176 S. 29,50 €.
ISBN-13: 978-3944092-01-0.
Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenfriedhof. Zur Geschichte und zu
den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der
Reichsstadt Augsburg. Kokawim-Verlag Augsburg 2013. 176 S. 29,50 €.
ISBN-13: 978-3944092-01-0.
Erhältlich über info@sol-service.de
bzw. telefonisch über 08252/881480 und im Buchhandel.
Beschreibung
des Buches auf der Verlagsseite. |
 |
 JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on
original vital records 1867 - 1940s.
JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST - based on
original vital records 1867 - 1940s.
Researched and displayed by Rolf Hofmann and Herbert Immenkötter.
2018. Als e-book zum
Download eingestellt (18 MB) |
 |
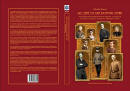 Yehuda Shenef: Die Liebe ist der Dichtung Stern. Der jüdische
Friedhof von Augsburg - Hochfeld. Geschichte, Inschriften, Grabregister,
Biographien, Photos. Hrsg. Jüdisch-Historischer Verein Augsburg. 2019. 200
Seiten. Books on Demand. 35 €. ISBN
978-3752-8565-69. Yehuda Shenef: Die Liebe ist der Dichtung Stern. Der jüdische
Friedhof von Augsburg - Hochfeld. Geschichte, Inschriften, Grabregister,
Biographien, Photos. Hrsg. Jüdisch-Historischer Verein Augsburg. 2019. 200
Seiten. Books on Demand. 35 €. ISBN
978-3752-8565-69. |



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
|