|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"
Zur Seite über die jüdische Geschichte /
Synagogengeschichte in Ansbach
Zur Seite über den jüdischen Friedhof in
Ansbach
Ansbach (Mittelfranken)
Texte zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Ansbach wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte ergänzt. Neueste Ergänzung vom
4.9.2014.
Übersicht:
 | Allgemeine Berichte zur
Geschichte der jüdischen Gemeinde
- Juden
können als "nur geduldete Einwohner" nicht zu den städtischen
Wachtdiensten herangezogen werden (Bericht über Dokumente von 1805; Beitrag
von 1914)
- Früher
Bericht zur jüdischen Geschichte in Ansbach (1842) |
 | Zur
Geschichte des Rabbinates in Ansbach
- Aussichten auf erneute Besetzung des Rabbinates Ansbach nach
Rabbiner Moses Hochheimer
(1838)
- Feierliche Amtseinsetzung von
Rabbiner Aron Bär Grünbaum am 12. Juli 1841
- Aufteilung des Rabbinatsdistriktes Ansbach und Ernennung von Rabbiner Aron
Grünbaum (1842)
- Zum 70. Geburtstag von Distriktsrabbiner Aron Grünbaum
(1882)
- 50-jähriges Dienstjubiläum des Distriktrabbiners Aron Grünbaum (1891)
- Beerdigungsfeier für den verstorbenen Distriktsrabbiner Aron Grünbaum
(1893)
- Nachruf
auf Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1893)
- Zur anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Februar
1894)
- Zur
anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Mai 1894)
- Rabbiner
Dr. Pinchas Kohn wurde zum neuen Rabbiner in Ansbach gewählt (1894)
- Feierliche Vereidigung von Distriktsrabbiner Dr. Pinchas Kohn
(1895)
- Bezirksrabbiner Dr.
Pinchas Kohn weist einen Ruf
nach Nürnberg zurück und bleibt der Gemeinde in Ansbach treu
(1908)
- Dr.
David Brader wurde zum Distriktsrabbiner gewählt (1917)
- Rundschreiben
von Rabbiner Dr. Pinchas Kohn (1919)
- Ausschreibung der Stelle des Distriktrabbiners (1925)
- Feierliche Amtseinführung des
Distriktrabbiners Dr. Elie Munk
(1926)
- Geburtsanzeige der Tochter von Rabbiner Dr. Elie Munk
und seiner Frau Fanny geb. Goldberger (1928)
- Publikation
von Rabbiner Dr. Elie Munk (1933)
- Artikel von Rabbiner Dr. Elie Munk über Pijutim (1937) |
 | Aus
der Geschichte der jüdischen Lehrer, der Kantoren und der Schule
- Jüdische Lehrer und Kantoren
- Ausschreibung
der Stelle des Vorsängers und Schochet (1846)
- Lehrer
H. Hofmann kommt aus Cronheim nach Ansbach - Ausschreibung der Stelle in
Cronheim (1876)
- Ausschreibung
der Stelle des Kantors und Schochet (1893)
- Zum
Abschied von Maier Sternberger, 1856-1893 Kantor, Schochet und Mohel in der
Gemeinde
- Zum Tod von Maier
Sternberger (1901 in Harburg)
- Zum Tod des
Lehrers H. Hofmann (1894)
- Kantor
Simon Krämer empfiehlt sich auch als Mohel (Beschneider, 1893)
- 70.
Geburtstag von Kantor Simon Krämer (1928)
- Lehrer
Simon Dingfelder verlässt Ansbach (1904)
- Zu
Lehrer Nathan Adler: 1904-1923 Lehrer in Ansbach (Rückblick 1938)
- Ausschreibung
der Stelle des Kantors und Schochet (1923)
- Jüdische Schulen
- Seit
1844: das Handels-Lehr-Institut des Gabriel Kitzinger
Ausschreibung
1846 - Ausschreibungen 1847/1859
- Erweiterung
des Instituts um eine Unterrichts- und Erziehungsanstalt (1865)
Anzeige
von Lehrer N. Hausmann (1872)
- Hinweis
auf eine frühere Jeschiwa = Talmud-Hochschule in Ansbach (1866)
|
 | Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
- Unterstützung
für die Armen der israelitischen Kultusgemeinde (1920)
- Gemeindewahlen (1927)
- Simchat-Tora-Feier
der "Jüdischen Jugend Ansbach" (1931)
- Vortragsabend
des Vereins "Jüdische Jugend Ansbach" (1931)
- Vortrag
über eine Reise ins Heilige Land (1935)
|
 | Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
- Advokat
Dr. Samuel Berlin ist beim Schwurgericht in Ansbach tätig (1850)
- Zum Tod des königlichen
Hofrates Dr. Samuel Berlin (1897 in Fürth, war bis 1876 Rechtsanwalt in
Ansbach)
- Dr.
Obermaier aus Ansbach wird königlicher Advokat (Rechtsanwalt, 1852)
- Artikel
über Dr. Marcus Elieser Bloch aus Ansbach - ein Erforscher der Fischwelt
vor 100 Jahren - von Richard Lesser (Artikel von 1880)
- Zum Tod von Bernhard
Mahler (1908)
- Zum Tod
des aus Ansbach stammenden
Rabbiners Henry Hochheimer (1912)
- Zum Tod von Eduard
Kupfer (1918)
- Zum
Tod des Kempener Rabbiners Dr. Lazar Münz in Ansbach (1921)
- Goldene
Hochzeit von Isidor und Babette Asch (1928)
- Zum
Tod von Joseph Heilbrunn, langjähriger Kassier der Gemeinde (1929)
- Zum
70. Geburtstag von Jakob Weil, ehemaliger Gemeindevorsteher und Stadtrat
(1929)
- Zum
60. Geburtstag des Gemeindevorstehers Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer
(1930)
- Zum
Tod von Anton Michelsohn, langjähriger Vorsteher der Chewra Kadischa (1931)
- Zum
70. Geburtstag von Leo Stein, langjähriges Verwaltungsmitglied der
jüdischen Gemeinde (1935)
- Der
langjährige Gemeindevorsteher Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer zieht nach
Nürnberg (1936) |
 | Sonstige Mitteilungen
- In
Ansbach gibt es noch eine Landjudenschafts- und Stiftungskasse (1847)
- Antijüdische
Äußerungen eines Pfarrers (1870)
- Diskussion
in der Kirchensynode zur Frage, ob für die "Bekehrung der
Israeliten" in den Kirchen gebetet werden sollte (1885)
- Neunte
freie Konferenz der bayerischen Rabbiner in Ansbach (1904)
- Über
einen Toraschreinvorhang aus Ansbach (1908)
- Bezirkstagung
der mittelfränkischen Aguda-Gruppen in Ansbach am 1. Mai 1921
- Verbandstagung
des Bayerischen Verbandes gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine in der
Agudas Jisroel Jugend-Organisation in Ansbach (1924)
- Bericht
über die 50. Mitgliederversammlung des Jüdischen Lehrervereins für Bayern
e.V. am 30. und 31. August 1931 in Ansbach
- Vorbereitungen
zum Pessachfest (Artikel von 1932)
- Auftritt
von Julius Streicher in Ansbach (1934)
|
 | Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und
Privatpersonen
- Anzeige von Leon Joel
(1936)
- Anzeige
der Mechanischen Nähseiden-Fabrik Eduard Kupfer in Ansbach (1937!)
|
 | Weitere Dokumente
- Gerichtliche
Aufforderung an Jachet genannt Jette Ickelheimer (1822)
- Hochzeitstelegramm
nach Ansbach an Blumenthal im Hotel Jochsberger (1905)
- Rechnung
der Bayerischen Handelsbank Filiale Ansbach, vorm. Wolf S. Gutmann (1908)
|
 | Erinnerungsarbeit
- einzelne Presseartikel
- Über
die Geschichte der Familie Theobald und Lilly Hirschkind aus Ansbach
(Artikel von 2009) |
Allgemeine Berichte zur
Geschichte der jüdischen Gemeinde
Juden
können als "nur geduldete Einwohner" nicht zu den städtischen
Wachtdiensten herangezogen werden (Bericht über Dokumente von 1805; Beitrag von
1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 20. November 1914: "Ein zeitgemäßer Beitrag zur
Geschichte der Juden in Ansbach. Von Dr. A. Eckstein. Es wird
wohl gegenwärtig im ganzen Umfang des Deutschen Reiches kaum eine
größere Stadt geben, in welcher nicht Freiwillige aus den Kreisen der
Bürgerschaft an Stelle von zur Fahne eingezogenen Polizeimännern den
nächtlichen Wachtdienst aushilfsweise mitbesorgen würden. Dass auch
unsere Glaubensgenossen überall dabei sind, um in Erfüllung dieser
Bürgerpflicht als Augen des Gesetzes über die Ruhe ihrer Stadtgenossen
zu wachen, darf als selbstverständlich angenommen werden. Wie man aber
noch vor kaum einem Jahrhundert über die Befähigung von Juden auf dem
verantwortlichen Posten des städtischen Wachtdienstes im allgemeinen
dachte, das kann bei dieser Gelegenheit auf Grund eines den Beständen des
geheimen Staatsarchivs in Berlin (Rep. 44 C Polizei-Departement Nr. 119)
entnommenen Aktenstückes an einem Beispiel aus der Geschichte gezeigt
werden.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 20. November 1914: "Ein zeitgemäßer Beitrag zur
Geschichte der Juden in Ansbach. Von Dr. A. Eckstein. Es wird
wohl gegenwärtig im ganzen Umfang des Deutschen Reiches kaum eine
größere Stadt geben, in welcher nicht Freiwillige aus den Kreisen der
Bürgerschaft an Stelle von zur Fahne eingezogenen Polizeimännern den
nächtlichen Wachtdienst aushilfsweise mitbesorgen würden. Dass auch
unsere Glaubensgenossen überall dabei sind, um in Erfüllung dieser
Bürgerpflicht als Augen des Gesetzes über die Ruhe ihrer Stadtgenossen
zu wachen, darf als selbstverständlich angenommen werden. Wie man aber
noch vor kaum einem Jahrhundert über die Befähigung von Juden auf dem
verantwortlichen Posten des städtischen Wachtdienstes im allgemeinen
dachte, das kann bei dieser Gelegenheit auf Grund eines den Beständen des
geheimen Staatsarchivs in Berlin (Rep. 44 C Polizei-Departement Nr. 119)
entnommenen Aktenstückes an einem Beispiel aus der Geschichte gezeigt
werden.
In Ansbach war's, einer Stadt im bayerischen Mittelfranken, deren geschichtliche
Bedeutung mit dem Wachstum und dem Erblühen der Fürstenfamilie der
Hohenzollern aufs innigste zusammenhängt. Ehemals war Ansbach nämlich
die Haupt- und Residenzstadt einer markgräflichen Seitenlinie der
Hohenzollern, deren letzter Spross, ein Neffe Friedrichs des Großen, am
2. Dezember 1791 zugunsten des preußischen Königshauses der Regierung
seines Ländchens, zu welchem auch Bayreuth gehörte, entsagte. An
der Spitze der Verwaltung dieser preußisch gewordenen Provinz in Franken
stand der nachmals berühmte Hardenberg, der 1798 nach Berlin
berufen wurde, um von dort aus die fränkischen Angelegenheiten zu leiten.
Als nun gelegentlich des 3. Koalitionskrieges gegen die Korsen im Jahre
1805 das Militär aus Ansbach ausmarschiert war, beschloss der dortige
Magistrat, zu der dadurch notwendig gewordenen Bewachung der Stadt durch
die bürgerlichen Einwohner auch die Juden heranzuziehen, aber
nicht zum persönlichen Ehrendienste, sondern zur Ablösung dieser
Verpflichtung durch einen 'Lohnwächter', der dafür mit einem Betrage von
35 Kreuzern pro Tag entschädigt werden sollte. Diese zweifelhafte
Auszeichnung, die man ihnen zugedacht, lehnten die Juden von Ansbach
dankend ab und legten dagegen eine motivierte Beschwerde ein. Mit welchen
Gründen und mit welchem Rechte, das ist aus dem nachfolgenden Aktenstück
zu ersehen:
'Ansbach, den 28. Oktober 1805. Der hiesige Stadt-Magistrat hat bei den
gegenwärtig eingetretenen Umständen, welche die Bewachung der Stadt
durch die bürgerlichen Einwohner notwendig machten, die hiesige
Judenschaft zur Leistung der Wachtdienste mit beiziehen wollen, weil
1. die Juden bürgerliches Gewerbe treiben und sonst nicht-eximierten Standes
sind;
2. weil keine Verordnung vorliegt, nach welcher sie zum Dienst der
Bewachung der Stadt auf die Zeit der Abwesenheit der Garnison frei sind.
Diese Wachtdienstleistung ist ihnen unter der Eröffnung von dem
Dirigenten des Magistrats auferlegt worden, dass sie der sie treffenden
Reihe nach einen Lohn-Wächter, für welchen der gewöhnliche Preis von 35
kr. rh. (= rheinische Kreuzer) bezahlt werden müsse, stellen oder
Exekution gewärtigen müssten.
Die Vorsteher der Judenschaft haben gegen diese Verfügung beschwerende
Vorstellung bei uns eingereicht und sich teils auf die bisher bestandene
Observanz, wonach ihnen nie dergleichen Wachtdienste zugemutet worden,
teils auf die ihnen schon auferlegte höhere Steuern und Schutz-Abgaben,
wodurch sie dergleichen Natural-Dienstleistung reluiert (?) zu haben
glauben, berufen.
Die Observanz haben sie wirklich für sich, da sie noch niemals zur
Wachtdienstleistung beigezogen worden sind, auch selbst in neueren Fällen
nicht, wo die Garnison ausmarschiert war, wie dies der Fall beim Ausmarsch
des v. Voit'schen Regiments im Jahre 1777 gewesen
ist.
Nach der Markgräflichen Juden-Ordnung vom Jahre 1759 Tit. VI § 2 3
müssen Juden zwar zu Marsch-Quartiers und Botenlohns Kassen Beiträge
leisten. Allein es ist zweifelhaft, ob dies analogisch auf
Wachtdienstleistungen angewendet werden kann. Es scheinen verschiedene
nicht unerhebliche Gründe dem entgegen zu stehen.
Die Bewachung zur inneren Sicherheit ist eine polizeiliche Anstalt, die
nur von wirklichen Staatsbürgern vollstreckt werden kann. Den Juden,
welche eigentlich nur geduldete Einwohner sind, diese Bewachung
anvertrauen oder sie dazu mit beiziehen zu wollen, ist wohl unlängbar
vielen Inkonvenientien unterworfen, und gleichwohl würde es unbillig
sein, sie zur Ablösung einer Pflicht mit Gelde anzuhalten, die sie durch
ihre Abgaben schon redimiert zu haben |
 glauben, und zu deren Naturalleistung sie in jedem Fall zugelassen werden
müssten, wenn sie solche ohne Verletzung ihrer Religions- und
Sittengrundsätze übernehmen zu können vermeinen sollten, welches wohl
der Fall sein könnte. Wenigstens würden sie die Wachtdienste, nach
Anleitung der erwähnten Juden-Ordnung, außer den Sabbattagen, wo man
ohnehin solche von ihnen nicht fordern könnte, selbst in natura durch
ihre Glaubensgenossen verrichten wollen, und dadurch zu mancherlei
Unordnungen Anlass geben. So dringend notwendig scheint uns diese
Beiziehung der Juden zu den Wachtdiensten überhaupt noch nicht zu sein,
um solche auf Kosten und Gefahr der allgemeinen Ordnung und Ruhe
einführen zu wollen.
glauben, und zu deren Naturalleistung sie in jedem Fall zugelassen werden
müssten, wenn sie solche ohne Verletzung ihrer Religions- und
Sittengrundsätze übernehmen zu können vermeinen sollten, welches wohl
der Fall sein könnte. Wenigstens würden sie die Wachtdienste, nach
Anleitung der erwähnten Juden-Ordnung, außer den Sabbattagen, wo man
ohnehin solche von ihnen nicht fordern könnte, selbst in natura durch
ihre Glaubensgenossen verrichten wollen, und dadurch zu mancherlei
Unordnungen Anlass geben. So dringend notwendig scheint uns diese
Beiziehung der Juden zu den Wachtdiensten überhaupt noch nicht zu sein,
um solche auf Kosten und Gefahr der allgemeinen Ordnung und Ruhe
einführen zu wollen.
Zwar ist nicht zu leugnen, dass der hiesigen Bürgerschaft gegenwärtig
die beschwerliche Wachtdienstleistung sehr hart falle, indessen würde die
Erleichterung für sie durch die Beiziehung der Judenschaft nicht
bedeutend sein, weil zu den täglich auf die Wache ziehenden 72 Mann, die
Juden nur 6 Mann beistellen sollen. Wir sehen uns jedoch veranlasst, bei
Eurer Königlichen Majestät alleruntertänigst anzufragen,
ob ohngeacht der bisher bestandenen Observanz die Juden zur Leistung der
Stadtwachtdienste während der Abwesenheit der Garnison, und zu deren
Bezahlung in Gelde angehalten werden sollen.
Ansbach'sche Kriegs- und Domainen-Kammer.'
Darauf erfolgte der folgende Bescheid: 'Berlin, den 18. November
1805.
Wir finden die in Eurem Bericht vom 28. Oktober vorigen Monats gegen die
Beiziehung der dortigen Juden zu den Stadtwachdiensten, oder statt deren
Naturalleistung zu gebende Geldbeiträge, aufgestellten Gründe sehr
richtig. Solange sie nicht wirkliche Bürger, sondern bloß geduldete
Einwohner sind, kann ihnen die Wachtleistung nicht anvertraut werden.
Die Naturalleistung des Wachtdienstes würde Aufsehen und Unordnung zur
Folge haben und wird ihnen dies nicht gestattet, so kann auch keine
Wachtgelderzählung von ihnen gefordert werden. Wenn die Abgaben der Juden
für den Schutz als bloß geduldete Einwohner nicht beträchtlich
genug sind, so müssen solche erhöht werden, bis die gänzliche Reform
der Juden, die sie zu Staatsbürgern macht, eintritt, und darüber sind
bereits Eure Vorschläge gefordert. Ihr habt hienach dem dortigen
Magistrat das Erforderliche zu eröffnen. gezeichnet von
Hardenberg.'
Danken wir es dem Veränderer der Zeiten, dass die Juden der Gegenwart
überall im deutschen Vaterlande zum Ehrendienste eines Stadtwächters 'in
natura' zugelassen werden, ohne die Erregung öffentlichen Aufsehens und
die Störung der öffentlichen Ordnung aus solcher Veranlassung
befürchten zu müssen." |
Früher Bericht zur jüdischen Geschichte in Ansbach (1842)
 |
 |
 |
Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1842: "(Aus dem
neuen Jahresberichte des historischen Vereins für Mittelfranken. 1839).
‚Über die ersten Niederlassungen der Juden in Mittelfranken.’
Mitgeteilt von J.M. Fuchs, Professor in Ansbach. (Fortsetzung.).
Ansbach. Der erste Bürgermeister der Stadt Ansbach, Herr Endres, hat über
die ersten Ansässigmachungen von Israeliten in genannter Stadt einen sehr
interessanten Bericht mitgeteilt, welchen wir in seinen Hauptmomenten
bekannt machen. Die magistratische Registratur ist im Besitz von Akten über
die Judenverhältnisse, welche die Nachrichten, die Fischer in seiner
Geschichte und Beschreibung der Stadt Ansbach, Abschnitt XIV S. 168 über
die ersten Ansiedelungen der Israeliten in hiesiger Stadt gegeben hat, näher
bestimmen.
Durch ein Ausschreiben der markgräflichen Regierung vom 27. März 1564
wurden alle Ämter aufgefordert, die in ihrem Amtsbezirk befindlichen
Juden vorkommen zu lassen, Abschriften von ihren Freiheitsbriefen zu
nehmen, und diese Abschriften unverzüglich einzusenden; wenn ein Amt
keine Juden haben würde, solle dies ebenfalls gemeldet werden, es solle
ferner kein Amt einen Juden in seinen Amtsbezirk einkommen lassen und
wissentlich gedulden.
Hierauf berichteten unter dem 2. Juni 1564 Bürgermeister und Rat (umgeschrieben):
‚Dass wir hier in der Stadt keine wissentliche Juden haben, auch sonst
auf unseren und gemeinen Stadtgütern keine leiden und gedulden außerhalb
was je zu Zeit auf den Jahr- und Wochenmärkten und… sich von fremden
Juden zutrept, die wöchentlich ab- und zuziehen.’ ‚Was sie aber für
Freiheitsbrief oder von wem dieselbigen sie haben, ist uns unbewusst’.
Hierdurch ist also aktenmäßig festgestellt, dass im Jahre 1564 noch
keine Juden in hiesiger Stadt waren, wohl aber dass fremde Juden von Zeit
zu zeit in die Stadt kamen und besonders auf den Jahr- und Wochenmärkten
Verkehr trieben.
In den Lichtmesssteueranlagsregistern (sie gehen bis in das 15.
Jahrhundert zurück), oder in den Anlagsregistern über eine Art
Gemeindeumlage hiesiger Stadt, Lichtmesssteuer genannt – finden sich zum
erstenmal in den Registern von 1642 unter den am Schlusse eingetragenen
‚Eingeflohene Bauers- und andere Leut’ ganz am Ende zwei Juden aufgeführt,
wie folgt: Mosche Jud, Schmul Jud.
Im Register von 1643 finden sich beide wieder so vorgetragen: 3 Gulden
Mosch, Jud. 3 Gulden Schmul, Jud. Im Register von 1644 findet sich bloß:
3 Gulden Mosch Judt verzeichnet; ebenso in den Registern von 1645 und
1646. In dem Lichtmesssteueranlagsregister von 1647 sind wieder unter der
oben bezeichneten Rubrik am Schlusse vorgetragen: 3 Gulden Mosch Jud, und
so noch 6 andere, und so findet man ferner in den spätern jährlichen
Registern bald mehr bald weniger Juden dieser Art verzeichnet. – In den
ältern Rathhausakten Tom. I. Judensachen von 1560-1715 ist ein Bericht
vom Bürgermeister und Rat allhier enthalten dessen Eingang so lautet:
‚Euer fürstlicher Gnaden sollen wir nicht pergen, wie das die sich im
Zeithero allhie uff gehalten: sogenannte Schmul und Mosch die Juden wie
ingleichen Moschens Tochtermann eine solche Anzahl ihrer Mitjudengenossen
hieherziehen, dass fast Niemand mehr im Hand und Wandel vor ihnen
einkommen kann etc.
Es bitten Bürgermeister und Rat ‚Diese gottlosen wucherlichen Juden
ausschaffen zu lassen.’ Datum dieses Berichtes ist von schwarzer Tinte
9. Januar 1641. Dieses ist aber mit roter Tinte durchstrichen und mit
rother Tinte darüber gesetzt: 23. Juni 1643. Sogleich nach diesem
Berichte findet sich in den Akten ein Verzeichnis der Juden, so sich
allhier zu Onolzbach in den Vorstädten und Stadt aufhalten, d.d. Oktober
1631. Nach diesem Verzeichnis waren die eingewanderten Juden aus Obernzenn,
Jala (wahrscheinlich Ickelheim bei Windsheim), Leutershausen,
Berolzheim, Crailsheim,
Feuchtwangen, Bechhofen,
Fürth, Hafefeld, Mainstockheim,
Gunzenhausen.
Im Lichtmesssteuerregister von 1657 sind die Juden das Erstemal auf
folgende Weise eingetragen: 4 Gulden Ambsen Jud, 3 Gulden Mosch Jud, 2
Gulden Loew Jud vermöge seines Schutzbriefes vom 21. August 1651. 2
Gulden Judas Jud inhalt fürstlichen Dekrets vom 21. Oktober 1655. ebenso
finden sie sich 1658 und 1659 wieder vorgetragen. Ferner findet sich in
den genannten Akten eine Schrift an Seine Fürstliche Durchlaucht: Untertänigste
Ableinung und Gegenverantwortung, Simon Models Hochfürstlich
Brandenburgische Schutzverwandten Juden allhie zu Onolzbach etc. ferner
ein Verzeichnis Fol. 75 d.d. 23. Dezember über die jüdischen
Haushaltungen und ihr Vermögen allhier zu Onolzbach etc. In demselben
sind acht Haushaltungen angegeben, die Zahl und das Alter der
Familienglieder, ihre liegenden Güter, ihr Vermögen an Geld, ihre
Steuern und Abgaben…"
|
Aus der Geschichte des Rabbinates in Ansbach
Im 19./20. Jahrhundert waren Rabbiner in Ansbach:
 | 1793-1835 Rabbiner Moses Hochheimer (geb. 1755 in Veitshöchheim,
Studium an der Fürther Jeschiwa und in Frage, 1777 Ordination, 1790-93 Lehrer in
Fürth, dann nach Ansbach berufen, ab 1793
Distriktsrabbiner in Ansbach, gest.
1835 in Ansbach) |
 | 1835-1841 Rabbinatsverweser Jacob Oberdorfer (geb.
1807 in Wallerstein, nach der Rabbinatszeit in Ansbach Prediger in Wandsbek,
Hamburg, 1857 Rabbiner in Pniewy (Pinne), Posen, 1861-1884 Rabbiner im
württembergischen Oberdorf, gest. 1884 in
Oberdorf)
|
 | 1841-1893 Rabbiner Aron Bär Grünbaum (geb. 1812 in
Gunzenhausen, Abitur am Gymnasium
Carolinum in Ansbach, lernte in der Stadt bei Rabbiner Hochheimer; 1835
Ordination in Bamberg, seit 1841 Rabbiner in Ansbach, gest. 1893 in
Ansbach)
|
 | 1894-1915 / 1919 Rabbiner Pinchas Kohn (geb. 1867 in
Kleinerdlingen als Sohn von Rabbiner Marx Michael Kohn, Enkel von Rabbiner
David Weiskopf): Besuch des Realgymnasiums in Halberstadt, Studium in Berlin
und Besuch des dortigen Rabbinerseminars, 1890-1893 Rabbiner in Burgkunstadt, 1893 Promotion und
Rabbinatsverweser in Mannheim, 1894
Distriktrabbiner in Ansbach, Mitbegründer der "Agudat Israel", vgl. unten 1937-1939)
|
 | 1915-1917 Rabbinatsverweser Dr. Chaim Heinrich Cohn
(geb. 1889 in Basel, Studfien in Pressburg,
Lausanne und Straßburg, Staatsexamen als Oberlehrer für Englisch und
Französisch, 1914 Ordination in Berlin, nach seiner Zeit in Ansbach 1917/18 Militärrabbiner an
der Westfront, 1939 nach London emigriert, gest. 1966 in London) |
 | 1917-1925 Rabbiner Dr. David Brader (geb. 1879 in Ichenhausen,
Studium in München, 1906-1908 Rabbinatssubstitut in Ansbach, 1912-1917
Reallehrer in
Nürnberg, 1925 in die Schweiz verzogen, weitere Geschichte unbekannt). |
 | 1926-1937 Rabbiner Dr. Eli Munk (geb. 1900 in Paris,
Studien am Rabbinerseminar in Berlin, nach seiner Zeit in Ansbach 1937 nach Frankreich emigriert, bis 1943
Rabbiner in Paris und Nizza, 1943 in die Schweiz geflohen, 1945 in die USA,
gest. 1980 in New York). |
 | 1937-1939 Rabbiner Pinchas Kohn (vgl. oben
1894-1915; 1923-1937 Präsident der "Agudat Israel" in Wien; 1937
nach Ansbach zurückgekehrt; im
Februar 1938 in die Schweiz emigriert; bei Kriegsausbruch 1939 nach London, wo er am 12. Juli
1941 starb). |
Aussichten auf erneute Besetzung des Rabbinates Ansbach nach Rabbiner Moses Hochheimer
(1838)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Februar 1838: "Ansbach,
8. Februar (1838). Es ist Hoffnung vorhanden, dass die einflussreiche,
seit Jahren nur verweste Rabbinatsstelle in der Kreishauptstadt Ansbach
demnächst besetzt werden wird. In einem allerhöchsten Reskripte auf eine
Reklamation der zu dem Rabbinatssprengel gehörigen Gemeinde Schopfloch
ist dies mit Bestimmtheit ausgesprochen. Möchte sie doch einem tüchtigen
Bewerber zuteil
werden, - der Halbgebildeten haben wir schon genug!". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Februar 1838: "Ansbach,
8. Februar (1838). Es ist Hoffnung vorhanden, dass die einflussreiche,
seit Jahren nur verweste Rabbinatsstelle in der Kreishauptstadt Ansbach
demnächst besetzt werden wird. In einem allerhöchsten Reskripte auf eine
Reklamation der zu dem Rabbinatssprengel gehörigen Gemeinde Schopfloch
ist dies mit Bestimmtheit ausgesprochen. Möchte sie doch einem tüchtigen
Bewerber zuteil
werden, - der Halbgebildeten haben wir schon genug!". |
Feierliche Amtseinsetzung von Rabbiner Aron Bär Grünbaum am 12. Juli 1841
 Artikel in den "Israelitischen Annalen" vom 17. September
1841: "Altenmuhr, 19. Juli 1841. - Die unterm 25. Mai letzten
Jahres Ihnen gemeldete Rabbinerwahl für den Distrikt Ansbach erhielt, wie
vorauszusehen war, ungesäumt die Bestätigung der Regierung, und erfolgte
der Installationsakt in der dortigen Synagoge nach beifolgendem Programm
am 12. Juli (1841) unter dem Zuströmen eines zahlreichen teilnehmenden
Publikums von nahe und ferne auf eine ebenso feierliche als erhebende
Weise. Artikel in den "Israelitischen Annalen" vom 17. September
1841: "Altenmuhr, 19. Juli 1841. - Die unterm 25. Mai letzten
Jahres Ihnen gemeldete Rabbinerwahl für den Distrikt Ansbach erhielt, wie
vorauszusehen war, ungesäumt die Bestätigung der Regierung, und erfolgte
der Installationsakt in der dortigen Synagoge nach beifolgendem Programm
am 12. Juli (1841) unter dem Zuströmen eines zahlreichen teilnehmenden
Publikums von nahe und ferne auf eine ebenso feierliche als erhebende
Weise.
Es hatten sich auch, außer einer Kommission des hochlöblichen
Stadtmagistrats, eingefunden: Seine Exzellenz der Regierungspräsident
Herr von Andrian, viele Mitglieder der königlichen Regierung und des
königlichen Stadtgerichts, der königliche Landrichter der treffenden Landgemeinden,
die protestantische Stadtgeistlichkeit (im Ornate) und viele Honoratioren
der Stadt. Das Innere der Synagoge mit einer neu erbauten Kanzel war
sinnig ohne Überladung ausgeschmückt und beleuchtet, und die Ausführung
der Gesänge ließ nichts zu wünschen übrig.
Einer noch höheren Anerkennung hatte sich die von dem neu ernannten
Rabbiner, Herrn Grünbaum, mit vieler Würde und mit einem kräftigen und
wohlklingenden Organ vorgetragene Predigt zu erfreuen, und wurde besonders
hervorgehoben, dass er in derselben, fern von aller affektierten
Priesterlichkeit, über seine künftige Amtsführung unumwunden, ohne
seine Ansichten und Grundsätze auf Schrauben zu stellen oder so zu
verallgemeinern, dass sie auch in jeder Kirche vorgetragen werden können,
als ein Rabbiner sich ausgesprochen hat, der seine Stellung begreift und
Kraft und Willen hat, ihre Ehre zu machen.
Dies wollen Sie aus der im Druck herausgekommenen anliegenden Predigt
ersehen.
Später gab die Gemeinde in dem Lokale der 'Harmonie' ihrem Rabbiner ein
Souper, nach dessen Beendigung das schon länger bestehende
Liebhabertheater genannter Gesellschaft ein auf die Feier des Tages Bezug
habendes Stück recht brav aufführte und mit einem passenden Transparent
in später Nacht die Feier würdig schloss.
Wer nur einigermaßen mit den Verhältnissen vertraut ist, der muss
freudig den großen Fortschritt anerkennen, welcher die Gemeinde Ansbach
durch die Art der Feier dieses schönen Tages bestätigt hat. Noch vor
wenigen Jahren wäre dort die Ausführung eines deutschen Gesanges in der
Synagoge als Todsünde betrachtet worden; alle ihre Einrichtungen hatten
noch jenen vermoderten Anstrich; man war gewohnt, sie in den ersten Reihen
der blinden Eiferer zu sehen. Alles dies ist nun anders; ein frischer
Lebensgeist waltet in ihr und übt wohltätigen Einfluss auf die
benachbarten Orte. Ehre den würdigen Vorständen dieser Gemeinde! Ehre
aber auch den einzelnen Gliedern derselben, die weit entfernt von der
jetzt so sehr gehegten Oppositions- und Parteisucht, sich auch in das in
Liebe fügen, was ihren Ansichten nicht immer zusagt. Möge es nur immer
so bleiben! - K." |
Aufteilung des Rabbinatsdistriktes Ansbach und Ernennung von Rabbiner Aron
Grünbaum (1842)
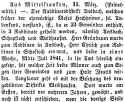 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. September 1842: "Aus
Mittelfranken, 13. März (1842. – Der Rabbinatsdistrikt Ansbach, welchem
früher der ehrwürdige Moses Hochheimer, seligen Andenkens, vorstand,
ist, da er 23 Gemeinden enthielt, in 3 Rabbinate geteilt worden, nämlich Ansbach,
Schopfloch und Welbhausen.
Herr Grünbaum wurde zum Rabbinen in Ansbach, Herr Ehrlich
zum Rabbinen in Schopfloch ernannt, und beide in
einer Woche, Mitte Juli 1841, in ihr Amt feierlich eingesetzt, seit
welcher Zeit beide Männer auch zum Segen ihrer Gemeinden und zum Heile
Israels wirken. Langsamer geht es mit der Besetzung des neu gebildeten
Distrikts Welbhausen…" Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. September 1842: "Aus
Mittelfranken, 13. März (1842. – Der Rabbinatsdistrikt Ansbach, welchem
früher der ehrwürdige Moses Hochheimer, seligen Andenkens, vorstand,
ist, da er 23 Gemeinden enthielt, in 3 Rabbinate geteilt worden, nämlich Ansbach,
Schopfloch und Welbhausen.
Herr Grünbaum wurde zum Rabbinen in Ansbach, Herr Ehrlich
zum Rabbinen in Schopfloch ernannt, und beide in
einer Woche, Mitte Juli 1841, in ihr Amt feierlich eingesetzt, seit
welcher Zeit beide Männer auch zum Segen ihrer Gemeinden und zum Heile
Israels wirken. Langsamer geht es mit der Besetzung des neu gebildeten
Distrikts Welbhausen…" |
Zum 70. Geburtstag von Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1882)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. November 1882: "Ansbach, 15.
Oktober. Heute wurde der 70. Geburtstag des Herrn Distriktsrabbiners Grünbaum,
sowohl von der hiesigen als auch von den Distriktgemeinden und den Lehrern
des Bezirks feierlich begangen. Zahlreiche Gratulationen, sowie mehrere
prachtvolle Geschenke gingen dem Jubilar von verschiedener Seite zu." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. November 1882: "Ansbach, 15.
Oktober. Heute wurde der 70. Geburtstag des Herrn Distriktsrabbiners Grünbaum,
sowohl von der hiesigen als auch von den Distriktgemeinden und den Lehrern
des Bezirks feierlich begangen. Zahlreiche Gratulationen, sowie mehrere
prachtvolle Geschenke gingen dem Jubilar von verschiedener Seite zu." |
50-jähriges Dienstjubiläum des Distriktrabbiners Aron Grünbaum (1891)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1891: "Ansbach, im Juli
(1891). Vergangenen Sonntag feierte unser allverehrter Distrikts-Rabbiner
Herr Aron Grünebaum sein 50jähriges Dienstjubiläum. Je näher der
Festtag kam, desto mehr zeigte es sich, welch’ seltener Beliebtheit und
Popularität sich unser Herr Rabbiner erfreut. Zeichen der Verehrung
wurden schon tags vorher in verschiedenster Art gegeben. Aus den
entferntesten Gegenden Deutschlands liefen die wertvollsten Präsente ein.
Zum gewöhnlichen Frühgottesdienste versammelte sich in Festeskleidung
unaufgefordert fast die Gesamt-Kultusgemeinde, bei welchem der Kantor,
Herr Sternberg, mit seiner sonoren Stimme ein der Feier entsprechendes
Gebet vortrug. Die ersten Glückwünsche brachte eine kleine Anzahl Mädchen
der israelitischen Elementarschule, geführt von ihrem Lehrer. Das 10jährige
Töchterchen des Fabrikanten Herrn Eduard Kupfer trug ein Gedicht recht hübsch
vor. Lehrer Hofmann übergab zunächst ein Kollektiv-Glückwunschschreiben
der jüdischen Lehrer des Distrikts und hielt dabei eine Ansprache an den
Herrn Jubilar, dabei auf den blühenden Aronsstab Bezug nehmend. Hierauf
erschien eine Deputation der Kultusverwaltung; Herr Vorstand Selling
stattete mit beredten Worten die Dankes- und Glückwünsche der
Muttergemeinde Ansbach, sowie der israelitischen Gemeinden, welche zum
diesseitigen Rabbinatsbezirke gehören, ab. Hierbei übergab Herr Selling
dem Jubilar das Ergebnis einer Sammlung mit der Bitte, mit diesen
Wertpapieren eine Stiftung zu machen, welche den Namen des Herrn Rabbiners
tragen solle. Der Jubilar erwiderte hierauf mit einer längeren,
tiefergreifenden Ansprache. Um ¼ 12 Uhr kam der Vorstand in einer
Equipage, um den Jubilar zum feierlichen Festakte im Rathause abzuholen.
Dort hatten sich eingefunden Herr Bürgermeister Keller, angetan mit
goldener Amtskette, viele Herren Magistratsräte, die israelitische
Kultusverwaltung in corpore. Herr Bürgermeister Keller hielt dabei eine
ergreifende Rede, in der er mitteilte, dass auch unser Landesfürst, unser
vielgeliebter Prinzregent gnädigst geruht hat, der hohen Verdienste des
Jubilars gerecht zu werden. Nach Signat des Königlichen
Staatsministeriums vom 3. laufenden Monats hat sich Seine Königliche
Hoheit bewogen gefunden, den allerhöchsten Verdienstorden vom heiligen
Michael – eine seltene Auszeichnung – dem Herrn Distriktsrabbiner zu
verleihen. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1891: "Ansbach, im Juli
(1891). Vergangenen Sonntag feierte unser allverehrter Distrikts-Rabbiner
Herr Aron Grünebaum sein 50jähriges Dienstjubiläum. Je näher der
Festtag kam, desto mehr zeigte es sich, welch’ seltener Beliebtheit und
Popularität sich unser Herr Rabbiner erfreut. Zeichen der Verehrung
wurden schon tags vorher in verschiedenster Art gegeben. Aus den
entferntesten Gegenden Deutschlands liefen die wertvollsten Präsente ein.
Zum gewöhnlichen Frühgottesdienste versammelte sich in Festeskleidung
unaufgefordert fast die Gesamt-Kultusgemeinde, bei welchem der Kantor,
Herr Sternberg, mit seiner sonoren Stimme ein der Feier entsprechendes
Gebet vortrug. Die ersten Glückwünsche brachte eine kleine Anzahl Mädchen
der israelitischen Elementarschule, geführt von ihrem Lehrer. Das 10jährige
Töchterchen des Fabrikanten Herrn Eduard Kupfer trug ein Gedicht recht hübsch
vor. Lehrer Hofmann übergab zunächst ein Kollektiv-Glückwunschschreiben
der jüdischen Lehrer des Distrikts und hielt dabei eine Ansprache an den
Herrn Jubilar, dabei auf den blühenden Aronsstab Bezug nehmend. Hierauf
erschien eine Deputation der Kultusverwaltung; Herr Vorstand Selling
stattete mit beredten Worten die Dankes- und Glückwünsche der
Muttergemeinde Ansbach, sowie der israelitischen Gemeinden, welche zum
diesseitigen Rabbinatsbezirke gehören, ab. Hierbei übergab Herr Selling
dem Jubilar das Ergebnis einer Sammlung mit der Bitte, mit diesen
Wertpapieren eine Stiftung zu machen, welche den Namen des Herrn Rabbiners
tragen solle. Der Jubilar erwiderte hierauf mit einer längeren,
tiefergreifenden Ansprache. Um ¼ 12 Uhr kam der Vorstand in einer
Equipage, um den Jubilar zum feierlichen Festakte im Rathause abzuholen.
Dort hatten sich eingefunden Herr Bürgermeister Keller, angetan mit
goldener Amtskette, viele Herren Magistratsräte, die israelitische
Kultusverwaltung in corpore. Herr Bürgermeister Keller hielt dabei eine
ergreifende Rede, in der er mitteilte, dass auch unser Landesfürst, unser
vielgeliebter Prinzregent gnädigst geruht hat, der hohen Verdienste des
Jubilars gerecht zu werden. Nach Signat des Königlichen
Staatsministeriums vom 3. laufenden Monats hat sich Seine Königliche
Hoheit bewogen gefunden, den allerhöchsten Verdienstorden vom heiligen
Michael – eine seltene Auszeichnung – dem Herrn Distriktsrabbiner zu
verleihen.
Hierauf dankte der greise Jubilar, von Rührung übermannt, in zu Herzen
gehenden Worten und schloss mit einem Hoch auf Seine Königliche Hoheit
unseren allverehrten Prinzregenten.
In der Wohnung des Jubilars erschienen zahlreiche Gratulanten. Wir
bemerkten die Herren: Seine Exzellenz Königlicher Regierungspräsident
Ritter von Zenetti, Präsident von Meinel, Königlicher Regierungsdirektor
von Roman, Königlicher Kreisschulinspektor Methsieder, Königlicher
Oberlandesgerichtsrat Greiner, Königlicher Oberamtsrichter von Krafft,
eine Deputation der Königlichen Realschule, die katholische
Pfarrgeistlichkeit, das protestantische Konsistorium und das Rektorat des
königlichen Gymnasiums. Auch auswärtige Gemeinden ließen sich durch
Deputierte vertreten, um persönlich ihre Glückwünsche darzubringen,
unter anderen Windsbach durch Herrn Lehrer Maier, Roth durch Herrn
Kultusvorstand Niederheimer. Über Hunderte von Telegrammen liefen an
diesem Tage bei dem Gefeierten ein. Es war ein Ehren- und Jubeltag im schönsten
Sinne des Wortes. Möge es dem allverehrten Jubilar vergönnt sein, den
Abend seines Lebens in Gesundheit und Frohsinn und ungetrübtem Glücke zu
genießen. Amen." |
Beerdigungsfeier für den verstorbenen Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1893)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1893:
"Ansbach,
12. Dezember (1893). (Beerdigungsfeier des Distriktsrabbiners
Grünbaum).
Selten noch dürfte in hiesiger Stadt einem Manne das ehrende Geleite zum
Grabe zuteil geworden sein, wie die Leiche des Herrn Distriktsrabbiners
Aron Bär Grünbaum. Nach Hunderten zählten die Bürger hiesiger Stadt,
die auf diese Weise ihre Pietät für den Entschlafenen zu erkennen gaben.
Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um den Toten zurück;
die protestantische wie die katholische Geistlichkeit sah man an dem Sarge
des Ehrenmannes, von dem man in Wahrheit sagen konnte: er hatte keinen
Feind. Auch die Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem
langen, langen Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr.
Neuburger von Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und
zu Herzen gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des
Dahingeschiedenen als Seelsorger und von der Bescheidenheit und
Menschenfreundlichkeit, die ihn als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr.
Bamberger von Würzburg drückte im Namen der übrigen Rabbiner Bayerns
dem Verblichenen seinen Dank für das kollegiale Wirken und die erwiesene
kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm ergriff der Vorstand der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde Herr Kaufmann Selling das Wort, als
Kultusvorstand, um als Vertreter der Distriktsgemeinde dem teuren
Heimatgegangenen für die große väterliche Liebe und Fürsorge, welche
er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde während seines 52jährigen
ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden lassen, in warmen Worten zu
danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt Justizrat Josephthal, der
in meisterhafter Rede verschiedener freudiger und trauriger Episoden aus
dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners gedachte und am Schlusse als
einer der ältesten Schüler im Namen der früheren Schüler des
Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen gelegten
guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch als
weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen, Herr Blumenthal,
in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer aus dem Distrikte.
Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger sich unsere höchste
Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein gesegnetes sein!". Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1893:
"Ansbach,
12. Dezember (1893). (Beerdigungsfeier des Distriktsrabbiners
Grünbaum).
Selten noch dürfte in hiesiger Stadt einem Manne das ehrende Geleite zum
Grabe zuteil geworden sein, wie die Leiche des Herrn Distriktsrabbiners
Aron Bär Grünbaum. Nach Hunderten zählten die Bürger hiesiger Stadt,
die auf diese Weise ihre Pietät für den Entschlafenen zu erkennen gaben.
Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um den Toten zurück;
die protestantische wie die katholische Geistlichkeit sah man an dem Sarge
des Ehrenmannes, von dem man in Wahrheit sagen konnte: er hatte keinen
Feind. Auch die Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem
langen, langen Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr.
Neuburger von Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und
zu Herzen gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des
Dahingeschiedenen als Seelsorger und von der Bescheidenheit und
Menschenfreundlichkeit, die ihn als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr.
Bamberger von Würzburg drückte im Namen der übrigen Rabbiner Bayerns
dem Verblichenen seinen Dank für das kollegiale Wirken und die erwiesene
kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm ergriff der Vorstand der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde Herr Kaufmann Selling das Wort, als
Kultusvorstand, um als Vertreter der Distriktsgemeinde dem teuren
Heimatgegangenen für die große väterliche Liebe und Fürsorge, welche
er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde während seines 52jährigen
ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden lassen, in warmen Worten zu
danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt Justizrat Josephthal, der
in meisterhafter Rede verschiedener freudiger und trauriger Episoden aus
dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners gedachte und am Schlusse als
einer der ältesten Schüler im Namen der früheren Schüler des
Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen gelegten
guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch als
weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen, Herr Blumenthal,
in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer aus dem Distrikte.
Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger sich unsere höchste
Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein gesegnetes sein!". |
Nachruf auf Distriktsrabbiner Aron Grünbaum (1893)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1893: "Ansbach,
14. Dezember (1893). Am 9. dieses Monats verschied nach kurzer Krankheit
Herr Distriktsrabbiner A. B. Grünbaum im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene
war im Jahre 1811 in Gunzenhausen geboren, besuchte nach dem früher
Verluste seiner Eltern das hiesige Gymnasium und kam nach dem Besuche der
Universität München als Kandidat nach Ansbach, wo er unter dem damaligen
Oberrabbiner hier wirkte, bis er nach dessen Ableben auf die Stelle seines
Vorgängers berufen und am 12. Juli 1841 durch Bürgermeister Stirl
feierlich installiert wurde. Seit mehr als 52 Jahren versah er die hiesige
Seelsorge mit seltener Treue und unermüdlichem Eifer zum Besten seiner
Kultusgemeinde; selbst in seinem hohen Alter oblag er seiner Pflicht in
einer Weise, die neben der Bewunderung für den greisen Rabbiner oft das
Gefühl der Rührung hervorrufen musste. Weit in den bayerischen landen
wurde sein Name mit Achtung genannt; denn er war bekannt als einer der
besten Kanzelredner. In hiesiger Stadt war er bekannt und beliebt als ein
edler, duldsamer, ruhiger Charakter, der bloß seiner Pflicht zu genügen
suchte und in andere Kreise nie störend eingriff; auch seine nichtjüdischen
Mitbürger verehrten und schätzten ihn hoch. Selten noch dürfte hier
einem Manne das ehrende Geleite zum Grabe zuteil geworden sein, wie der
Leiche Grünbaums. Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um
den teuren Toten zurück; die protestantische wie die katholische
Geistlichkeit sah man an dem Sarge des Ehrenmannes. Auch die
Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem langen, langen
Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr. Neubürger von
Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und zu Herzen
gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des Dahingeschiedenen als
Seelsorger und von der Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit, die ihn
als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr. Bamberger von Würzburg drückte im
Namen der übrigen Rabbiner Bayerns dem Verblichenen seinen Dank für das
kollegiale Wirken und die erwiesene kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm
ergriff der Vorstand der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde Herr
Kaufmann Selling das Wort, als Kultusvorstand, um als Vertreter der
Distriktsgemeinde dem teuren Heimatgegangenen für die große väterliche
Liebe und Fürsorge, welche er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde
während seines 52jährigen ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden
lassen, in warmen Worten zu danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt
Justizrat Josephthal, der in meisterhafter Rede verschiedener freudiger
und trauriger Episoden aus dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners
gedachte und am Schlusse als einer der ältesten Schüler im Namen der früheren
Schüler des Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen
gelegten guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch
als weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen,
Herr Blumenthal, in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer
aus dem Distrikte. Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger
sich unsere höchste Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein
gesegnetes sein!" Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Dezember 1893: "Ansbach,
14. Dezember (1893). Am 9. dieses Monats verschied nach kurzer Krankheit
Herr Distriktsrabbiner A. B. Grünbaum im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene
war im Jahre 1811 in Gunzenhausen geboren, besuchte nach dem früher
Verluste seiner Eltern das hiesige Gymnasium und kam nach dem Besuche der
Universität München als Kandidat nach Ansbach, wo er unter dem damaligen
Oberrabbiner hier wirkte, bis er nach dessen Ableben auf die Stelle seines
Vorgängers berufen und am 12. Juli 1841 durch Bürgermeister Stirl
feierlich installiert wurde. Seit mehr als 52 Jahren versah er die hiesige
Seelsorge mit seltener Treue und unermüdlichem Eifer zum Besten seiner
Kultusgemeinde; selbst in seinem hohen Alter oblag er seiner Pflicht in
einer Weise, die neben der Bewunderung für den greisen Rabbiner oft das
Gefühl der Rührung hervorrufen musste. Weit in den bayerischen landen
wurde sein Name mit Achtung genannt; denn er war bekannt als einer der
besten Kanzelredner. In hiesiger Stadt war er bekannt und beliebt als ein
edler, duldsamer, ruhiger Charakter, der bloß seiner Pflicht zu genügen
suchte und in andere Kreise nie störend eingriff; auch seine nichtjüdischen
Mitbürger verehrten und schätzten ihn hoch. Selten noch dürfte hier
einem Manne das ehrende Geleite zum Grabe zuteil geworden sein, wie der
Leiche Grünbaums. Kein Unterschied in der Konfession hielt den Schmerz um
den teuren Toten zurück; die protestantische wie die katholische
Geistlichkeit sah man an dem Sarge des Ehrenmannes. Auch die
Stadtgemeinde, Magistrat wie Kollegium, schlossen sich dem langen, langen
Trauerzuge an. Am Grabe angekommen, hielt Herr Rabbiner Dr. Neubürger von
Fürth die Leichenrede und gab in von Herzen kommenden und zu Herzen
gehenden Worten ein Bild von dem edlen Wirken des Dahingeschiedenen als
Seelsorger und von der Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit, die ihn
als Menschen zierte. Herr Rabbiner Dr. Bamberger von Würzburg drückte im
Namen der übrigen Rabbiner Bayerns dem Verblichenen seinen Dank für das
kollegiale Wirken und die erwiesene kollegiale Freundschaft aus. Nach ihm
ergriff der Vorstand der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde Herr
Kaufmann Selling das Wort, als Kultusvorstand, um als Vertreter der
Distriktsgemeinde dem teuren Heimatgegangenen für die große väterliche
Liebe und Fürsorge, welche er seiner hiesigen, wie der Distrikts-Gemeinde
während seines 52jährigen ersprießlichen Wirkens zuteil hat werden
lassen, in warmen Worten zu danken. Herrn Selling folgte Herr Rechtsanwalt
Justizrat Josephthal, der in meisterhafter Rede verschiedener freudiger
und trauriger Episoden aus dem Leben des verstorbenen Herrn Rabbiners
gedachte und am Schlusse als einer der ältesten Schüler im Namen der früheren
Schüler des Heimgegangenen diesem für den von ihm in ihre jungen Herzen
gelegten guten Samen wärmsten Nachruf widmete. Zum Schluss folgten noch
als weitere Redner der II. Kultusvorstand von Gunzenhausen,
Herr Blumenthal, in welcher Stadt Grünbaums Wiege stand, und ein Lehrer
aus dem Distrikte. Möge dem Manne, der als Seelsorger wie als Bürger
sich unsere höchste Achtung errang, die Erde leicht und sein Andenken ein
gesegnetes sein!" |
Zur
anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Februar 1894)
Anmerkung: Lehrer
Oppenheim aus Leutershausen setzt sich für die Wahl eines streng orthodoxen
Rabbiners ein und bekommt Schwierigkeiten mit verantwortlichen Personen der
Ansbacher Gemeinde, die einen ‚gemäßigt konservativen’ Kandidaten
bevorzugen.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Februar 1894:
"Zur Rabbiner-Wahl im Distrikts-Rabbinat Ansbach. Dr. Carl du
Prel bemerkt in einer Polemik als Verteidigung seiner Weltanschauung:
‚Die Stärke einer Sache lässt sich direkt abschätzen aus den
Argumenten ihrer Vertreter, indirekt aus den Gegenargumenten ihrer
Widersacher. Wenn die Gegner, weil ihnen die Verstandesgründe ausgehen,
Angriffsmittel von moralischer Bedenklichkeit anwenden – so kann man
sicher darauf rechnen, dass die von ihnen bekämpfte Sache auf starken Füßen
stehe.’ Herr du Prel! –
Sie haben Recht, Sie flößen mir Mut ein, da auch ich die Anwendung von
Angriffsmitteln moralischer Bedenklichkeit erfahren musste; was hatte ich
denn eigentlich verbrochen? Ich will in objektiver Weise den Hergang erzählen:
Das Distrikts-Rabbinat Ansbach ist durch den Tod des seitherigen Inhabers
erledigt, und muss nun neu besetzt werden. Da erschien vor kurzem ein
Ausschreiben der israelitischen Kultusverwaltung in Ansbach, wonach zur
Bewerbung um die erledigte Stelle nur Kandidaten ‚gemäßigt
konservativer’ Richtung eingeladen waren. Voraus gegangen war eine
Versammlung am 31. Dezember vorigen Jahres, in welcher allgemein betont
wurde, der anzustellende Rabbiner müsse streng religiös sein. Man
vergleiche nun die Übereinkunft: ‚streng religiös’ – und das
Ausschreiben: ‚gemäßigt konservativ’ – ist das kein Widerspruch?
In der gleichen Versammlung wurde auf Antrag des Verwaltungsrates in
Ansbach auch der seitherige Wahlmodus geändert, indem auf je 15 Mark
Rabbinatsbeitrag für die Landgemeinden 1 Stimme kommen solle, in Ansbach
jedoch solle jeder Wahlberechtigte auch wahlfähig sein. Mit anderen
Worten: Nicht mehr die persönliche Überzeugung sollte in die Wagschale
gelegt werden, sondern – der Geldbeutel; - ist das nicht moralisch
bedenklich? Diese Wahlmodus wurde inhibiert und die Wahl nach Maßgabe der
allerhöchsten M.E. vom 24. Dezember 1844 von hoher königlichen Regierung
angeordnet. Ich war der Urheber der betreffenden Eingabe an die königliche
Regierung und wurde deswegen vom Verwaltungsrate in Ansbach in öffentlicher
wie privater Weise in der moralisch bedenklichsten Art behandelt.
Denunziationen, Insinuationen und ähnliche Waffen wurden gegen mich geführt,
allein ich wurde nicht getroffen; weil ich eben dem Schützen zu hoch
stand, reichte seine Kraft nicht aus, mich zu erreichen.
Dem ‚gemäßigt konservativen’ Ausschreiben des
Verwaltungsrates in Ansbach folgte ein Inserat meinerseits, worin ich in
Übereinstimmung meiner Freunde der Tatsache Ausdruck verlieh, die Wählerschaft
wünsche einen streng orthodoxen Rabbiner. Das brachte den Verwaltungsrat
in Ansbach außer Rand und Band. Auf solche Weise seine Kreise gestört zu
sehen, das ist auch zu arg! Der Plan war doch zu schön:
1) Gibt uns der Wahlmodus ohnehin die Schwerkraft,
2) Hält das ‚gemäßigt
konservative’ Ausschreiben überhaupt jeden Orthodoxen fern, - und das
alles durch den verflixten ‚Leutershäuser Lehrer’ vereitelt – Grund
genug, ihn zu hassen! Der macht sich aber daraus gar nichts. Er hat seinen
Plan auf Wahrheit und Recht gegründet, und weicht nicht von seinem Wege
weder rechts noch links. Die
gescheiterten Pläne haben natürlich eine neue Versammlung nötig gemacht
und hier sollte mir der letzte Stoß versetzt werden.
Meine Absicht habe ich durch meine Tätigkeit nicht erreicht, ich täuschte
mich nämlich an meinem Gegner. Ich habe ihm soviel Noblesse zugetraut,
dass er wegen prinzipieller Fragen keinen persönlichen Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Februar 1894:
"Zur Rabbiner-Wahl im Distrikts-Rabbinat Ansbach. Dr. Carl du
Prel bemerkt in einer Polemik als Verteidigung seiner Weltanschauung:
‚Die Stärke einer Sache lässt sich direkt abschätzen aus den
Argumenten ihrer Vertreter, indirekt aus den Gegenargumenten ihrer
Widersacher. Wenn die Gegner, weil ihnen die Verstandesgründe ausgehen,
Angriffsmittel von moralischer Bedenklichkeit anwenden – so kann man
sicher darauf rechnen, dass die von ihnen bekämpfte Sache auf starken Füßen
stehe.’ Herr du Prel! –
Sie haben Recht, Sie flößen mir Mut ein, da auch ich die Anwendung von
Angriffsmitteln moralischer Bedenklichkeit erfahren musste; was hatte ich
denn eigentlich verbrochen? Ich will in objektiver Weise den Hergang erzählen:
Das Distrikts-Rabbinat Ansbach ist durch den Tod des seitherigen Inhabers
erledigt, und muss nun neu besetzt werden. Da erschien vor kurzem ein
Ausschreiben der israelitischen Kultusverwaltung in Ansbach, wonach zur
Bewerbung um die erledigte Stelle nur Kandidaten ‚gemäßigt
konservativer’ Richtung eingeladen waren. Voraus gegangen war eine
Versammlung am 31. Dezember vorigen Jahres, in welcher allgemein betont
wurde, der anzustellende Rabbiner müsse streng religiös sein. Man
vergleiche nun die Übereinkunft: ‚streng religiös’ – und das
Ausschreiben: ‚gemäßigt konservativ’ – ist das kein Widerspruch?
In der gleichen Versammlung wurde auf Antrag des Verwaltungsrates in
Ansbach auch der seitherige Wahlmodus geändert, indem auf je 15 Mark
Rabbinatsbeitrag für die Landgemeinden 1 Stimme kommen solle, in Ansbach
jedoch solle jeder Wahlberechtigte auch wahlfähig sein. Mit anderen
Worten: Nicht mehr die persönliche Überzeugung sollte in die Wagschale
gelegt werden, sondern – der Geldbeutel; - ist das nicht moralisch
bedenklich? Diese Wahlmodus wurde inhibiert und die Wahl nach Maßgabe der
allerhöchsten M.E. vom 24. Dezember 1844 von hoher königlichen Regierung
angeordnet. Ich war der Urheber der betreffenden Eingabe an die königliche
Regierung und wurde deswegen vom Verwaltungsrate in Ansbach in öffentlicher
wie privater Weise in der moralisch bedenklichsten Art behandelt.
Denunziationen, Insinuationen und ähnliche Waffen wurden gegen mich geführt,
allein ich wurde nicht getroffen; weil ich eben dem Schützen zu hoch
stand, reichte seine Kraft nicht aus, mich zu erreichen.
Dem ‚gemäßigt konservativen’ Ausschreiben des
Verwaltungsrates in Ansbach folgte ein Inserat meinerseits, worin ich in
Übereinstimmung meiner Freunde der Tatsache Ausdruck verlieh, die Wählerschaft
wünsche einen streng orthodoxen Rabbiner. Das brachte den Verwaltungsrat
in Ansbach außer Rand und Band. Auf solche Weise seine Kreise gestört zu
sehen, das ist auch zu arg! Der Plan war doch zu schön:
1) Gibt uns der Wahlmodus ohnehin die Schwerkraft,
2) Hält das ‚gemäßigt
konservative’ Ausschreiben überhaupt jeden Orthodoxen fern, - und das
alles durch den verflixten ‚Leutershäuser Lehrer’ vereitelt – Grund
genug, ihn zu hassen! Der macht sich aber daraus gar nichts. Er hat seinen
Plan auf Wahrheit und Recht gegründet, und weicht nicht von seinem Wege
weder rechts noch links. Die
gescheiterten Pläne haben natürlich eine neue Versammlung nötig gemacht
und hier sollte mir der letzte Stoß versetzt werden.
Meine Absicht habe ich durch meine Tätigkeit nicht erreicht, ich täuschte
mich nämlich an meinem Gegner. Ich habe ihm soviel Noblesse zugetraut,
dass er wegen prinzipieller Fragen keinen persönlichen |
 Hass
aufkommen lasse. Ich wurde von der Gemeinde Jochsberg, woselbst ich
gleichfalls die Lehrerstelle versehe, als deren Delegierter zu dieser
Versammlung geschickt. Meine Absicht war die edelste von der Welt. Ich
wollte von Mund zu Mund auf die Gefahren einer gegenseitigen Bekämpfung
wegen interner Angelegenheiten aufmerksam machen, ich wollte meine
Anschauung über den Begriff ‚orthodox’ klar legen – meine mit Herrn
Rabbiner Dr. Marx in Darmstadt darüber gepflogene Korrespondenz, die ich
vor Beginn der Versammlung offen legte, beweist das - - aber – aber,
hier kommt wieder ein Angriff von höchst moralischer Bedenklichkeit –
ich wurde vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde unter Androhung
der ‚Johannsdienste’ aus dem Saal gewiesen, noch ehe überhaupt die
Versammlung begonnen hatte. Meine schriftliche Vollmacht, die Erläuterung
meiner Wahlfähigkeit – alles half nichts – ‚der Jude wird
verbrannt’ heißt es. Von diesem Augenblicke an sah ich ein, dass es unmöglich
ist, mit solchen Leuten einen ehrlichen Kampf durchfechten zu können. Von
diesem Augenblicke an bin ich aber über nichts mehr erstaunt, es ist ja
klar: ‚Sie wissen nicht, was sie tun;’ ich bin sogar nicht mehr
erstaunt, wenn die Ansbacher Herren einen orthodoxen Kandidaten in
Vorschlag bringen würden! Doch bin ich nicht so optimistisch, dies zu
glauben. Die Ansbacher Verwaltungsräte sind auf das Wort ‚orthodox’
bitter bös zu sprechen. Woher das wohl kommen mag? Ist doch eins ehr
einflussreiches Mitglied des Verwaltungsrates ein Schüler eine sehr
orthodoxen Mannes, des seligen Rabbiner S. B. Bamberger
- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – in Würzburg! Das
Resultat der von der Anwesenheit meiner Person befreiten Versammlung ist
in einer Erklärung in Nr. 12 dieses Blattes den Lesern bekannt. Es haben
da eine Anzahl Männer mich als Friedensstörer hingestellt. Ich finde es
fast für überflüssig, zu betonen, dass nur die Absicht, den
Rabbinatsbezirk Ansbach dem unverfälschten Judentume zu erhalten, mich
zur Tätigkeit angespornt hat. Wer das nicht glauben will, der kann es
bleiben lassen. Freilich Leute, welche es als einen Ruhm betrachten, in
religiösen Dingen auf der äußersten Linken zu stehen (Anmerkung:
Vom Vorstande in Ansbach unter Zeugen gesprochen), haben keine Ahnung
davon, dass man religiöse Fragen aus edlem Antriebe behandelt. Zum
Schlusse möchte ich den Hauptcoup der Ansbacher Herren ins rechte Licht
setzen: Sollte trotz aller Mittel und Mittelchen die Kultusverwaltung in
Ansbach unterliegen – so, wird der gewählte Kandidat mit einer Strafe
von 1.000 Mark belegt!! Anders ist doch der Zusatz zur Erklärung, wonach
dem nicht gewünschten Rabbiner ein Gehaltsabzug von Mark 1.000. – in
Aussicht gestellt wird, nicht zu verstehen? Formell ist die
Kultusverwaltung in Ansbach im Recht, da diese 1.000 Mark ein großmütiges
Zugabeopfer der Gemeinde Ansbach sind; aber moralisch? Liegt hier nicht
die Rohherrschaft des Geldbeutels auf platter Hand? Erinnert das nicht an
jenes Geschichtsblatt in Israel, das immer und ewig mit Trauerrand
versehen, berichtet, dass die hohe Priesterwürde dem Meistbietenden übergeben
wurde? War jene Zeit nicht die Ursache des traurigsten Ereignisses, das
Israel je betroffen? Noch
ist es Zeit, einzulenken; ich habe die fadenscheinige Hoffnung, dass die
Kultusverwaltung in Ansbach der Orthodoxie im Distrikte durch den
Vorschlag geeigneter Persönlichkeiten entgegenkommt. Mag es aber kommen,
wie es will, so sollte es doch nicht vergessen sein, dass ein alter jüdischer
Brauch es ist, dass die Mehrheit entscheidet. Mag sie für mich oder gegen
mich ausfallen, ich gebe mich zufrieden und werde niemandem einen Groll
nachtragen. Leutershausen, 12. Februar 1894. Lehrer Oppenheimer." Hass
aufkommen lasse. Ich wurde von der Gemeinde Jochsberg, woselbst ich
gleichfalls die Lehrerstelle versehe, als deren Delegierter zu dieser
Versammlung geschickt. Meine Absicht war die edelste von der Welt. Ich
wollte von Mund zu Mund auf die Gefahren einer gegenseitigen Bekämpfung
wegen interner Angelegenheiten aufmerksam machen, ich wollte meine
Anschauung über den Begriff ‚orthodox’ klar legen – meine mit Herrn
Rabbiner Dr. Marx in Darmstadt darüber gepflogene Korrespondenz, die ich
vor Beginn der Versammlung offen legte, beweist das - - aber – aber,
hier kommt wieder ein Angriff von höchst moralischer Bedenklichkeit –
ich wurde vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde unter Androhung
der ‚Johannsdienste’ aus dem Saal gewiesen, noch ehe überhaupt die
Versammlung begonnen hatte. Meine schriftliche Vollmacht, die Erläuterung
meiner Wahlfähigkeit – alles half nichts – ‚der Jude wird
verbrannt’ heißt es. Von diesem Augenblicke an sah ich ein, dass es unmöglich
ist, mit solchen Leuten einen ehrlichen Kampf durchfechten zu können. Von
diesem Augenblicke an bin ich aber über nichts mehr erstaunt, es ist ja
klar: ‚Sie wissen nicht, was sie tun;’ ich bin sogar nicht mehr
erstaunt, wenn die Ansbacher Herren einen orthodoxen Kandidaten in
Vorschlag bringen würden! Doch bin ich nicht so optimistisch, dies zu
glauben. Die Ansbacher Verwaltungsräte sind auf das Wort ‚orthodox’
bitter bös zu sprechen. Woher das wohl kommen mag? Ist doch eins ehr
einflussreiches Mitglied des Verwaltungsrates ein Schüler eine sehr
orthodoxen Mannes, des seligen Rabbiner S. B. Bamberger
- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – in Würzburg! Das
Resultat der von der Anwesenheit meiner Person befreiten Versammlung ist
in einer Erklärung in Nr. 12 dieses Blattes den Lesern bekannt. Es haben
da eine Anzahl Männer mich als Friedensstörer hingestellt. Ich finde es
fast für überflüssig, zu betonen, dass nur die Absicht, den
Rabbinatsbezirk Ansbach dem unverfälschten Judentume zu erhalten, mich
zur Tätigkeit angespornt hat. Wer das nicht glauben will, der kann es
bleiben lassen. Freilich Leute, welche es als einen Ruhm betrachten, in
religiösen Dingen auf der äußersten Linken zu stehen (Anmerkung:
Vom Vorstande in Ansbach unter Zeugen gesprochen), haben keine Ahnung
davon, dass man religiöse Fragen aus edlem Antriebe behandelt. Zum
Schlusse möchte ich den Hauptcoup der Ansbacher Herren ins rechte Licht
setzen: Sollte trotz aller Mittel und Mittelchen die Kultusverwaltung in
Ansbach unterliegen – so, wird der gewählte Kandidat mit einer Strafe
von 1.000 Mark belegt!! Anders ist doch der Zusatz zur Erklärung, wonach
dem nicht gewünschten Rabbiner ein Gehaltsabzug von Mark 1.000. – in
Aussicht gestellt wird, nicht zu verstehen? Formell ist die
Kultusverwaltung in Ansbach im Recht, da diese 1.000 Mark ein großmütiges
Zugabeopfer der Gemeinde Ansbach sind; aber moralisch? Liegt hier nicht
die Rohherrschaft des Geldbeutels auf platter Hand? Erinnert das nicht an
jenes Geschichtsblatt in Israel, das immer und ewig mit Trauerrand
versehen, berichtet, dass die hohe Priesterwürde dem Meistbietenden übergeben
wurde? War jene Zeit nicht die Ursache des traurigsten Ereignisses, das
Israel je betroffen? Noch
ist es Zeit, einzulenken; ich habe die fadenscheinige Hoffnung, dass die
Kultusverwaltung in Ansbach der Orthodoxie im Distrikte durch den
Vorschlag geeigneter Persönlichkeiten entgegenkommt. Mag es aber kommen,
wie es will, so sollte es doch nicht vergessen sein, dass ein alter jüdischer
Brauch es ist, dass die Mehrheit entscheidet. Mag sie für mich oder gegen
mich ausfallen, ich gebe mich zufrieden und werde niemandem einen Groll
nachtragen. Leutershausen, 12. Februar 1894. Lehrer Oppenheimer." |
Zur
anstehenden Rabbinerwahl (Artikel vom Mai 1894)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1894: "Aus dem
Rabbinats-Distrikte Ansbach. Die Rabbinatswahl ist vom Stadtmagistrat
Ansbach auf Mittwoch, 25. Mai anberaumt. In den letzten Tagen geht es da
natürlich lebhaft zu. Ca. 20 Bewerbungen sind eingelaufen, von diesen dürften
diejenigen des Herrn Dr. Löwy in Birkenfeld und die des Herrn Dr. P. Kohn
in Mannheim die meiste Aussicht auf Erfolg haben. Ersterer, der Schwager
einer angesehenen Persönlichkeit in Ansbach, ist das enfant gatée der
Verwaltung in Ansbach, während letzterer von den Orthodoxen des
Wahlkreises bevorzugt wird. Interessant ist die Agitationsweise der
Ansbacher, dieselben drohen nämlich, es gehe schlimm, wenn der Wille der
Verwaltung nicht durchgesetzt werde. Aber bange machen gilt nicht. Da die
Verwaltung noch nicht weiß, ob Herr Dr. Kohn in Mannheim trotz der anfänglichen
Gegnerschaft eines Teiles der Gemeindemitglieder nicht später noch die
Sympathie derselben erwerben kann, so ist es wohl etwas gewagt, wenn
Mitglieder der Verwaltung erklären, es sei auch ferner nicht zu erwarten,
dass sich Herr Dr. Kohn ‚einleben’ könne. Auch die Orthodoxie ist
nicht lässig in der Agitation, was aus nachfolgendem Zirkular an die Wähler
erkenntlich ist. Dasselbe lautet: Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1894: "Aus dem
Rabbinats-Distrikte Ansbach. Die Rabbinatswahl ist vom Stadtmagistrat
Ansbach auf Mittwoch, 25. Mai anberaumt. In den letzten Tagen geht es da
natürlich lebhaft zu. Ca. 20 Bewerbungen sind eingelaufen, von diesen dürften
diejenigen des Herrn Dr. Löwy in Birkenfeld und die des Herrn Dr. P. Kohn
in Mannheim die meiste Aussicht auf Erfolg haben. Ersterer, der Schwager
einer angesehenen Persönlichkeit in Ansbach, ist das enfant gatée der
Verwaltung in Ansbach, während letzterer von den Orthodoxen des
Wahlkreises bevorzugt wird. Interessant ist die Agitationsweise der
Ansbacher, dieselben drohen nämlich, es gehe schlimm, wenn der Wille der
Verwaltung nicht durchgesetzt werde. Aber bange machen gilt nicht. Da die
Verwaltung noch nicht weiß, ob Herr Dr. Kohn in Mannheim trotz der anfänglichen
Gegnerschaft eines Teiles der Gemeindemitglieder nicht später noch die
Sympathie derselben erwerben kann, so ist es wohl etwas gewagt, wenn
Mitglieder der Verwaltung erklären, es sei auch ferner nicht zu erwarten,
dass sich Herr Dr. Kohn ‚einleben’ könne. Auch die Orthodoxie ist
nicht lässig in der Agitation, was aus nachfolgendem Zirkular an die Wähler
erkenntlich ist. Dasselbe lautet:
Der Stadtmagistrat Ansbach hat die Wahl eines Rabbiners für den Distrikt
Ansbach auf Mittwoch, den 23. Mai 9-1 Uhr im Magistrats-Saale festgesetzt.
Es ist nun die Frage: ‚Welchen der in Vorschlag gebrachten Kandidaten
sollen wir wählen?’
Gewiss nur einen Mann, der das Vertrauen genießt, dass er nicht nur den
berechtigten Wünschen und Anforderungen entgegenkommt, die heutzutage
allgemein an einen Rabbiner gestellt werden, sondern auch einen solchen,
dessen Charakter dafür bürgt, dass er den eigenartigen Verhältnissen in
unserem Distrikte gewachsen ist. In Erkenntnis dessen hat die erste
Versammlung der Vorstände der einzelnen Kultusgemeinden am 31. Dezember
vorigen Jahres der Meinung Ausdruck verliehen, ein Rabbiner aus Bayern
verdiene den Vorzug. |
 Wenn sich
dazu noch ein Mann findet, der sogar aus unserem Distrikte stammt, ein
Mann, dessen Familie seit uralter Zeit einen europäischen Ruf besitzt,
ein Mann, der mit den glänzendsten Zeugnissen geschmückt ist, ein Mann,
der durch seine tief durchdachten, wohl tönenden Reden berühmt ist, ein
Mann, dessen seitherige Tätigkeit davon Zeugnis gibt, dass er frei von
Fanatismus und Parteihader versöhnend auf alle religiösen Richtungen
gewirkt hat, ein Mann, dem in Folge seiner gründlichen Gelehrsamkeit auch
in profanen Wissenschaften eine Professur angeboten war, so müssen wir es
als Glück bezeichnen, wenn ein solcher Mann geneigt ist, jene Kanzel zu
betreten, wo auch ein Grünbaum seligen Andenkens ein Menschenalter
hindurch das Wort der Liebe und des Friedens, das Wort der Lehre und
Unterweisung so eindrucksvoll gepredigt hat. Wenn sich
dazu noch ein Mann findet, der sogar aus unserem Distrikte stammt, ein
Mann, dessen Familie seit uralter Zeit einen europäischen Ruf besitzt,
ein Mann, der mit den glänzendsten Zeugnissen geschmückt ist, ein Mann,
der durch seine tief durchdachten, wohl tönenden Reden berühmt ist, ein
Mann, dessen seitherige Tätigkeit davon Zeugnis gibt, dass er frei von
Fanatismus und Parteihader versöhnend auf alle religiösen Richtungen
gewirkt hat, ein Mann, dem in Folge seiner gründlichen Gelehrsamkeit auch
in profanen Wissenschaften eine Professur angeboten war, so müssen wir es
als Glück bezeichnen, wenn ein solcher Mann geneigt ist, jene Kanzel zu
betreten, wo auch ein Grünbaum seligen Andenkens ein Menschenalter
hindurch das Wort der Liebe und des Friedens, das Wort der Lehre und
Unterweisung so eindrucksvoll gepredigt hat.
Herr Rabbiner Dr. P. Kohn in Mannheim aus Gunzenhausen beziehungsweise
Kleinerdlingen stammend, ist der Mann, dessen Wahl wir Ihnen dringend ans
Herz legen. Wir können mit gutem Wissen behaupten, dass Herr Rabbiner Dr.
P. Kohn in Mannheimer in seltener Harmonie all’ das in sich vereinigt,
wodurch er für Ansbach geeignet erscheint.
Eine Rabbiner-Wahl ist ein seltenes Ereignis; sie ist aber äußerst
sichtig für die Erhaltung eines Kleinods, für die Erhaltung unserer
heiligen Religion; sie ist so wichtig, dass nach Ministerial-Entschließung
von 28. Dezember 1844 die Gültigkeit der Wahl vom Erscheinen zwei Drittel
aller Wahlberechtigten abhängig gemacht ist.
Welch’ schlechten Eindruck würde es auf die Behörde machen, welche
Waffen würden Sie den Antisemiten in die Hände liefern, wenn Sie durch
Fernbleiben die Wahl als einen Akte der Gleichgültigkeit hinstellen würden.
Wir bitten: Kommen Sie am 23. Mai nach Ansbach und wählen Sie Herrn
Rabbiner Dr. P. Kohn in Mannheim.
Das vereinigte Wahl-Komitee Ansbach und Gunzenhausen: Nath. Obermeyer,
Wolf Rosenfeld, S. Hausmann, Dr. Jochsberger, S. Hamburger, B. Wurzinger,
A. Brunn, L. Guggenheimer, M. Kellermann, M. Joelsohn, R. Seeberger, M.
Neuburger, S. Kellermann, S. Seelberger, Albert Hellmann, S. Joelsohn.
Sehr naiv ist die Zumutung
der Ansbach Herren, Herr Kohn solle zurücktreten: Nein, den Gefallen tut
er ihnen nicht, nachdem selbst die nächsten Verwandten des Vorstandes in
Ansbach für denselben tatsächlich begeistert sind. W.C." |
Rabbiner
Dr. Pinchas Kohn wurde zum neuen Rabbiner in Ansbach gewählt (1894)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. Juni 1894: "Zum Distriktsrabbiner in Ansbach ist Rabbiner
Dr. P. Cohn in Mannheim gewählt worden". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. Juni 1894: "Zum Distriktsrabbiner in Ansbach ist Rabbiner
Dr. P. Cohn in Mannheim gewählt worden". |
Feierliche Vereidigung von Distriktsrabbiner Dr. Pinchas Kohn
(1895)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1895: "Ansbach, 13. März
(1895). Heute Vormittag 11 Uhr fand im Rathaussaale durch Herrn Bürgermeister
Keller als Regierungskommissar die feierliche Vereidigung des nach Wahl
vom 23. Mai 1894 laut hoher Regierungsentschließung zum Distriktsrabbiner
ernannten Rabbiners Herrn Dr. Pinchas Kohn aus Kleinerdlingen statt. Nach
der vorgenommenen Vereidigung beglückwünschte Herr Bürgermeister Keller
den neu ernannten Distriktsrabbiner, dabei wünschend, dass es ihm trotz
der derzeitigen misslichen Verhältnisse mit Gottes Hilfe gelingen möge,
den Frieden und die Einigkeit in der israelitischen Gemeinde wieder
herzustellen. Zum Schluss stellte der Herr Bürgermeister Herrn Rabbiner
Dr. Kohn den sehr zahlreich anwesenden Vertretern der zum
Distriktsrabbinat gehörigen Kultusgemeinden als den von der königlichen
Regierung ernannten neuen Distriktsrabbiner vor, dessen Weisungen sie
nachzukommen hätten. An diese Vereidigung schloss sich um ½ 2 Uhr die
feierliche Antrittsrede des Herrn Dr. Kohn in der Synagoge, die ihres versöhnlichen,
zum Frieden und Eintracht mahnenden Charakters wie auch der gezeigten
oratorischen Begabung wegen ungeteilten Beifall fand und gewiss dahin führen
wird, des Vergangenen zu vergessen und die Streitaxt endgültig zu
begraben. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1895: "Ansbach, 13. März
(1895). Heute Vormittag 11 Uhr fand im Rathaussaale durch Herrn Bürgermeister
Keller als Regierungskommissar die feierliche Vereidigung des nach Wahl
vom 23. Mai 1894 laut hoher Regierungsentschließung zum Distriktsrabbiner
ernannten Rabbiners Herrn Dr. Pinchas Kohn aus Kleinerdlingen statt. Nach
der vorgenommenen Vereidigung beglückwünschte Herr Bürgermeister Keller
den neu ernannten Distriktsrabbiner, dabei wünschend, dass es ihm trotz
der derzeitigen misslichen Verhältnisse mit Gottes Hilfe gelingen möge,
den Frieden und die Einigkeit in der israelitischen Gemeinde wieder
herzustellen. Zum Schluss stellte der Herr Bürgermeister Herrn Rabbiner
Dr. Kohn den sehr zahlreich anwesenden Vertretern der zum
Distriktsrabbinat gehörigen Kultusgemeinden als den von der königlichen
Regierung ernannten neuen Distriktsrabbiner vor, dessen Weisungen sie
nachzukommen hätten. An diese Vereidigung schloss sich um ½ 2 Uhr die
feierliche Antrittsrede des Herrn Dr. Kohn in der Synagoge, die ihres versöhnlichen,
zum Frieden und Eintracht mahnenden Charakters wie auch der gezeigten
oratorischen Begabung wegen ungeteilten Beifall fand und gewiss dahin führen
wird, des Vergangenen zu vergessen und die Streitaxt endgültig zu
begraben.
An dem nachmittags stattgehabten Festessen zu Ehren der Installierung des
neuen Rabbiners in der königlichen Orangerie nahmen ca. 100 Personen
teil. Dasselbe verlief in der heitersten Stimmung und war durch Reden und
Toaste abwechslungsweise gewürzt.
Zunächst ergriff Herr Jakob Weil das Wort, um in kerniger Sprache ein
Hoch auf Seine Königliche Hoheit den Prinz-Regenten auszubringen, in
welches die Versammlung begeistert einstimmte. Auf ein gleichzeitig an
Seine Königliche Hoheit abgesandtes Huldigungstelegramm lief Rückantwort
ein, welches besten Dank besagte. – Hierauf sprach Herr Gustav Weil im
Auftrag des hiesigen Festkomitees um in längerer |
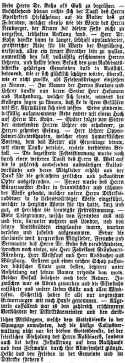 Rede Herrn
Dr. Kohn als Gast zu begrüßen. Anschließend hieran reihte sich der
Toast des Herrn Apothekers Hirschheimer auf die Mutter des zu Feiernden,
welcher ebenso wie die Worte des Herrn Neuburger, der Armen bei diesem
Feste nicht zu vergessen, lebhaften Anklang fand. – Herr Dr. Kohn dankte
dann in langer, lebhaft applaudierter, geistreicher Rede für die Worte
der Begrüßung, versprach, allen ein treuer Berater sein zu wollen,
namentlich den fest vollzählig erschienenen Herren Lehrern, und stellte
seinen Besuch den zum Rabbinatsdistrikte gehörigen Gemeinden bald in
Aussicht, betonend, wie er sich glücklich schätzen würde, überall, wie
er nicht zweifle, als Friedensbringer einziehen zu können. – Im Namen
der Herren Kantoren und Lehrer dankte nun deren Senior Herr Hofmann aus
Rothenburg, welcher sich freute, namens der Kollegen sagen zu können,
dass sie in ihren Gefühlen mit Seiner Ehrwürden sich eins wissen. Seine
zündende, beifällig aufgenommene Rede endete mit einem Hoch auf Herrn
Dr. Kohn. – Später folgte von Seiten der anwesenden Herren Lehrer ein
erhabener, zu Herzen gehender Gesang. – Herr Lehrer
Oppenheimer-Leutershausen, welcher einen humoristischen Vortrag, dem das
Wetter als Grundlage diente, mit einem Toaste vereinte, erntete verdienten
Beifall. – Die begeisterte Festesstimmung wurde noch durch einen
weiteren Toast des Herrn G. Weil auf die so zahlreich anwesenden auswärtigen
Kultusvorstände und deren Mitglieder erhöht und der Dank für die
gebrachten zeitlichen und pekuniären Opfer ausgesprochen. – Ferner
wurde des Herrn Bürgermeister Keller in freundlichster und rühmender
Weise gedacht, welcher unsern Herrn Distriktsrabbiner in so liebenswürdiger
Weise eingeführt, welcher so herzliche Worte für ihn hatte, kurz und
gut, es herrscht die freudigste Feststimmung. – Viele Telegramme, welche
von Freunden aus nah und fern, darunter mehrere aus London, und von seinen
Amtsbrüdern eingelaufen waren, wurden verlesen und jubelnd aufgenommen.
Bevor die teilweise weit hergereisten Mitglieder, Freunde und Verwandte
der Herrn Dr. Kohn sich verabschiedeten, sprachen noch einige, wie Herr
Fabrikant Grünbaum-Nürnberg, Herr Weißkopf und Herr Ansbacher aus Würzburg.
Ersterer gab einen reichen Schatz passender biblischer Zitate zum Besten,
letzterer unter Anspielung auf seinen Namen reizende bon mots.
Reicher Beifall belohnte auch diese Redner. Inzwischen war es Abend
geworden und die Eisenbahn entführte uns unsere lieben Gäste nach allen
Windrosen. Sicherlich haben sie alle nur angenehme Erinnerungen mit nach
hause genommen. – Allgemein auffallend war es den zahlreich erschienenen
Vorständen der Distriktsgemeinden und den christlichen Mitbürgern,
welche dem Gottesdienste in der Synagoge anwohnten, dass die hiesige
Kultusverwaltung nicht nur bei diesem Gottesdienste, bei der feierlichen
Einholung des Herrn Rabbiners, sondern auch bei dessen Installierung auf
dem Rathause und dem Festmahle durch ihre Abwesenheit glänzte. Heißt das
den Frieden in der Gemeinde und im Distrikte fördern?" Rede Herrn
Dr. Kohn als Gast zu begrüßen. Anschließend hieran reihte sich der
Toast des Herrn Apothekers Hirschheimer auf die Mutter des zu Feiernden,
welcher ebenso wie die Worte des Herrn Neuburger, der Armen bei diesem
Feste nicht zu vergessen, lebhaften Anklang fand. – Herr Dr. Kohn dankte
dann in langer, lebhaft applaudierter, geistreicher Rede für die Worte
der Begrüßung, versprach, allen ein treuer Berater sein zu wollen,
namentlich den fest vollzählig erschienenen Herren Lehrern, und stellte
seinen Besuch den zum Rabbinatsdistrikte gehörigen Gemeinden bald in
Aussicht, betonend, wie er sich glücklich schätzen würde, überall, wie
er nicht zweifle, als Friedensbringer einziehen zu können. – Im Namen
der Herren Kantoren und Lehrer dankte nun deren Senior Herr Hofmann aus
Rothenburg, welcher sich freute, namens der Kollegen sagen zu können,
dass sie in ihren Gefühlen mit Seiner Ehrwürden sich eins wissen. Seine
zündende, beifällig aufgenommene Rede endete mit einem Hoch auf Herrn
Dr. Kohn. – Später folgte von Seiten der anwesenden Herren Lehrer ein
erhabener, zu Herzen gehender Gesang. – Herr Lehrer
Oppenheimer-Leutershausen, welcher einen humoristischen Vortrag, dem das
Wetter als Grundlage diente, mit einem Toaste vereinte, erntete verdienten
Beifall. – Die begeisterte Festesstimmung wurde noch durch einen
weiteren Toast des Herrn G. Weil auf die so zahlreich anwesenden auswärtigen
Kultusvorstände und deren Mitglieder erhöht und der Dank für die
gebrachten zeitlichen und pekuniären Opfer ausgesprochen. – Ferner
wurde des Herrn Bürgermeister Keller in freundlichster und rühmender
Weise gedacht, welcher unsern Herrn Distriktsrabbiner in so liebenswürdiger
Weise eingeführt, welcher so herzliche Worte für ihn hatte, kurz und
gut, es herrscht die freudigste Feststimmung. – Viele Telegramme, welche
von Freunden aus nah und fern, darunter mehrere aus London, und von seinen
Amtsbrüdern eingelaufen waren, wurden verlesen und jubelnd aufgenommen.
Bevor die teilweise weit hergereisten Mitglieder, Freunde und Verwandte
der Herrn Dr. Kohn sich verabschiedeten, sprachen noch einige, wie Herr
Fabrikant Grünbaum-Nürnberg, Herr Weißkopf und Herr Ansbacher aus Würzburg.
Ersterer gab einen reichen Schatz passender biblischer Zitate zum Besten,
letzterer unter Anspielung auf seinen Namen reizende bon mots.
Reicher Beifall belohnte auch diese Redner. Inzwischen war es Abend
geworden und die Eisenbahn entführte uns unsere lieben Gäste nach allen
Windrosen. Sicherlich haben sie alle nur angenehme Erinnerungen mit nach
hause genommen. – Allgemein auffallend war es den zahlreich erschienenen
Vorständen der Distriktsgemeinden und den christlichen Mitbürgern,
welche dem Gottesdienste in der Synagoge anwohnten, dass die hiesige
Kultusverwaltung nicht nur bei diesem Gottesdienste, bei der feierlichen
Einholung des Herrn Rabbiners, sondern auch bei dessen Installierung auf
dem Rathause und dem Festmahle durch ihre Abwesenheit glänzte. Heißt das
den Frieden in der Gemeinde und im Distrikte fördern?" |
Bezirksrabbiner Dr.
Pinchas Kohn weist einen Ruf
nach Nürnberg zurück und bleibt der Gemeinde in Ansbach treu
(1908)
 Artikel in
der Zeitschrift 2Der Israelit" vom 30. April 1908: "Ansbach, 29. April
(1908). Heute gilt es, den Lesern dieses geschätzten Blattes von einer
eigenartigen und wahrhaft erhebenden Feier unserer Gemeinde zu berichten.
Unser allverehrter und beliebter Distriktsrabbiner Herr D. Kohn hat seine
Liebe zu seinen Distriktsgemeinden, in denen er seit 13 Jahren segensreich
wirkt, erneut bewiesen, indem er einen ehrenvollen Ruf der Gemeinde Adas
Isroel in Nürnberg zurückwies, um in seinem hier lieb gewonnenen Kreise
weiter zu bleiben und zu wirken. Dieses für uns so ehrenvolle und
freudige Ereignis wurde nun von den Distriktsgemeinden auf Anregung der
Gemeindeverwaltung Ansbach durch einen gemütlichen Abend gefeiert. Beim
Eintritt in den Festsaal begrüßte ein von den herbeigeeilten Lehrern des
Rabbinatsbezirks angestimmte Baruch
Haba die Familie des Herrn Rabbiners. Hierauf ergriff Herr Jakob Weil,
Vorsteher der Gemeinde Ansbach das Wort zu einer schwungvollen, von Herzen
kommeden Rede, die in ein begeistertes Hoch auf Herrn Dr. Kohn ausklang.
Gleiche Gefühle bekundete Herr Wimpfheimer als Vertreter der Gemeinde
Rothenburg o.T. Herr Kantor Krämer
– Ansbach trug sodann den Psalm 30 vor, worauf Herr Dr. D. Brader, der
Assistent des Herrn Distriktsrabbiners, auf die Familie des Gefeierten
toastierte. Namens der Lehrer sprach Herrn Volksschullehrer Marx –
Gunzenhausen und drückte den Dank derselben für das allezeit verständnisvolle
Entgegenkommen und für die wissenschaftliche Leitung der monatlichen
Fortbildungskonferenzen in herzlichen Worten aus. Auch die jüdischen
Gymnasialschüler Ansbachs hatten ihren Sprecher in dem Oberprimaner Fritz
Ansbacher entsandt. Herr Dr. Kohn – sein
Licht leuchte – erwiderte nun auf all die herzlichen Worte, die ihn
tief bewegten und sprach von den Gedanken und Gefühlen, die ihn in den
aufregenden Wochen des inneren Kampfes beschäftigten. Die meisterhafte
Rede, die in ein Hoch auf den Rabbinatsbezirk Ansbach ausklang, hinterließ
einen tiefen Eindruck. Es folgten darnach noch einige humoristische
Toaste, von Herrn Adler – Roth, von Herrn Lehrer Adler – Ansbach, und
von Herrn Rabbiner Dr. Brader. Auch Herr Dr. Kohn sprach aus freudig
gestimmtem Herzen noch einmal ein humorvolles Dankeswort. In später
Stunde schieden die Gäste mit dem frohen Bewusststein unseren Herrn
Rabbiner dem Distrikte wiedergewonnen zu haben. – th -." Artikel in
der Zeitschrift 2Der Israelit" vom 30. April 1908: "Ansbach, 29. April
(1908). Heute gilt es, den Lesern dieses geschätzten Blattes von einer
eigenartigen und wahrhaft erhebenden Feier unserer Gemeinde zu berichten.
Unser allverehrter und beliebter Distriktsrabbiner Herr D. Kohn hat seine
Liebe zu seinen Distriktsgemeinden, in denen er seit 13 Jahren segensreich
wirkt, erneut bewiesen, indem er einen ehrenvollen Ruf der Gemeinde Adas
Isroel in Nürnberg zurückwies, um in seinem hier lieb gewonnenen Kreise
weiter zu bleiben und zu wirken. Dieses für uns so ehrenvolle und
freudige Ereignis wurde nun von den Distriktsgemeinden auf Anregung der
Gemeindeverwaltung Ansbach durch einen gemütlichen Abend gefeiert. Beim
Eintritt in den Festsaal begrüßte ein von den herbeigeeilten Lehrern des
Rabbinatsbezirks angestimmte Baruch
Haba die Familie des Herrn Rabbiners. Hierauf ergriff Herr Jakob Weil,
Vorsteher der Gemeinde Ansbach das Wort zu einer schwungvollen, von Herzen
kommeden Rede, die in ein begeistertes Hoch auf Herrn Dr. Kohn ausklang.
Gleiche Gefühle bekundete Herr Wimpfheimer als Vertreter der Gemeinde
Rothenburg o.T. Herr Kantor Krämer
– Ansbach trug sodann den Psalm 30 vor, worauf Herr Dr. D. Brader, der
Assistent des Herrn Distriktsrabbiners, auf die Familie des Gefeierten
toastierte. Namens der Lehrer sprach Herrn Volksschullehrer Marx –
Gunzenhausen und drückte den Dank derselben für das allezeit verständnisvolle
Entgegenkommen und für die wissenschaftliche Leitung der monatlichen
Fortbildungskonferenzen in herzlichen Worten aus. Auch die jüdischen
Gymnasialschüler Ansbachs hatten ihren Sprecher in dem Oberprimaner Fritz
Ansbacher entsandt. Herr Dr. Kohn – sein
Licht leuchte – erwiderte nun auf all die herzlichen Worte, die ihn
tief bewegten und sprach von den Gedanken und Gefühlen, die ihn in den
aufregenden Wochen des inneren Kampfes beschäftigten. Die meisterhafte
Rede, die in ein Hoch auf den Rabbinatsbezirk Ansbach ausklang, hinterließ
einen tiefen Eindruck. Es folgten darnach noch einige humoristische
Toaste, von Herrn Adler – Roth, von Herrn Lehrer Adler – Ansbach, und
von Herrn Rabbiner Dr. Brader. Auch Herr Dr. Kohn sprach aus freudig
gestimmtem Herzen noch einmal ein humorvolles Dankeswort. In später
Stunde schieden die Gäste mit dem frohen Bewusststein unseren Herrn
Rabbiner dem Distrikte wiedergewonnen zu haben. – th -." |
Dr.
David Brader wurde zum Distriktsrabbiner gewählt (1917)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. April 1917: "Aus Ansbach wird berichtet. An
Stelle des zur Zivilverwaltung in Warschau einberufenen Distriktsrabbiners
Dr. P. Kohn, hier, wurde der Königliche Reallehrer Dr. David
Brader in Nürnberg zum Distriktsrabbiner dahier gewählt. Die zum
Distriktsrabbinat Ansbach gehörigen 21 israelitischen Kultusgemeinden
hatten sich auf die Person des neu zu erwählenden Rabbiners geeinigt und
gebeten, von einem Ausschreiben der Stelle Abstand zu
nehmen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. April 1917: "Aus Ansbach wird berichtet. An
Stelle des zur Zivilverwaltung in Warschau einberufenen Distriktsrabbiners
Dr. P. Kohn, hier, wurde der Königliche Reallehrer Dr. David
Brader in Nürnberg zum Distriktsrabbiner dahier gewählt. Die zum
Distriktsrabbinat Ansbach gehörigen 21 israelitischen Kultusgemeinden
hatten sich auf die Person des neu zu erwählenden Rabbiners geeinigt und
gebeten, von einem Ausschreiben der Stelle Abstand zu
nehmen." |
Rundschreiben
von Rabbiner Dr. Pinchas Kohn (1919)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 14. März 1919: "Deutsches Reich. Ein Rundschreiben Rabbiners
Dr.- Kohn - Ansbach. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 14. März 1919: "Deutsches Reich. Ein Rundschreiben Rabbiners
Dr.- Kohn - Ansbach.
Rabbiner Dr. Pinchas Kohn - Ansbach versandte in seinem
Rabbinatsbezirk folgendes Rundschreiben:
'Jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen! Angesichts des Versuches, die
Juden als international zu erklären, sehen wir uns veranlasst, Folgendes
zu erklären:
1. Die Gemeinschaft der Juden beruht auf der Religion. Wer jüdische
Religion verlässt, verlässt die jüdische Gemeinschaft.
2. Alle Ansprüche, welche die so geartete jüdische Gemeinschaft an die
Regierungen ihres Heimatlandes zu stellen hat, fließen lediglich aus
diesem religiösen Grundcharakter.
3. International im Judentum ist lediglich die Religion.
4. Wir haben keinerlei jüdisch-nationalistische Forderungen zu
erheben.
5. Wir bekennen uns als bayerische und deutsche Staatsbürger jüdischen
Glaubens.
6. Es ist Pflicht jeden bayrischen Juden, über dieses sein Verhältnis
zum Staate dem Staate und seinen christlichen Mitbürgern volle Klarheit
zu geben.
7. Als Bayern und Deutsche erklären wir, im Interesse unseres Vaterlandes
den Antisemitismus bekämpfen zu müssen.
8. Wenn die Friedenskonferenz Palästinas einer unbeschränkten
Siedelung durch Juden erschließt, so gebietet es lediglich die religiöse
Pflicht, diese auf Grundlage des Religionsgesetzes zu errichtenden
Siedlungen zu fördern.'
Für uns hat das Rundschreiben das besondere Interesse, dass es uns zeigt,
wie Dr. Kohn seine Aufgaben - auch in Polen aufgefasst hat." |
Ausschreibung der Stelle des Distriktrabbiners (1925)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 3.
Dezember 1925: "Die Stelle eines Distriktrabbiners für den
Rabbinatsdistrikt Ansbach ist zu besetzen. Wir bitten, Angebote von
reichsdeutschen Bewerbern (orthodox) mit Lebenslauf und Lichtbild an den
Vorstand, Fabrikbesitzer L. Dietenhöfer, einzureichen. Verwaltung der
israelitischen Kultusgemeinde Ansbach." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 3.
Dezember 1925: "Die Stelle eines Distriktrabbiners für den
Rabbinatsdistrikt Ansbach ist zu besetzen. Wir bitten, Angebote von
reichsdeutschen Bewerbern (orthodox) mit Lebenslauf und Lichtbild an den
Vorstand, Fabrikbesitzer L. Dietenhöfer, einzureichen. Verwaltung der
israelitischen Kultusgemeinde Ansbach." |
| |
 Dieselbe
Anzeige erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3.
Dezember 1925. Dieselbe
Anzeige erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3.
Dezember 1925. |
Feierliche Amtseinführung des Distriktrabbiners Dr. Elie Munk (1926)
 Artikel in
der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Mai 1926: "Ansbach.
Am 15. April (1926) erfolgte in hiesiger Kultusgemeinde die feierliche
Amtseinführung des neugewählten Rabbiners Herrn Distriktrabbiners Dr.
Elie Munk aus Berlin. Im Gemeindesitzungssaale ging der amtliche Teil vor
sich. Von dem bisherigen Verweser des Rabbinats Herrn Distriktsrabbiner
Dr. Weinberg aus Neumarkt dorthin geleitet, begrüßte der Vorstand der
Kultusgemeinde Ansbach Herr Ludwig Dietenhöfer im Namen der Gemeinde den
geistlichen Führer mit warmen Worten, worauf die Verträge unterschrieben
wurden. Nun erfolgte die Vorstellung der fast aus allen Distriktsgemeinden
erschienenen Vorsteher und Beamten. Im Namen des ersteren hieß Herr
Neumann (Gunzenhausen), namens der letzteren Herr Hauptlehrer Levite
(Gunzenhausen) das geistige Oberhaupt des Distriktes herzlich willkommen.
Eine Schülerin begrüßte unter Überreichung eines herrlichen
Blumenstraußes ihren zukünftigen Lehrer. In feierlichem Zuge wurde Herr
Dr. Munk in die festlich geschmückt Synagoge geleitet. Ein mächtiger
Knabenchor entbot hier den Willkommengruß. In tief empfundener Rede übergab
Herr Distriktrabbiner Dr. Weinberg seinem jungen Amtsbruder das
Seelsorgeamt. In warmer, zündender Rede gelobte Herr Distriktsrabbiner
Dr. Munk Treue der Gemeinde, Treue dem Distrikt und edle Duldung gegen
jedermann. Einige Gesänge des Kantors trugen zur Vervollkommnung des
feierlichen Aktes bei. Im Restaurant Jochsberger kam auch der gemütliche
Teil zu seinem Recht. – Möge das Wirken des neu gewählten Herrn
Rabbiner Dr. Munk von reichem Erfolg gekrönt sein!" Artikel in
der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Mai 1926: "Ansbach.
Am 15. April (1926) erfolgte in hiesiger Kultusgemeinde die feierliche
Amtseinführung des neugewählten Rabbiners Herrn Distriktrabbiners Dr.
Elie Munk aus Berlin. Im Gemeindesitzungssaale ging der amtliche Teil vor
sich. Von dem bisherigen Verweser des Rabbinats Herrn Distriktsrabbiner
Dr. Weinberg aus Neumarkt dorthin geleitet, begrüßte der Vorstand der
Kultusgemeinde Ansbach Herr Ludwig Dietenhöfer im Namen der Gemeinde den
geistlichen Führer mit warmen Worten, worauf die Verträge unterschrieben
wurden. Nun erfolgte die Vorstellung der fast aus allen Distriktsgemeinden
erschienenen Vorsteher und Beamten. Im Namen des ersteren hieß Herr
Neumann (Gunzenhausen), namens der letzteren Herr Hauptlehrer Levite
(Gunzenhausen) das geistige Oberhaupt des Distriktes herzlich willkommen.
Eine Schülerin begrüßte unter Überreichung eines herrlichen
Blumenstraußes ihren zukünftigen Lehrer. In feierlichem Zuge wurde Herr
Dr. Munk in die festlich geschmückt Synagoge geleitet. Ein mächtiger
Knabenchor entbot hier den Willkommengruß. In tief empfundener Rede übergab
Herr Distriktrabbiner Dr. Weinberg seinem jungen Amtsbruder das
Seelsorgeamt. In warmer, zündender Rede gelobte Herr Distriktsrabbiner
Dr. Munk Treue der Gemeinde, Treue dem Distrikt und edle Duldung gegen
jedermann. Einige Gesänge des Kantors trugen zur Vervollkommnung des
feierlichen Aktes bei. Im Restaurant Jochsberger kam auch der gemütliche
Teil zu seinem Recht. – Möge das Wirken des neu gewählten Herrn
Rabbiner Dr. Munk von reichem Erfolg gekrönt sein!"
|
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1926: "Ansbach, 22. April
(1926). Am 2. Rosch Chodesch Ijar
erfolgte in unserer Gemeinde die feierliche Amtseinführung des neu gewählten
Rabbiners Herrn Distriktrabbiners Dr. Elie Munk aus Berlin. Im
Gemeindesitzungssaale ging der amtliche Teil vor sich. Von dem bisherigen
Verweser des Rabbinates Herrn Distriktsrabbiner Dr. Weinberg aus Neumarkt
dorthin geleitet, begrüßte der Vorstand der Kultusgemeinde Ansbach, Herr
Ludwig Dietenhöfer im Namen der Gemeinde den geistlichen Führer mit
warmen Worten, worauf die Verträge unterschrieben wurden. Nun erfolgte
die Vorstellung der fast aus allen Distriktsgemeinden erschienenen
Vorstehern und Beamten. Im Namen der ersteren hieß Herr Neumann - Gunzenhausen, namens der letzteren Herr Hauptlehrer
Levite - Gunzenhausen das geistige Oberhaupt des Distrikts herzlich
willkommen. Eine Schülerin begrüßte unter Überreichung eines
herrlichen Blumenstraußes ihren zukünftigen Lehrer. In feierlichem Zuge
wurde Herr Dr. Munk in die festlich geschmückte Synagoge geleitet. Ein mächtiger
Knabenchor entbot hier den Willkommensgruß. In tief empfundener Rede übergab
Herr Distriktsrabbiner Dr. Weinberg dem jungen Amtsbruder das
Seelsorgeamt. In warm empfundener Rede gelobte Herr Distriktsrabbiner Dr.
Munk der Gemeinde, Treu dem
Distrikt und edle Duldung gegen jedermann. Einige Gesänge des Kantors
trugen zur Vervollkommnung des feierlichen Aktes bei. Im Restaurant
Jochsberger kam auch der gemütliche Teil zu seinem Recht. – Möge das
Wirken des neu gewählten Herrn Rabbiners Dr. Munk von reichem Erfolg gekrönt
sein." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1926: "Ansbach, 22. April
(1926). Am 2. Rosch Chodesch Ijar
erfolgte in unserer Gemeinde die feierliche Amtseinführung des neu gewählten
Rabbiners Herrn Distriktrabbiners Dr. Elie Munk aus Berlin. Im
Gemeindesitzungssaale ging der amtliche Teil vor sich. Von dem bisherigen
Verweser des Rabbinates Herrn Distriktsrabbiner Dr. Weinberg aus Neumarkt
dorthin geleitet, begrüßte der Vorstand der Kultusgemeinde Ansbach, Herr
Ludwig Dietenhöfer im Namen der Gemeinde den geistlichen Führer mit
warmen Worten, worauf die Verträge unterschrieben wurden. Nun erfolgte
die Vorstellung der fast aus allen Distriktsgemeinden erschienenen
Vorstehern und Beamten. Im Namen der ersteren hieß Herr Neumann - Gunzenhausen, namens der letzteren Herr Hauptlehrer
Levite - Gunzenhausen das geistige Oberhaupt des Distrikts herzlich
willkommen. Eine Schülerin begrüßte unter Überreichung eines
herrlichen Blumenstraußes ihren zukünftigen Lehrer. In feierlichem Zuge
wurde Herr Dr. Munk in die festlich geschmückte Synagoge geleitet. Ein mächtiger
Knabenchor entbot hier den Willkommensgruß. In tief empfundener Rede übergab
Herr Distriktsrabbiner Dr. Weinberg dem jungen Amtsbruder das
Seelsorgeamt. In warm empfundener Rede gelobte Herr Distriktsrabbiner Dr.
Munk der Gemeinde, Treu dem
Distrikt und edle Duldung gegen jedermann. Einige Gesänge des Kantors
trugen zur Vervollkommnung des feierlichen Aktes bei. Im Restaurant
Jochsberger kam auch der gemütliche Teil zu seinem Recht. – Möge das
Wirken des neu gewählten Herrn Rabbiners Dr. Munk von reichem Erfolg gekrönt
sein." |
Geburtsanzeige der Tochter von Rabbiner Dr. Elie Munk
und seiner Frau Fanny geb. Goldberger (1928)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Mit Gottes Hilfe. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Mit Gottes Hilfe.
In
dankerfüllter Freude zeigen die Gott
sei gepriesen glückliche Geburt einer kräftigen Tochter an
Rabbiner
Dr. Elie Munk und Frau Fanny geb. Goldberger.
Ansbach, 31. Mai 1928/ 13.
Siwan 5688". |
Publikation von Rabbiner Dr. Elie Munk (1933)
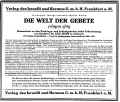 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1933:
"Verlag des Israelit und Hermon G.m.b.H. Frankfurt am Main. In
unserem Verlage erscheint nächste Woche: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1933:
"Verlag des Israelit und Hermon G.m.b.H. Frankfurt am Main. In
unserem Verlage erscheint nächste Woche:
Die Welt der Gebete. Olam Hatefilot. Kommentar zu den Werktags- und
Sabbatgebeten, nebst Übersetzung von Rabbiner Dr. Elie Munk in Ansbach.
374 Seiten Groß-Oktav. - Preis in gediegenem Leinwandband Mark
6.50.
Zum weiteren Lesen der Anzeige bitte anklicken. |
Artikel von Rabbiner Dr. Eli Munk über Pijutim (1937)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1937: "Die Pijutim. Von
Rabbiner Dr. Eli Munk in Ansbach. Die
Pijutim bilden seit alters her einen Grundbestandteil der Festgebete und
reichen in ihren Ursprüngen in die Zeiten der Amoräer und Gaonim zurück,
wahrscheinlich sogar bis in die Zeiten der Tannaiten. Bei ihrer Abfassung
war vor allem die Absicht maßgebend, den Gottesdienst an den Feiertagen
zu vertiefen, und ihn gleichzeitig auszuschmücken. Bereits die Rischonim
bezeichnnen daher die Einbeziehung der Pijutim in die Gebetordnung als
eine ausgezeichnete Mizwa (hebräisch: ausgezeichnete
Mizwa, ‚weil durch sie die Andacht des Menschen auf Gott gerichtet
wird.’ Hirsch charakterisiert das Wesen der Pijutim folgendermaßen:
‚Sie sind allesamt nichts anderes, als vollendetere Ausführung der
Tagesbedeutung und der aus ihr fürs Leben fließenden Gedanken. Aus dem
Schatz jüdischer Wissenschaft ist dem Paiton der Tag nach seiner
geschichtlichen und gesetzlichen Seite und nach den über beides
ausgesprochenen Ansichten unserer Chachomim gegenwärtig, und von ihm erfüllt
tritt er uns bei den einzelnen Teilen des Gottesdienstes entgegen, den
innewohnenden begriff im Lichte der Tagesbedeutung vollendend’ (Choreb
§ 671(. Ähnlich erläutert Sachs: ‚Der unerschöpfliche Reichtum der
Hagada ergoss sich in die religiöse Poesie, die nunmehr die
Nationalliteratur, die nationale Geschichte und den Glaubens-, nicht
selten auch den Gesetzesinhalt in das Gebet verwebte, und selber ein
Ausdruck ward der gesamten Taten und Leiden Israel’ (Religiöse Poesie,
180). Mit Hinblick auf die Tatsache, dass die Pijutim auch oftmals die im
Laufe der Jahrhunderte bis tief in die Zeit des Mittelalters erlebten
Verfolgungen und Leiden zum Inhalt haben und daran anschließend die
wunderbare Hilfe Gottes feiern, nennt Zunz die Pijutim die ‚Begleiterin
der Geschichte des Judentums. Sie sind die Denkmäler der Vorfahren, und
der von ihnen erfüllte Gottesdienst wurde das in tausendjährigen
Gefechten emporgehaltene Panier Israels’ (Literatur der synagogalen
Poesie, Vorwort). Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1937: "Die Pijutim. Von
Rabbiner Dr. Eli Munk in Ansbach. Die
Pijutim bilden seit alters her einen Grundbestandteil der Festgebete und
reichen in ihren Ursprüngen in die Zeiten der Amoräer und Gaonim zurück,
wahrscheinlich sogar bis in die Zeiten der Tannaiten. Bei ihrer Abfassung
war vor allem die Absicht maßgebend, den Gottesdienst an den Feiertagen
zu vertiefen, und ihn gleichzeitig auszuschmücken. Bereits die Rischonim
bezeichnnen daher die Einbeziehung der Pijutim in die Gebetordnung als
eine ausgezeichnete Mizwa (hebräisch: ausgezeichnete
Mizwa, ‚weil durch sie die Andacht des Menschen auf Gott gerichtet
wird.’ Hirsch charakterisiert das Wesen der Pijutim folgendermaßen:
‚Sie sind allesamt nichts anderes, als vollendetere Ausführung der
Tagesbedeutung und der aus ihr fürs Leben fließenden Gedanken. Aus dem
Schatz jüdischer Wissenschaft ist dem Paiton der Tag nach seiner
geschichtlichen und gesetzlichen Seite und nach den über beides
ausgesprochenen Ansichten unserer Chachomim gegenwärtig, und von ihm erfüllt
tritt er uns bei den einzelnen Teilen des Gottesdienstes entgegen, den
innewohnenden begriff im Lichte der Tagesbedeutung vollendend’ (Choreb
§ 671(. Ähnlich erläutert Sachs: ‚Der unerschöpfliche Reichtum der
Hagada ergoss sich in die religiöse Poesie, die nunmehr die
Nationalliteratur, die nationale Geschichte und den Glaubens-, nicht
selten auch den Gesetzesinhalt in das Gebet verwebte, und selber ein
Ausdruck ward der gesamten Taten und Leiden Israel’ (Religiöse Poesie,
180). Mit Hinblick auf die Tatsache, dass die Pijutim auch oftmals die im
Laufe der Jahrhunderte bis tief in die Zeit des Mittelalters erlebten
Verfolgungen und Leiden zum Inhalt haben und daran anschließend die
wunderbare Hilfe Gottes feiern, nennt Zunz die Pijutim die ‚Begleiterin
der Geschichte des Judentums. Sie sind die Denkmäler der Vorfahren, und
der von ihnen erfüllte Gottesdienst wurde das in tausendjährigen
Gefechten emporgehaltene Panier Israels’ (Literatur der synagogalen
Poesie, Vorwort).
Eine ganz anders gerichtete Auffassung über die Entstehungsursache der
Pijutim ergibt sich aus folgender Äußerung des R. Jehuda B. Barsilai aus
Barcelona: ‚Die Pijutim, die man in das Gebet einzuflechten pflegt,
sind, nach Mitteilungen von Autoritäten, nur für Zeiten der Verfolgungen
angeordnet worden. Die Feinde hatten nämlich das Torastudium verboten,
sowie das Zitieren von Torawarten, darum haben die Weisen eingeführt,
dass Dankgebete, Hymnen, Pijutim usw. eingeschaltet werden, in denen im
Rahmen der Tefilla den Ungelehrten die Vorschriften über ein jedes Fest
und die Einzelheiten der Mizwot vorgeführt werden’ Sefer HaEtim, ed. Schor, Berlin 1903, S. 252). Aus den weiteren Ausführungen
daselbst geht hervor, dass sich die Pijutim späterhin auch nach Aufhören
der Verfolgungen gegen den Willen ihrer Verfasser fest eingebürgert
haben, was mit dem oben erwähnten Verlangen zusammenhängen mochte, den
Gottesdienst der festlichen tage nach Möglichkeit durch poetische
Einlagen zu verschönern. Auch in anderen Quellen arabischen Ursprungs
wird die gleiche Ursache für die Entstehung der Pijutim angegeben und auf
die persischen Judenverfolgungen hingewiesen, die im 5. und 6. Jahrhundert
stattfanden. Jedenfalls gibt diese Begründung eine Erklärung für den
allgemein auffallenden Umstand, dass die Ausdrucksweise die Paitanim eine
sehr dunkle und rätselhafte ist. Sie waren eben gezwungen, die ‚Worte
der Tora und ihre Vorschriften’ in verschleierter Form zu zitieren. Es
ist aber auch möglich, dass diese Ausdrucksweise dem Wunsch entsprang,
den Pijutim eine künstlerische Form zu verleihen, deren Reiz durch die
Verschleierung gerade erhöht wird."
. |
Aus
der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Jüdische Lehrer und Kantoren
Ausschreibung
der Stelle des Vorsänger und Schochet (1846)
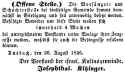 Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. August 1846: "(Offene
Stelle.) Die Vorsänger- und Schächterstelle bei diesseitiger Gemeinde
kommt demnächst in Erledigung und soll anderweitig besetzt werden. Befähigte
Bewerber um diese Stelle wollen sich innerhalb 4 Wochen bei
unterzeichnetem Vorstande unter Vorlage ihrer Zeugnisse melden, woselbst
sie auch die Bedingnisse erfahren können. Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. August 1846: "(Offene
Stelle.) Die Vorsänger- und Schächterstelle bei diesseitiger Gemeinde
kommt demnächst in Erledigung und soll anderweitig besetzt werden. Befähigte
Bewerber um diese Stelle wollen sich innerhalb 4 Wochen bei
unterzeichnetem Vorstande unter Vorlage ihrer Zeugnisse melden, woselbst
sie auch die Bedingnisse erfahren können.
Ansbach, den 26. August 1846.
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde. Josephthal. Kitzinger". |
Lehrer
H. Hofmann kommt aus Cronheim nach Ansbach - Ausschreibung der Stelle in
Cronheim (1876)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1876:
"Erledigte Elementarlehrer-Stelle. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1876:
"Erledigte Elementarlehrer-Stelle.
Durch Beförderung unseres
bisherigen Lehrers Herrn Hofmann als Elementarlehrer nach Ansbach ist die
hiesige Elementarlehrer-Stelle verbunden mit der Vorsängerfunktion in
Erledigung gekommen und soll so rasch als möglich besetzt werden. Das
Einkommen besteht aus einem fixen Ertrage von Mark 771,75 inklusive
Staatszuschuss als Lehrer, Mark 175 als Vorsänger, sowie bedeutende
Nebenverdienste und freie Wohnung. Bewerber, welche die Funktion eines
Schlächters übernehmen könnten, würden ihr Einkommen wesentlich
erhöhen, sodass sich dann das Gesamteinkommen auf 1.400 Mark beläuft.
Bewerbungsgesuche mit den vorschriftsmäßigen Zeugnissen belegt, sind
innerhalb 14 Tagen einzureichen an die Kultusverwaltung. Kronheim. Königliches
Bezirksamt Gunzenhausen." |
Ausschreibung
der Stelle des Kantors und Schochet (1893)
Anmerkung: Auf Grund der Größe der Gemeinde wurde in Ansbach
das Amt des Elementarlehrers und das Amt des Kantors und Schochet mit je einer
Person besetzt.
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Mai 1893: "Erledigte Kantor-
und Schochet-Stelle. In der Gemeinde Ansbach, Kreishauptstadt von
Mittelfranken, ist die Kantor- und Schochetstelle bei einem fixen Gehalt
von 1.800 Mark und nicht unbedeutenden Nebenverdiensten nebst freier
Dienstwohnung im Gemeindehaus bis zum 1. August in diesem Jahr zu
besetzen. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Mai 1893: "Erledigte Kantor-
und Schochet-Stelle. In der Gemeinde Ansbach, Kreishauptstadt von
Mittelfranken, ist die Kantor- und Schochetstelle bei einem fixen Gehalt
von 1.800 Mark und nicht unbedeutenden Nebenverdiensten nebst freier
Dienstwohnung im Gemeindehaus bis zum 1. August in diesem Jahr zu
besetzen.
Reflektanten, welche musikalisch gebildet, im Besitze einer guten Stimme
sind, die Schochetautorisation von orthodoxen Rabbinern haben, wollen sich
innerhalb 14 Tagen unter Angabe ihrer Nationalität und ihres
Familienstandes, versehen mit den legalen Attesten an den Unterzeichneten
wenden.
Ansbach, den 15. Mai 1893. Der Kultus-Vorstand: J. Selling."
Anmerkung: obige Ausschreibung wurde nach dem Weggang von Maier
Sternberger s.u. vorgenommen; Nachfolger von Sternberger wurde Simon
Krämer. |
Zum Abschied von Maier Sternberger, 1856 - 1893 Kantor, Schochet und Mohel in
der jüdischen Gemeinde
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. August 1893:
"Ansbach, 1. August: Das Hinausziehen des Gerechten von dem Ort macht
Eindruck. Die Richtigkeit dieses Satzes bestätigte sich wieder bei der
Amtsniederlegung und bei dem Wegzuge unseres seit über 37 Jahren in
hiesiger Kultusgemeinde lebenden Herrn Maier Sternberger. Derselbe
bekleidete während dieser Zeit die Stelle eines Kantors und Schochets mit
größter Gewissenhaftigkeit, mit strenger Pflichttreue und in wahrhaft
religiösem Sinne. Ausgestattet mit einer prächtigen Tenorstimme,
durchdringen von einer charakterfesten, religiösen Gesinnung machte sein
Vortrag auch auf die Hörer einen überwältigenden, zur tiefen Andacht
stimmenden Eindruck. Man merkte dem Ton und Vortrag an, dass das Herz
dabei ist und deshalb gingen sie wieder zu Herzen. Als tüchtiger Mokel
(Beschneider) genoss derselbe großes Vertrauen und wurde zur Ausübung
dieses heiligen Aktes in die entferntesten Orte berufen. Aber auch seine
Frau zeichnet sich durch echt jüdische Frauentugenden aus. Anspruchslos
und bescheiden, suchte sie stets zu helfen und zu trösten, wo es Not tat.
Die Armen hiesiger Stadt ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses
verlieren in ihr eine große Wohltäterin. Deshalb wird der Wegzug dieses
braven Ehepaares aus hiesiger Stadt allgemein bedauert. In tief
ergreifenden Worten unter Zugrundelegung des Sidra-Satzes ... dankte unser
allverehrter Herr Rabbiner - sein Licht leuchte - in einer
Sabbat-Nachmittag-Predigt Herrn Sternberger für die der Gemeinde
geleisteten Dienste, für seine Charaktersfestigkeit, für die Taten der
Freundschaft und Liebe. Die hiesige Kultusverwaltung, die Chewra Kadischa,
der Frauenverein suchten dem scheidenden Paare durch wertvolle und sinnige
Geschenke Beweis zu geben, wie ihre Verdienste von den Beteiligten
gewürdigt und anerkannt werden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. August 1893:
"Ansbach, 1. August: Das Hinausziehen des Gerechten von dem Ort macht
Eindruck. Die Richtigkeit dieses Satzes bestätigte sich wieder bei der
Amtsniederlegung und bei dem Wegzuge unseres seit über 37 Jahren in
hiesiger Kultusgemeinde lebenden Herrn Maier Sternberger. Derselbe
bekleidete während dieser Zeit die Stelle eines Kantors und Schochets mit
größter Gewissenhaftigkeit, mit strenger Pflichttreue und in wahrhaft
religiösem Sinne. Ausgestattet mit einer prächtigen Tenorstimme,
durchdringen von einer charakterfesten, religiösen Gesinnung machte sein
Vortrag auch auf die Hörer einen überwältigenden, zur tiefen Andacht
stimmenden Eindruck. Man merkte dem Ton und Vortrag an, dass das Herz
dabei ist und deshalb gingen sie wieder zu Herzen. Als tüchtiger Mokel
(Beschneider) genoss derselbe großes Vertrauen und wurde zur Ausübung
dieses heiligen Aktes in die entferntesten Orte berufen. Aber auch seine
Frau zeichnet sich durch echt jüdische Frauentugenden aus. Anspruchslos
und bescheiden, suchte sie stets zu helfen und zu trösten, wo es Not tat.
Die Armen hiesiger Stadt ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses
verlieren in ihr eine große Wohltäterin. Deshalb wird der Wegzug dieses
braven Ehepaares aus hiesiger Stadt allgemein bedauert. In tief
ergreifenden Worten unter Zugrundelegung des Sidra-Satzes ... dankte unser
allverehrter Herr Rabbiner - sein Licht leuchte - in einer
Sabbat-Nachmittag-Predigt Herrn Sternberger für die der Gemeinde
geleisteten Dienste, für seine Charaktersfestigkeit, für die Taten der
Freundschaft und Liebe. Die hiesige Kultusverwaltung, die Chewra Kadischa,
der Frauenverein suchten dem scheidenden Paare durch wertvolle und sinnige
Geschenke Beweis zu geben, wie ihre Verdienste von den Beteiligten
gewürdigt und anerkannt werden.
Möchte des Herrn und Frau Sternberger vergönnt sein, in ihrem
nunmehrigen Domizil Harburg viele, viele Jahre gesund, glücklich und
zufrieden verleben zu können. Dies gebe der allgültige Gott.
H. Hofmann".
Anmerkung: der Verfasser H. Hofmann war von 1876 bis 1893 Lehrer der jüdischen
Gemeinde, siehe nächster Artikel |
Zum Tod von Maier Sternberger
(1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Harburg,
Schwaben. Am Sonntag, 7. Juli, wurde ein Mann hier zu Grabe getragen, der
es wohl verdient, dass seiner in diesen geschätzten Blättern gedacht
werde, da sein Lebensgang für jeden wahren Jehudi vorbildlich sein
dürfte. Es war Meier Sternberger seligen Andenkens, den man unter
großer Beteiligung seitens der jüdischen und nichtjüdischen
Bevölkerung zur letzten Ruhe bestattete. Der reiche Lebensinhalt des
Zadik hanedor kann hier nur in skizzenhafter Kürze angedeutet
werden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Harburg,
Schwaben. Am Sonntag, 7. Juli, wurde ein Mann hier zu Grabe getragen, der
es wohl verdient, dass seiner in diesen geschätzten Blättern gedacht
werde, da sein Lebensgang für jeden wahren Jehudi vorbildlich sein
dürfte. Es war Meier Sternberger seligen Andenkens, den man unter
großer Beteiligung seitens der jüdischen und nichtjüdischen
Bevölkerung zur letzten Ruhe bestattete. Der reiche Lebensinhalt des
Zadik hanedor kann hier nur in skizzenhafter Kürze angedeutet
werden.
Meier Sternberger war in Deggingen
bei Nördlingen geboren, ein Sohn des frommen Naftali Sternberger,
der dort Vorbeter und Mohel war. Den Grundsätzen und Lehren des
Elternhauses blieb der Verstorbene zeitlebens treu. Nciht weniger als 37
Jahre wirkte er als Chasan und Schochet in Ansbach, und war ein
gewandter, weithin gesuchter Mohel, welches Amt er so oft unter großen
persönlichen Entbehrungen und pekuniären Opfern versah. Im Verein mit
seiner vor 1 1/2 Jahren dahingegangenen Gattin, einer echten Esches
chajil (tüchtiger Frau), gestaltete er sein Heim zu einer von allen
orthodoxen Glaubensgenossen gern und oft aufgesuchten Stätte. Geradezu
unmöglich ist es, all das zu schildern, was beide zusammen für die öffentlichen
Bedürfnisse, insbesondere auf dem Gebiete der Wohltätigkeit
geleistet. Es sei nur erwähnt, dass der Verblichene 32 Jahre lang das
schwere Amt eines Verwalters der Armenkasse für Durchreisende
unentgeltlich versah. Die einzelnen Jahrgänge des 'Israelit' ließ er
unter den Mitgliedern der Gemeinde kursieren, um Sinn für Tora und
Gottesfurcht zu erwecken. In den höchsten Gesellschafts- und
Beamtenkreisen der mittelfränkischen Kreishauptstadt war der
Heimgegangene angesehen und geachtet. Vor acht Jahren zog das kinderlose
Ehepaar hierher, um den Lebensabend in der Nähe von Verwandten zu
verbringen, freudigst begrüßt in der numerisch reduzierten Gemeinde, die
dadurch eine Kräftigung und Neubelebung des Gemeindelebens erfuhr. So
manches Gute hat der Verstorbene hier bewirkt. Nun sind sie beide in
die Ewigkeit gegangen. leibliche Nachkommen hinterlassen sie nicht,
aber ihre guten Taten sind ihre Nachkommen.
Zur Lewajoh (Beisetzung) war der Kultusvorstand von Ansbach,
Herr Selling, herbeigeeilt. In tief empfundenen Worten sprach der
Herr Rabbiner von Ansbach, Herr Dr. P. Cohn namens dieser
Gemeinde, nach diesem Herr A. Mannheimer, Lehrer in Dettelbach
im Auftrage des engeren Verwandtenkreises, endlich für die Gemeinde Harburg
Herr Lehrer Krämer daselbst.
Möge der S'chus - das Verdienst dieses wahrhaft Frommen uns
beistehen und er ein Meliz joscher - ein rechter Fürsprecher uns
allen sein. Secher zadik liwrochoh - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen.
Wie nachträglich bekannt ward, vermachte der Heimgegangene bedeutende
Lage an Moschab Sekenim und Talmud Thora im heiligen Lande, an die
Präparandien Höchberg, Burgpreppach,
an das israelitische Lehrerseminar und
das israelitische Hospital in Würzburg, endlich an das Rabbinerseminar in
Berlin." |
Zum Tod des Lehrers H. Hofmann
(1894)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1894:
"Ansbach. Der Tod hat am 2. dieses Monats (2. März 1894) einen edlen
Menschen hinweggerafft. Der israelitische Lehrer, Herr H. Hofmann, ein
Mann, geschmückt mit seltenen Tugenden, ausgezeichnet durch einen
unerschütterlichen festen Charakter, bekannt durch unermüdliches,
redliches Streben und Schaffen in und außer dem Berufe, ist in der Fülle
seiner Kraft, im 54. Lebensjahre, von der Erde abberufen worden. Wer dem
Leichenbegängnisse anwohnte, und es waren wahrlich nicht wenige, der
konnte einen Schluss ziehen, welcher Liebe und Anerkennung sich der selig
Entschlafene in weiten kreisen zu erfreuen hatte. Am Grabe sprach vor
einer tief gerührten Versammlung Herr Rabbiner Dr. Neubürger aus Fürth,
Herr Kultusvorstand Selling aus Ansbach und der Schwiegersohn des
Verblichenen Herr Lehrer Maier aus Fürth. Möge dem Verblichenen reicher
Lohn werden für die verdienstvollen Werke, die er geschaffen, möge ihm
die Erde leicht sein!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1894:
"Ansbach. Der Tod hat am 2. dieses Monats (2. März 1894) einen edlen
Menschen hinweggerafft. Der israelitische Lehrer, Herr H. Hofmann, ein
Mann, geschmückt mit seltenen Tugenden, ausgezeichnet durch einen
unerschütterlichen festen Charakter, bekannt durch unermüdliches,
redliches Streben und Schaffen in und außer dem Berufe, ist in der Fülle
seiner Kraft, im 54. Lebensjahre, von der Erde abberufen worden. Wer dem
Leichenbegängnisse anwohnte, und es waren wahrlich nicht wenige, der
konnte einen Schluss ziehen, welcher Liebe und Anerkennung sich der selig
Entschlafene in weiten kreisen zu erfreuen hatte. Am Grabe sprach vor
einer tief gerührten Versammlung Herr Rabbiner Dr. Neubürger aus Fürth,
Herr Kultusvorstand Selling aus Ansbach und der Schwiegersohn des
Verblichenen Herr Lehrer Maier aus Fürth. Möge dem Verblichenen reicher
Lohn werden für die verdienstvollen Werke, die er geschaffen, möge ihm
die Erde leicht sein!"
Anmerkung: Nachfolger Hofmanns wurde am 1. März 1894 Simon
Dingfelder; er blieb bis 1904. |
Kantor Simon Krämer empfiehlt sich auch als Mohel (Beschneider, 1893)
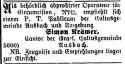 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1893: "Als
behördlich abprobierter Operateur für Circumcision, Mohel
(Beschneider), empfiehlt sich einem P. T. Publikum der Kultusgemeinde
Ansbach und Umgebung Simon Krämer, Kantor der israelitischen
Kultusgemeinde Ansbach. NB. Zeugnisse und Empfehlungen liegen zur
Einsicht." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1893: "Als
behördlich abprobierter Operateur für Circumcision, Mohel
(Beschneider), empfiehlt sich einem P. T. Publikum der Kultusgemeinde
Ansbach und Umgebung Simon Krämer, Kantor der israelitischen
Kultusgemeinde Ansbach. NB. Zeugnisse und Empfehlungen liegen zur
Einsicht."
Anm.: "P.T. Publikum" heißt "pleno titulo = mit vollem
Titel, gemeint eine Reihe aller möglichen Titel der Leute, die gemeint
sein könnten. |
70. Geburtstag von Kantor Simon Krämer (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1928:
"Heilbronn, 2. Juli (1928). Herr Kantor Simon Krämer aus Ansbach
feierte am 15. dieses Monats seinen 70. Geburtstag. Er hat als Kantor in
Aschaffenburg, in Teplitz und zuletzt in Ansbach viele Jahre amtiert und
überall in seinen Gemeinden ein reiches Maß von Verehrung und Liebe
gefunden. Seine kantoralen Leistungen, in denen sich moderne
Gesangstechnik, hervorragende Stimmmittel und feinsinniges Verständnis
für die überkommenen Sangesweisen verbanden, wurden nicht nur von Laien,
sondern auch von Sachkennern hoch eingeschätzt, sodass er lange Jahre die
kantoralen Fortbildungskurse leiten konnte. Zahlreiche im Stile des alten
Chasonus (Tradition des Vorsingens) sich bewegende Vertonungen von ihm,
werden noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Seine reichen
religionswissenschaftlichen Kenntnisse, besonders auch im Talmud, und
seine wertvollen menschlichen Eigenschaften erwarben ihm viel Freundschaft
und Anerkennung. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1928:
"Heilbronn, 2. Juli (1928). Herr Kantor Simon Krämer aus Ansbach
feierte am 15. dieses Monats seinen 70. Geburtstag. Er hat als Kantor in
Aschaffenburg, in Teplitz und zuletzt in Ansbach viele Jahre amtiert und
überall in seinen Gemeinden ein reiches Maß von Verehrung und Liebe
gefunden. Seine kantoralen Leistungen, in denen sich moderne
Gesangstechnik, hervorragende Stimmmittel und feinsinniges Verständnis
für die überkommenen Sangesweisen verbanden, wurden nicht nur von Laien,
sondern auch von Sachkennern hoch eingeschätzt, sodass er lange Jahre die
kantoralen Fortbildungskurse leiten konnte. Zahlreiche im Stile des alten
Chasonus (Tradition des Vorsingens) sich bewegende Vertonungen von ihm,
werden noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Seine reichen
religionswissenschaftlichen Kenntnisse, besonders auch im Talmud, und
seine wertvollen menschlichen Eigenschaften erwarben ihm viel Freundschaft
und Anerkennung.
Wir wünschen dem lieben Kollegen, dass es ihm vergönnt sein möchte,
noch viele Jahre in ungetrübter Gesundheit im Kreise seiner Familie und
seiner zahlreichen Freunde zu verbringen." |
Lehrer Simon Dingfelder verlässt Ansbach
(1904)
 Artikel
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 17. Juni 1904:
"Ansbach: Der seit 1. März 1894 an der hiesigen israelitischen Schule
wirkende Volksschullehrer Herr Simon Dingfelder ist seitens der
Kultusgemeinde München unter vielen Bewerbern als Religionslehrer an die
dortigen Volksschulen vom 1. September an berufen worden." Artikel
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 17. Juni 1904:
"Ansbach: Der seit 1. März 1894 an der hiesigen israelitischen Schule
wirkende Volksschullehrer Herr Simon Dingfelder ist seitens der
Kultusgemeinde München unter vielen Bewerbern als Religionslehrer an die
dortigen Volksschulen vom 1. September an berufen worden." |
Zu Lehrer Nathan Adler: 1904 - 1923 Lehrer in
Ansbach (Rückblick 1938)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1938:
"Hamburg, 20. März. In diesen Tagen begeht Herr Hauptlehrer Nathan
Adler aus Ansbach, Lehrer an der Adaß-Schule in Nürnberg, sein
vierzugjähriges Amtsjubiläum. Herr Adler verkörpert den
selbstbewussten, berufsstolzen, wissensreichen und gediegenen Lehrertyp in
Bayern. Es ist ein Burgpreppacher Kind und Schüler der dortigen
ehemaligen Präparandenschule. Von einer kleinen Anfangsstelle abgesehen,
wirkte er nur in größeren Orten wie in Fürth (Vorschule der
Israelitischen Realschule), als staatlicher Volksschullehrer in Ansbach
(1904-1924), nun seit 13 Jahren in Nürnberg. Wenn er auch seinem
Lehramt stets seine ganze ungeteilte Kraft widmete, und jeden einzelnen
seiner Schülerschar förderte, so fand er doch noch Zeit und Muße, der
jüdischen pädagogischen Welt Werke von gediegenem Wert zu schenken. Hier
sei nur an seine von Fachgenossen glänzend besprochenen hebräischen
Buchstabenbilder (30 Steinzeichnungen für das hebräische Alphabet), an
seine Jugendschriften: Aus den Tagen von Mordechai und Ester (nun
vergriffen), Josua, Jona, die Richter erinnert. Am bekanntesten ist wohl
sein Schiurbuch Niv Sefosajim (zwei Teile), in dem sich in glänzender
Sprache der Reichtum jüdischer Gedankenwelt offenbart, und das zu einem
unentbehrlichen Hilfsmittel für unsere Kollegen wurde. Adlers Tätigkeit
als Lehrer greift über die jüdische Schule hinaus. 10 Jahre lang war er Lehrer
an der gewerblichen Fortbildungsschule in Ansbach. Vielen Lehrern der
pädagogischen Beilage des Israelit sind seine gehaltvollen Aufsätze
über Midraschim, Psalmen, Gebete und biblische Geschichten eine
Möglichkeit fortbildender Tätigkeit. Sowohl als Schriftführer des
Ansbacher Bezirkslehrervereins, als auch als Schriftleiter auf der
ehemaligen amtlichen Fortbildungskonferenz und als Referent bei der Tagung
des Jüdischen Lehrervereins hat sich Adler einen guten Namen erworben.
Mögen ihm noch angenehme Jahre verdienstvollen Wirkens in seinem jetzigen
kreise beschieden sein. Zum Schlusse sei noch eine Erwartung
ausgesprochen, de wir von seiner ausgezeichneten Feder erhoffen. Möge
sich unser geschätzter Kollege aus seiner segensreichen Dienstzeit, in
der er für nichts anderes als für seine Schule zu haben ist, soviel
Kraft und Lust erübrigen, uns die sehnlichst erwartete 'Biblische
Geschichte im Lichte des Midrasch für Familie und Schule' zu
schenken."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1938:
"Hamburg, 20. März. In diesen Tagen begeht Herr Hauptlehrer Nathan
Adler aus Ansbach, Lehrer an der Adaß-Schule in Nürnberg, sein
vierzugjähriges Amtsjubiläum. Herr Adler verkörpert den
selbstbewussten, berufsstolzen, wissensreichen und gediegenen Lehrertyp in
Bayern. Es ist ein Burgpreppacher Kind und Schüler der dortigen
ehemaligen Präparandenschule. Von einer kleinen Anfangsstelle abgesehen,
wirkte er nur in größeren Orten wie in Fürth (Vorschule der
Israelitischen Realschule), als staatlicher Volksschullehrer in Ansbach
(1904-1924), nun seit 13 Jahren in Nürnberg. Wenn er auch seinem
Lehramt stets seine ganze ungeteilte Kraft widmete, und jeden einzelnen
seiner Schülerschar förderte, so fand er doch noch Zeit und Muße, der
jüdischen pädagogischen Welt Werke von gediegenem Wert zu schenken. Hier
sei nur an seine von Fachgenossen glänzend besprochenen hebräischen
Buchstabenbilder (30 Steinzeichnungen für das hebräische Alphabet), an
seine Jugendschriften: Aus den Tagen von Mordechai und Ester (nun
vergriffen), Josua, Jona, die Richter erinnert. Am bekanntesten ist wohl
sein Schiurbuch Niv Sefosajim (zwei Teile), in dem sich in glänzender
Sprache der Reichtum jüdischer Gedankenwelt offenbart, und das zu einem
unentbehrlichen Hilfsmittel für unsere Kollegen wurde. Adlers Tätigkeit
als Lehrer greift über die jüdische Schule hinaus. 10 Jahre lang war er Lehrer
an der gewerblichen Fortbildungsschule in Ansbach. Vielen Lehrern der
pädagogischen Beilage des Israelit sind seine gehaltvollen Aufsätze
über Midraschim, Psalmen, Gebete und biblische Geschichten eine
Möglichkeit fortbildender Tätigkeit. Sowohl als Schriftführer des
Ansbacher Bezirkslehrervereins, als auch als Schriftleiter auf der
ehemaligen amtlichen Fortbildungskonferenz und als Referent bei der Tagung
des Jüdischen Lehrervereins hat sich Adler einen guten Namen erworben.
Mögen ihm noch angenehme Jahre verdienstvollen Wirkens in seinem jetzigen
kreise beschieden sein. Zum Schlusse sei noch eine Erwartung
ausgesprochen, de wir von seiner ausgezeichneten Feder erhoffen. Möge
sich unser geschätzter Kollege aus seiner segensreichen Dienstzeit, in
der er für nichts anderes als für seine Schule zu haben ist, soviel
Kraft und Lust erübrigen, uns die sehnlichst erwartete 'Biblische
Geschichte im Lichte des Midrasch für Familie und Schule' zu
schenken." |
Ausschreibung der Stelle des Kantors und
Schochet (1923)
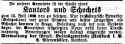 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1923: "In
unserer Gemeinde ist die Stelle eines Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Mai 1923: "In
unserer Gemeinde ist die Stelle eines
Kantors und Schochets
zum 14. Juli
1923 neu zu besetzen. Nur reichsdeutsche Bewerber (gesetzestreu) mit guter
Stimme und besten Zeugnissen als Schochet kommen in Frage. Besoldung nach
der vom Verband bayerischer israelitischer Gemeinden festgesetzten Norm
nebst freier Dienstwohnung. Bewerbungen wollen baldigst eingereicht
werden. Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde Ansbach in Bayern. Ludwig
Dietenhöfer, Vorstand." |
Jüdische Schulen
Seit 1844: das Handels-Lehr-Institut des Gabriel Kitzinger
Ausschreibung 1846
 Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1846: "Handels-Lehr-Institut
in Ansbach. Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1846: "Handels-Lehr-Institut
in Ansbach.
Der Unterricht in meiner Anstalt für das Wintersemester
1846/47 beginnt mit dem 20. Oktober laufenden Jahres und Aufnahmen finden
bis zu diesem Termine statt. Lehrgegenstände sind: Kalligraphie, deutsche
Sprache und Stilübungen, Geographie und Statistik, Arithmetik, kaufmännische
Formenlehre, Korrespondenz, einfache und doppelte Buchführung,
Wechselkunde, allgemeine und Handelsgeschichte, Zeichnen, französische,
englische und italienische Sprache.
Diese Fächer werden teils durch mich und teils durch andere hierzu
aufgestellt öffentliche Lehrer in drei Kursen gelehrt. Es wird alljährlich
eine öffentliche Prüfung meiner Schüler, unter Leitung der königlichen
Schulkommission und der konstituierten Handels-Prüfungs-Kommission
abgehalten, und bei den zwei bisher stattgehabten Prüfungen habe ich mich
auch von dieser Seite aus der besten Anerkennung meiner Leistungen zu
erfreuen gehabt, indem mir jedes Mal bezeugt wurde, dass meine Anstalt als
eine vorzügliche bezeichnet
werden müsse.
Für Aufnahmen von Pensionären ist in meinem Hause bestens Sorge
getroffen, und die resp. Eltern oder Vormünder wollen sich versichert
halten, dass die mir anvertrauten Jünglinge, bei der strengsten Aufsicht,
die liebevollste Behandlung zu gewärtigen haben.
Anmeldungen bitte ich möglichst bald an mich gelangen, damit die häusliche
Einrichtung für Pensionäre rechtzeitig getroffen werden kann. Alle
weiteren Aufschlüsse erteilt mein Prospekt, welcher, auf Verlangen,
Jedermann zu Diensten steht.
Ansbach, im September 1846.
Gabriel Kitzinger, Vorstand des obrigkeitlich autorisierten
Handels-Lehr-Instituts." |
Ausschreibungen 1847 / 1859
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. März 1847:
"Handels-Lehr-Institut in Ansbach. Der Unterricht in meinem Institute
für das Sommersemester beginnt mit dem 20. April laufenden Jahres und
Aufnahmen finden bis zu diesem Termine statt. Die Gegenstände des
Unterrichts sind: Kalligraphie, deutsche Sprache, Geographie, Geschichte,
Zeichnen, Arithmetik, kaufmännische Korrespondenz, einfache und doppelte
Buchführung, Wechselkunde, kaufmännische Formenlehre, Algebra, französische,
italienische und englische Sprache etc. etc. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. März 1847:
"Handels-Lehr-Institut in Ansbach. Der Unterricht in meinem Institute
für das Sommersemester beginnt mit dem 20. April laufenden Jahres und
Aufnahmen finden bis zu diesem Termine statt. Die Gegenstände des
Unterrichts sind: Kalligraphie, deutsche Sprache, Geographie, Geschichte,
Zeichnen, Arithmetik, kaufmännische Korrespondenz, einfache und doppelte
Buchführung, Wechselkunde, kaufmännische Formenlehre, Algebra, französische,
italienische und englische Sprache etc. etc.
Zur Aufnahme von Pensionären ist in meinem Hause die geeignete
zweckdienliche Einrichtung getroffen, und werden dieselben, bei einer
väterlichen Behandlung, in religiöser, wie in moralischer Hinsicht
überhaupt, sorgfältig überwacht.
Der überaus gute Erfolg, dessen sich meine Anstalt seit ihrem
dreijährigen Bestehen zu erfreuen hat, und die rühmlichen Zeugnisse, die
mir noch jedes Mal bei der jährlich stattfindenden öffentlichen Prüfung
meiner Zöglinge von der vorgesetzten königlichen Schulkommission und dem
Handelsstande hier zuteil wurden, lassen mich auch diesmal auf einen
bedeutenden Zuwachs an Schülern hoffen, und bitte ich daher, die
Anmeldungen möglichst bald an mich ergehen zu lassen, damit die
häusliche Einrichtung rechtzeitig getroffen werden könne.
Alle näheren Aufschlüsse gibt mein Prospekt, den ich auf Verlangen gerne
erteile.
Ansbach, im März 1847. Gabriel Kitzinger, Vorstand des obrigkeitlich
autorisierten Handels-Lehr-Instituts". |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Oktober 1847:
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Oktober 1847:
Ähnlicher Text wie in den bereits zitierten Ausschreibungen. |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 17. Oktober 1859: "Handels-Lehr-Institut zu
Ansbach. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 17. Oktober 1859: "Handels-Lehr-Institut zu
Ansbach.
Der Unterricht an meiner Anstalt für das kommende Wintersemester wird Mittwoch,
den 2. November eröffnet. Die Unterrichtsgegenstände bilden:
Kalligraphie, Geographie, deutsche Sprache, kaufmännische Rechenkunde,
Korrespondenz, einfache und doppelte Buchhaltung, Konto-Korrent, Wechselkunde,
französische, englische und italienische Sprache; Unterricht in der
Religion und im Hebräischen (Chumasch, Mischnajot) wird von dem
verehrlichen Herrn Distriktsrabbiner dahier, in einem für die Schüler
meiner Anstalt besonders bestehenden Lehrkursus erteilt.
Mit meiner Anstalt ist ein Pensionat verbunden, in welchem den Zöglingen
gewissenhafte Aufsicht und sorgsame Verpflegung zuteil wird.
Auf Verlangen werden Jünglinge auch als Lehrlinge in mein Geschäft
eingeschrieben und erhalten alsdann dieselben beim Austritt aus meinem
Institute auch die gesetzlich erforderlichen Lehr-Zeugnisse. Näheres
besagt mein Prospektus, den ich auf Verlangen bereitwilligst
einsende. Gabriel Kitzinger,
Instituts-Vorstand." |
Erweiterung des Institutes um eine Unterrichts- und Erziehungsanstalt (1865)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September
1865: "Unterrichts-, Erziehungs- und Handels-Lehr-Anstalt in Ansbach.
Mit dem Beginne des kommenden Winter-Semesters (am 23. Oktober laufenden
Jahres) werde ich mit meinem seit 21 Jahren bestehenden
'Handels-Lehr-Institute" auch eine 'Unterrichts- und
Erziehungs-Anstalt' für Knaben vom 9. bis zum 12. Jahre verbinden, in
welcher von geprüften, anerkannt tüchtigen Lehrern Unterricht in allen
Gegenständen einer guten Elementarschule, in den Naturwissenschaft, sowie
in der französischen Sprache erteilt wird. Lehrgegenstände der
Handels-Abteilung sind: sämtliche Comptoir -Wissenschaften, die
französische, englische und italienische Sprache. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September
1865: "Unterrichts-, Erziehungs- und Handels-Lehr-Anstalt in Ansbach.
Mit dem Beginne des kommenden Winter-Semesters (am 23. Oktober laufenden
Jahres) werde ich mit meinem seit 21 Jahren bestehenden
'Handels-Lehr-Institute" auch eine 'Unterrichts- und
Erziehungs-Anstalt' für Knaben vom 9. bis zum 12. Jahre verbinden, in
welcher von geprüften, anerkannt tüchtigen Lehrern Unterricht in allen
Gegenständen einer guten Elementarschule, in den Naturwissenschaft, sowie
in der französischen Sprache erteilt wird. Lehrgegenstände der
Handels-Abteilung sind: sämtliche Comptoir -Wissenschaften, die
französische, englische und italienische Sprache.
Zweck der Anstalt ist, die derselben anvertrauten Schüler zu
religiös-sittlichen Menschen zu erziehen und zu tüchtigen Kaufleuten
heranzubilden. Herr N. Hausmann, welcher seit mehreren Jahren an meiner
Anstalt und an anderen ähnlichen Instituten als Lehrer mit dem besten Erfolge
wirkte, wird von nun an seine ganze Lehrtätigkeit der Gesamt-Anstalt
widmen und vereint mit mir deren Leitung übernehmen.
Für das mir bisher so vielfach bewiesene Vertrauen bestens dankend, bitte
ich, dasselbe auch der nun erweiterten Anstalt angedeihen zu lassen. Mit
dem Institute bleibt, wie bisher, ein Pensionat verbunden, in welchem die
Knaben sorgfältig verpflegt und überwacht werden. -
Näheres in meinem Prospektus, welchen ich auf Verlangen gerne
verabreiche.
Ansbach, im August 1865. Gabriel Kitzinger." |
Anzeige
von Lehrer N. Hausmann (1872)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1872: "In
meinem Pensionate finden zu Beginn des Sommersemesters (Mitte April) noch
einige Knaben Aufnahme. Väterlich liebevolle Behandlung. Strenge
Beaufsichtigung. Nachhilfe. Das Absolutorium der Handelsschule
berechtigt zum einjährigen freiwilligen Militärdienste. Ansbach
(Bayern). Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1872: "In
meinem Pensionate finden zu Beginn des Sommersemesters (Mitte April) noch
einige Knaben Aufnahme. Väterlich liebevolle Behandlung. Strenge
Beaufsichtigung. Nachhilfe. Das Absolutorium der Handelsschule
berechtigt zum einjährigen freiwilligen Militärdienste. Ansbach
(Bayern).
N. Hausmann, Lehrer an der königlichen Gewerb- und
Handelsschule". |
Hinweis auf frühere Jeschiwa = Talmud-Hochschule in Ansbach
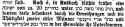 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1866: "Auch
in Ansbach blühte früher eine Jeschiwa (Talmudhochschule) von ca. 20
Bachurim (Knaben, Schülern) unter Rabbiner - unser Lehrer, der Herr,
unser Meister - Mosche Cohn und fanden diese besonders durch
die Bemühungen und die Tätigkeit zweier edler Männer - unser Lehrer,
der Herr, unser Meister Uri Wiener und - unser Lehrer, der
Herr unser Meister Nete (Nathanael) Oberdorfer in der Gemeinde
ihr Unterkommen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1866: "Auch
in Ansbach blühte früher eine Jeschiwa (Talmudhochschule) von ca. 20
Bachurim (Knaben, Schülern) unter Rabbiner - unser Lehrer, der Herr,
unser Meister - Mosche Cohn und fanden diese besonders durch
die Bemühungen und die Tätigkeit zweier edler Männer - unser Lehrer,
der Herr, unser Meister Uri Wiener und - unser Lehrer, der
Herr unser Meister Nete (Nathanael) Oberdorfer in der Gemeinde
ihr Unterkommen." |
Aus dem jüdischen
Gemeinde- und Vereinsleben
Unterstützung für die Armen der israelitischen Kultusgemeinde (1920)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. November 1920:
"Ansbach, 25. Oktober (1920). Als Zeichen des Dankes für die
opferbereite Mitarbeit der israelitischen Einwohnerschaft Ansbachs
überwies der Hauptausschuss des Ortssammelkomitees Ansbach-(Stadt) für
die Armen der israelitischen Kultusgemeinde 1.000 Mark. In einer Zeit, da
die Leistungen der deutschen Judenheit während des Krieges nicht genug
herabgewürdigt werden können, freuen wir uns, von maßgebender Stelle
eine ehrliche Stimme der Anerkennung verzeichnen zu dürfen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. November 1920:
"Ansbach, 25. Oktober (1920). Als Zeichen des Dankes für die
opferbereite Mitarbeit der israelitischen Einwohnerschaft Ansbachs
überwies der Hauptausschuss des Ortssammelkomitees Ansbach-(Stadt) für
die Armen der israelitischen Kultusgemeinde 1.000 Mark. In einer Zeit, da
die Leistungen der deutschen Judenheit während des Krieges nicht genug
herabgewürdigt werden können, freuen wir uns, von maßgebender Stelle
eine ehrliche Stimme der Anerkennung verzeichnen zu dürfen." |
Gemeindewahlen (1927)
 Artikel
in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar
1927: "Ansbach. In der heute vollzogenen Gemeindewahl wurde Herr
Ludwig Dietenhöfer, Fabrikbesitzer zum wiederholten Male als Vorstand der
Kultusgemeinde Ansbach einstimmig gewählt. Als Verwaltungsmitglieder
wurden die Herren Joseph Heilbrunn, Anton Michelsohn, Justizrat
Frankenburger, Joseph Rosenfeld, Leo Steiner und Jakob Weißmann
gewählt. Artikel
in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar
1927: "Ansbach. In der heute vollzogenen Gemeindewahl wurde Herr
Ludwig Dietenhöfer, Fabrikbesitzer zum wiederholten Male als Vorstand der
Kultusgemeinde Ansbach einstimmig gewählt. Als Verwaltungsmitglieder
wurden die Herren Joseph Heilbrunn, Anton Michelsohn, Justizrat
Frankenburger, Joseph Rosenfeld, Leo Steiner und Jakob Weißmann
gewählt.
Die Herren Liebermann, Max und Aal Jakob wurden als Ersatzleute bestimmt.
Möge die neue Verwaltung auch weiterhin zum Wohle und Gedeihen der
Gemeinde Ansbach wirken." |
Simchat-Tora-Feier des Vereins "Jüdische Jugend Ansbach" (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1931: "Ansbach,
12. Oktober (1931). Gestern Abend hielt der strebsame Verein 'Jüdische
Jugend Ansbach' im voll besetzten Saale des Deutschen Hofes seine Simchas
Thorafeier. Dieselbe wurde deshalb auf diesen Abend verlegt, weil viel
auswärtige Gäste zu erwarten waren, die sich auch zahlreich einstellten.
Nachdem der 1. Vorstand, Ezechiel Wallersteiner, mit herzlichen Worten die
Anwesenden begrüßt und ein Vorstandsmitglied einen Prolog gesprochen
hatte, wickelte sich das reichhaltige Programm in schönster, harmonischer
Weise ab. Komische Intermezzos wechselten mit musikalischen Darbietungen
seitens verschiedener Mitglieder, Kinderaufführungen und Gabenverlosung.
Außerdem wurden jedem Kinde eine Tüte verschiedenen essbaren Inhalts
verabreicht. Sämtliche Vorführungen ernteten allgemeinen, verdienten
Beifall und manche Lachsalve ertönte. Befriedigt gingen die Zuhörer in
früher Morgenstunde nach Hause, im Bewusststein einer schönen, echt
jüdischen Feier beigewohnt zu haben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1931: "Ansbach,
12. Oktober (1931). Gestern Abend hielt der strebsame Verein 'Jüdische
Jugend Ansbach' im voll besetzten Saale des Deutschen Hofes seine Simchas
Thorafeier. Dieselbe wurde deshalb auf diesen Abend verlegt, weil viel
auswärtige Gäste zu erwarten waren, die sich auch zahlreich einstellten.
Nachdem der 1. Vorstand, Ezechiel Wallersteiner, mit herzlichen Worten die
Anwesenden begrüßt und ein Vorstandsmitglied einen Prolog gesprochen
hatte, wickelte sich das reichhaltige Programm in schönster, harmonischer
Weise ab. Komische Intermezzos wechselten mit musikalischen Darbietungen
seitens verschiedener Mitglieder, Kinderaufführungen und Gabenverlosung.
Außerdem wurden jedem Kinde eine Tüte verschiedenen essbaren Inhalts
verabreicht. Sämtliche Vorführungen ernteten allgemeinen, verdienten
Beifall und manche Lachsalve ertönte. Befriedigt gingen die Zuhörer in
früher Morgenstunde nach Hause, im Bewusststein einer schönen, echt
jüdischen Feier beigewohnt zu haben.
Der jüdischen Jugend in Ansbach wünschen wir ein fortschreitendes
Gedeihen, auch wie bisher in der Liebe zum Judentum und seiner
Tora." |
Vortragsabend des Vereins "Jüdische Jugend Ansbach" (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1931: "Ansbach,
7. Dezember (1931). Am 15. November veranstaltete der Verein 'Jüdische
Jugend Ansbach' zusammen mit dem Literaturverein Ansbach im Rahmen seines
diesjährigen Winterprogramms im überfällten Gemeindesaale einen
Vortragsabend. Das Referat hatte Herr Justizreferendar Martin
Frankenburger übernommen, und zwar über das Thema: 'Die Juden in der
Darstellung Jakob Wassermanns'. Seine leicht fasslichen, geistvollen
Ausführungen wurden von den Zuhörern mit regem Interesse verfolgt und
ernteten allgemeinen Beifall. - Ein erfreuliches Zeichen für die
Zusammenarbeit der Jugend war es, dass zu diesem Vortragsabend der
Jüdische Jugendverein Gunzenhausen in stattlicher Zahl; mit seinem
rührigen Vorstand, Herrn Hellmann an der Spitze, eigens erschienen war.
Im Anschluss an den Vortrag versammelten sich die beiden Jugendvereine
noch zu einem gemütlichen Beisammensein in ihrem Ansbacher Vereinslokal,
das bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Hoffen wir, dass die nun
einmal angebahnte Verbindung der beiden Vereine zu weiterer
ersprießlicher Zusammenarbeit im Geiste unseres Judentums führen
wird." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1931: "Ansbach,
7. Dezember (1931). Am 15. November veranstaltete der Verein 'Jüdische
Jugend Ansbach' zusammen mit dem Literaturverein Ansbach im Rahmen seines
diesjährigen Winterprogramms im überfällten Gemeindesaale einen
Vortragsabend. Das Referat hatte Herr Justizreferendar Martin
Frankenburger übernommen, und zwar über das Thema: 'Die Juden in der
Darstellung Jakob Wassermanns'. Seine leicht fasslichen, geistvollen
Ausführungen wurden von den Zuhörern mit regem Interesse verfolgt und
ernteten allgemeinen Beifall. - Ein erfreuliches Zeichen für die
Zusammenarbeit der Jugend war es, dass zu diesem Vortragsabend der
Jüdische Jugendverein Gunzenhausen in stattlicher Zahl; mit seinem
rührigen Vorstand, Herrn Hellmann an der Spitze, eigens erschienen war.
Im Anschluss an den Vortrag versammelten sich die beiden Jugendvereine
noch zu einem gemütlichen Beisammensein in ihrem Ansbacher Vereinslokal,
das bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Hoffen wir, dass die nun
einmal angebahnte Verbindung der beiden Vereine zu weiterer
ersprießlicher Zusammenarbeit im Geiste unseres Judentums führen
wird." |
Vortrag über eine
Reise ins Heilige Land (1935)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni
1935: "Ansbach. Bei der letzten Veranstaltung des Vereins für
jüdische Geschichte und Literatur, am 2. Juni, schilderte Herr
Kommerzienrat Dietenhöfer in einem fast dreistündigen Vortrag seine
Reise-Erlebnisse aus dem Heiligen Land. Durch mehr als 200 Lichtbilder veranschaulichte
der Redner seine Fahrt durch Italien und das Mittelmeer, vor allem die
biblischen Stätten und die rasch aufblühenden Siedlungen Palästinas.
Reicher Beifall lohnte dem allgemein verehrten Redner seine große
Mühe." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni
1935: "Ansbach. Bei der letzten Veranstaltung des Vereins für
jüdische Geschichte und Literatur, am 2. Juni, schilderte Herr
Kommerzienrat Dietenhöfer in einem fast dreistündigen Vortrag seine
Reise-Erlebnisse aus dem Heiligen Land. Durch mehr als 200 Lichtbilder veranschaulichte
der Redner seine Fahrt durch Italien und das Mittelmeer, vor allem die
biblischen Stätten und die rasch aufblühenden Siedlungen Palästinas.
Reicher Beifall lohnte dem allgemein verehrten Redner seine große
Mühe." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Advokat
Dr. Samuel Berlin ist beim Schwurgericht in Ansbach tätig (1850)
 Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. September
1850: "Bei dem Schwurgerichte in Ansbach fungiert öfters der Advokat
Herr Dr. Berlin daselbst und jedes Mal sind die Zeitungen des Lobes
voll ob der Gediegenheit und Gemütlichkeit seines Plädoyers." Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. September
1850: "Bei dem Schwurgerichte in Ansbach fungiert öfters der Advokat
Herr Dr. Berlin daselbst und jedes Mal sind die Zeitungen des Lobes
voll ob der Gediegenheit und Gemütlichkeit seines Plädoyers." |
Zum Tod des königlichen Hofrates Dr. Samuel Berlin (1897 in Fürth, war bis
1876 Rechtsanwalt in Ansbach)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar
1897: "München, 26. Dezember (1896). In der alten
Gemeinde Fürth hat heute einer ihrer besten Söhne sein Leben
beschlossen, der königliche Hofrat Dr. Samuel Berlin, ein Mann,
ausgezeichnet durch seine Abkunft, hervorragend durch seine persönliche
Tätigkeit. Er entstammte der Familie des bekannten Löb Berlin,
einstmaligen hochfürstlich bambergischen und ritterschaftlichen
Oberlandesrabbiners zu Bamberg und
späteren Landrabbiners in Kassel. Bis
zum Jahr 1848 war er als geprüfter Rechtspraktikant und Doktor der
Rechte, da der König Ludwig I. keinen Juden als Advokaten anstellen
wollte und damals andere Zweige des Staatsdienstes selbstverständlich
einem Juden verschlossen waren, Kassier des israelitischen
Religionsvereins in Fürth, welchen Namen, wenn ich mich nicht täusche,
damals die Kultusgemeinde Fürth amtlich führte; neben ihm war der Sohn
des Amtsnachfolgers seines Ahnen Löb Berlin, der Dr. Carl Feust,
rechtskundiger Sekretär der Gemeinde. 1848 war Samuel Berlin der Erste,
der als Jude zum Advokaten in Bayern ernannt wurde; sein erster Amtssitz
war Gerolzhofen, wo er mit einem
jungen Rechtspraktikanten, einem Schullehrersohne, Freundschaft schloss,
dessen glänzende Zukunft er voraussagte: es war niemand anderes als der
spätere bayerische Ministerpräsident Dr. von Lutz. Später wurde
er nach Ansbach versetzt, wo ihn das
Vertrauen seiner Mitbürger zum Vorstande des Kollegiums der Gemeindebevollmächtigen
wählte, in welcher Eigenschaft er durch Verleihung des Ritterkreuzes des
Verdienstordens vom heiligen Michael I. Klasse ausgezeichnet wurde,
während seine Standesgenossen ihn zum Vorstandsmitgliede des damaligen
bayerischen Anwaltsvereins wählten. Welche Stellung er als Anwalt
einnahm, beweist, dass er der Sachwalter der Familie des jetzigen
bayerischen Justizministers war. 1876 gab er die Rechtsanwaltschaft auf,
um sich in Fürth, seiner Heimat, von einer gesegneten und
erfolgreichen Berufstätigkeit auszuruhen; die Ernennung zum königlichen
Hofrate begleitete ihn in den Ruhestand, während dessen er einer der
fleißigsten wissenschaftlichen Hilfsarbeiter seines bekannten Schwiegersohnes,
des Justizrates Josephthal in Nürnberg, war und sich mit Eifer
noch in hohen Jahren den Pflichten des Amtes eines Kollaturmitgliedes der
Gabriel Riesser'schen Stipendienstiftung in Fürth widmete; es war für
denjenigen, der das Glück hatte, es mit anzusehen, ein erhebender Anblick,
den in hohen Achtzigern stehenden Mann mit Scharfsinn und der Gewandtheit
eines Jugendlichen seine Referate vortragen zu hören. Im 90. Lebensjahre
abberufen und mit einem reich gesegneten Leben gesättigt, nachdem er
schon vor Jahren seine goldene Hochzeit zu feiern das Glück gehabt hatte,
ist er meines Wissens der dritte Jude gewesen, der in Bayern Advokat
geworden war. Die Nachkommen des Löb Berlin sind es übrigens, welche
auch den ersten bayerischen Berufsrichter israelitischer Religion
stellten, den Oberlandesgerichtsrat Max Berlin in Nürnberg.
Vielleicht interessiert es heute, wo der neben dem Reichsgerichtspräsidenten
Simson vielleicht älteste lebende deutsche Jurist jüdischer Abkunft
ins Grab gesunken ist, den Lebenden zu wiederholen, wie in Bayern unter
Max Joseph I. der erste Jude Mayersohn (Aschaffenburg?)
die Anstellung als Advokat erlangte, unter Ludwig I. während der 23 Jahre
seiner Regierung nur der einzige Dr. Samuel Grünsfeld in Fürth,
während 1848 Dr. Samuel Berlin in Gerolzhofen
und Dr. Carl Feust in Fürth zu Advokaten ernannt wurden, der
Letztere, welcher die Staatsprüfung schon im Jahre 1826 mit I bestanden
hatte und als Mitübersetzer des Corpus juris und Schriftsteller weit
bekannt war, nachdem er sich vorher mit 49 Jahren noch vergeblich um die
Stelle eines Stadtgerichtsprotokollisten beworben hatte. Würdige Söhne
ihrer Ahnen, haben sie trotz aller Verlockungen, die auch von
wohlmeinenden Jugendfreunden in hoher Stellung ausgingen, es verschmäht,
den Glauben der Väter einer Anstellung wegen zu verraten. - An dem am 23.
Dezember dahier stattgefundenen Leichenbegängnisse beteiligten
sich die höchsten Beamten der Stadt und der Nachbarstadt Nürnberg, wie Herr
Oberlandesgerichtspräsident von Schmauß, Senatspräsident Enderlein,
Regierungsrat Goreis, Oberlandesgerichtsrat und Vorstand des Amtsgerichtes
Nürnberg von Merz, und viele andere. Die Beteiligung war eine rege. Herr
Dr. Neubürger rühmte in trefflicher Ansprache an dem Verstorbenen
alle Tugenden, die einen edlen Mann zieren: seine Seelengröße, seine
Duldsamkeit, seine Humanität, sein rastloses Schaffen etc. Herr
Justizrat Gunzenhäuser widmete dem Verewigten namens der hiesigen
Kultusgemeinde einen ehrenden Nachruf: Herr Dr. Deutsch sprach im
Namen des israelitischen Waisenhauses, Herr Kantor Rosenhaupt aus
Nürnberg, ein Großneffe Dr. Berlins, für die Verwandten. Möge der
teure Verstorbene in Frieden ruhen!"
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar
1897: "München, 26. Dezember (1896). In der alten
Gemeinde Fürth hat heute einer ihrer besten Söhne sein Leben
beschlossen, der königliche Hofrat Dr. Samuel Berlin, ein Mann,
ausgezeichnet durch seine Abkunft, hervorragend durch seine persönliche
Tätigkeit. Er entstammte der Familie des bekannten Löb Berlin,
einstmaligen hochfürstlich bambergischen und ritterschaftlichen
Oberlandesrabbiners zu Bamberg und
späteren Landrabbiners in Kassel. Bis
zum Jahr 1848 war er als geprüfter Rechtspraktikant und Doktor der
Rechte, da der König Ludwig I. keinen Juden als Advokaten anstellen
wollte und damals andere Zweige des Staatsdienstes selbstverständlich
einem Juden verschlossen waren, Kassier des israelitischen
Religionsvereins in Fürth, welchen Namen, wenn ich mich nicht täusche,
damals die Kultusgemeinde Fürth amtlich führte; neben ihm war der Sohn
des Amtsnachfolgers seines Ahnen Löb Berlin, der Dr. Carl Feust,
rechtskundiger Sekretär der Gemeinde. 1848 war Samuel Berlin der Erste,
der als Jude zum Advokaten in Bayern ernannt wurde; sein erster Amtssitz
war Gerolzhofen, wo er mit einem
jungen Rechtspraktikanten, einem Schullehrersohne, Freundschaft schloss,
dessen glänzende Zukunft er voraussagte: es war niemand anderes als der
spätere bayerische Ministerpräsident Dr. von Lutz. Später wurde
er nach Ansbach versetzt, wo ihn das
Vertrauen seiner Mitbürger zum Vorstande des Kollegiums der Gemeindebevollmächtigen
wählte, in welcher Eigenschaft er durch Verleihung des Ritterkreuzes des
Verdienstordens vom heiligen Michael I. Klasse ausgezeichnet wurde,
während seine Standesgenossen ihn zum Vorstandsmitgliede des damaligen
bayerischen Anwaltsvereins wählten. Welche Stellung er als Anwalt
einnahm, beweist, dass er der Sachwalter der Familie des jetzigen
bayerischen Justizministers war. 1876 gab er die Rechtsanwaltschaft auf,
um sich in Fürth, seiner Heimat, von einer gesegneten und
erfolgreichen Berufstätigkeit auszuruhen; die Ernennung zum königlichen
Hofrate begleitete ihn in den Ruhestand, während dessen er einer der
fleißigsten wissenschaftlichen Hilfsarbeiter seines bekannten Schwiegersohnes,
des Justizrates Josephthal in Nürnberg, war und sich mit Eifer
noch in hohen Jahren den Pflichten des Amtes eines Kollaturmitgliedes der
Gabriel Riesser'schen Stipendienstiftung in Fürth widmete; es war für
denjenigen, der das Glück hatte, es mit anzusehen, ein erhebender Anblick,
den in hohen Achtzigern stehenden Mann mit Scharfsinn und der Gewandtheit
eines Jugendlichen seine Referate vortragen zu hören. Im 90. Lebensjahre
abberufen und mit einem reich gesegneten Leben gesättigt, nachdem er
schon vor Jahren seine goldene Hochzeit zu feiern das Glück gehabt hatte,
ist er meines Wissens der dritte Jude gewesen, der in Bayern Advokat
geworden war. Die Nachkommen des Löb Berlin sind es übrigens, welche
auch den ersten bayerischen Berufsrichter israelitischer Religion
stellten, den Oberlandesgerichtsrat Max Berlin in Nürnberg.
Vielleicht interessiert es heute, wo der neben dem Reichsgerichtspräsidenten
Simson vielleicht älteste lebende deutsche Jurist jüdischer Abkunft
ins Grab gesunken ist, den Lebenden zu wiederholen, wie in Bayern unter
Max Joseph I. der erste Jude Mayersohn (Aschaffenburg?)
die Anstellung als Advokat erlangte, unter Ludwig I. während der 23 Jahre
seiner Regierung nur der einzige Dr. Samuel Grünsfeld in Fürth,
während 1848 Dr. Samuel Berlin in Gerolzhofen
und Dr. Carl Feust in Fürth zu Advokaten ernannt wurden, der
Letztere, welcher die Staatsprüfung schon im Jahre 1826 mit I bestanden
hatte und als Mitübersetzer des Corpus juris und Schriftsteller weit
bekannt war, nachdem er sich vorher mit 49 Jahren noch vergeblich um die
Stelle eines Stadtgerichtsprotokollisten beworben hatte. Würdige Söhne
ihrer Ahnen, haben sie trotz aller Verlockungen, die auch von
wohlmeinenden Jugendfreunden in hoher Stellung ausgingen, es verschmäht,
den Glauben der Väter einer Anstellung wegen zu verraten. - An dem am 23.
Dezember dahier stattgefundenen Leichenbegängnisse beteiligten
sich die höchsten Beamten der Stadt und der Nachbarstadt Nürnberg, wie Herr
Oberlandesgerichtspräsident von Schmauß, Senatspräsident Enderlein,
Regierungsrat Goreis, Oberlandesgerichtsrat und Vorstand des Amtsgerichtes
Nürnberg von Merz, und viele andere. Die Beteiligung war eine rege. Herr
Dr. Neubürger rühmte in trefflicher Ansprache an dem Verstorbenen
alle Tugenden, die einen edlen Mann zieren: seine Seelengröße, seine
Duldsamkeit, seine Humanität, sein rastloses Schaffen etc. Herr
Justizrat Gunzenhäuser widmete dem Verewigten namens der hiesigen
Kultusgemeinde einen ehrenden Nachruf: Herr Dr. Deutsch sprach im
Namen des israelitischen Waisenhauses, Herr Kantor Rosenhaupt aus
Nürnberg, ein Großneffe Dr. Berlins, für die Verwandten. Möge der
teure Verstorbene in Frieden ruhen!" |
Dr. Obermaier aus Ansbach wird königlicher Advokat (Rechtsanwalt) 1852
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1852:
"Die Anzahl der königlichen Advokaten jüdischen Glaubens, bei uns,
ist in der Person des Herrn Dr. Obermaier aus Ansbach, bisher
Stadtakzessist in Fürth und Kassier bei dem dortigen "Israelitischen
Religionsverein" um ein würdiges Glied vermehrt worden." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1852:
"Die Anzahl der königlichen Advokaten jüdischen Glaubens, bei uns,
ist in der Person des Herrn Dr. Obermaier aus Ansbach, bisher
Stadtakzessist in Fürth und Kassier bei dem dortigen "Israelitischen
Religionsverein" um ein würdiges Glied vermehrt worden." |
Artikel über Dr. Marcus Elieser Bloch aus Ansbach - ein Erforscher der Fischwelt vor 100
Jahren - von Richard Lesser
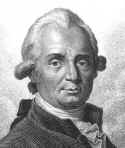 |
 |
 |
 |
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung
des Judentums" vom 27. Juli 1880: "Dr. Marcus Elieser Bloch, ein
Erforscher der Fischwelt vor 100 Jahren. Von Richard Lesser.
Heute, wo alle Blicke auf die in Berlin eröffnete Internationale
Fischerei-Ausstellung gerichtet sind, wo eine ungeahnte Welt die Beschauer
entzückt, sollte man sich des Mannes erinnern, der als ein Patriarch der
Ichthyologen sich die größten Verdienste um die Kenntnis der Fische
erworben hat und schon vor hundert Jahren in seinen Werken für Pflege der
Fisch-Kultur auftrat.
Es ist Marcus Elieser Bloch, 1723 von armen jüdischen Eltern zu Ansbach
geboren, wuchs er fast ohne allen Unterricht heran, der damaligen Sitte
gemäß lernte er nur frühzeitig Hebräisch. Diesem einzigen Wissen
verdankte er als Jüngling eine Hauslehrerstelle bei einem jüdischen
Wundarzt in Hamburg, um dessen Kindern den religiösen Unterricht zu
erteilen. Hier lernte er erst, schon in der Mitte der zwanziger Jahre,
Deutsch lesen und schreiben. Weiter führte ihn der angefachte
Wissensdrang zum Studium des Lateinischen, und mit Vorliebe begann er sich
mit Anatomie zu beschäftigen. Je unwiderstehlicher er nun den Drang in
sich empfand, sich Bildung anzueignen, desto schmerzlicher war ihm die
Erkenntnis, wie wenig er davon besaß. Durch Unterstützung von Verwandten
in Berlin ward ihm sein heißester Wunsch ermöglicht, sich dem Studium
der medizinischen Wissenschaften dort gründlich zu widmen, während er
mit unermüdlichem Eifer zunächst die Lücken seiner Bildung auszufüllen
suchte. In Frankfurt a.O. promovierte er zum Doktor der Medizin und ließ
sich alsdann als praktischer Arzt in Berlin nieder. Die Ausübung des
ärztlichen Berufes hielt ihn aber in seinem Forschersinn nicht ab.
Nachdem er 1774 einen Band medizinischer Beobachtungen herausgegeben,
wendete er sich immer mehr und mehr den Naturwissenschaften zu, die damals
bekanntlich das Aschenbrödel unter allen Wissenschaften waren. So
beteiligte er sich auch an der Lösung der Frage über die Herkunft der
Eingeweidewürmer, als die Dänische Gesellschaft der Wissenschaften 1780
einen Preis hierfür aussetzte, und wurde seine Arbeit, die 1782 in Berlin
im Druck erschien desselben würdig befunden. Sein größtes Verdienst
erwarb er sich aber durch die eingehende und umfassende Erforschung der
Naturgeschichte der Fische, welche vor ihm von keinem Naturforscher so
tief ergründet war.....
Weiterer Text nicht abgeschrieben, da es über das zur jüdischen
Geschichte Ansbachs Sinnvolle hinausgeht....
Link: Wikipedia-Artikel
zu Markus Elieser Bloch |
Zum Tod von Bernhard Mahler (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908:
"Ansbach, 20. Dezember (1908). Am 13. Dezember starb Herr Privatier
Bernhard Mahler dahier im nahezu vollendeten 80. Lebensjahre. Es war aus
Lehrberg gebürtig, einer ehemals respektablen jüdischen Gemeinde, die
längst zu bestehen aufgehört hat und nun das Schicksal vieler anderen
teilt. Im Hause des Dahingeschiedenen hatten Einfachheit, Bescheidenheit
und Zufriedenheit, gepaart mit reinster Gottesfurcht, dauernde Stätte.
Beliebt und geehrt von allen, ohne Unterschied des Ranges und Standes,
repräsentierte Herr Mahler so echt und recht den wackeren Vertreter des
alten Kehillolebens (Gemeindelebens), war Vorstand der Chewro Kadischo,
viele Jahre Mitglieder der Kultusverwaltung, ein eifriger, unermüdlicher
Besucher der Synagoge, geschmückt mit dem Diadem eines unbefleckten guten
namens. Durch den Tod seiner Gattin, das früheitige Sterben einer
Tochter, sowie zweier Schwiegersöhne in der Blüte der Jahre hat er
vieles Leid erduldet und in Ergebung wie ein Held ertragen. Kein Wunder
daher, dass sein Tod eine gewaltige Lücke bei Familie und Gemeinde
verursacht. Herr Rabbiner Dr. Kohn schilderte die edlen Tugenden dieses
Mannes und zeichnete das herrliche Charakterbild des Verstorbenen. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908:
"Ansbach, 20. Dezember (1908). Am 13. Dezember starb Herr Privatier
Bernhard Mahler dahier im nahezu vollendeten 80. Lebensjahre. Es war aus
Lehrberg gebürtig, einer ehemals respektablen jüdischen Gemeinde, die
längst zu bestehen aufgehört hat und nun das Schicksal vieler anderen
teilt. Im Hause des Dahingeschiedenen hatten Einfachheit, Bescheidenheit
und Zufriedenheit, gepaart mit reinster Gottesfurcht, dauernde Stätte.
Beliebt und geehrt von allen, ohne Unterschied des Ranges und Standes,
repräsentierte Herr Mahler so echt und recht den wackeren Vertreter des
alten Kehillolebens (Gemeindelebens), war Vorstand der Chewro Kadischo,
viele Jahre Mitglieder der Kultusverwaltung, ein eifriger, unermüdlicher
Besucher der Synagoge, geschmückt mit dem Diadem eines unbefleckten guten
namens. Durch den Tod seiner Gattin, das früheitige Sterben einer
Tochter, sowie zweier Schwiegersöhne in der Blüte der Jahre hat er
vieles Leid erduldet und in Ergebung wie ein Held ertragen. Kein Wunder
daher, dass sein Tod eine gewaltige Lücke bei Familie und Gemeinde
verursacht. Herr Rabbiner Dr. Kohn schilderte die edlen Tugenden dieses
Mannes und zeichnete das herrliche Charakterbild des Verstorbenen. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod
des aus Ansbach stammenden
Rabbiners Henry Hochheimer (1912)
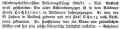 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Februar 1912: "Aus Ansbach wird geschrieben: Ein
alter Achtundvierziger ist in dem Rabbiner Henry Hochheimer in
Baltimore dahingegangen. Er war vor 92 Jahren in Ansbach geboren und mit
Karl Schurz nach Baltimore gekommen. Der Hochheimer war ein Mann von
gründlichem Wissen und hat eine reiche literarische Tätigkeit
entfaltet." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Februar 1912: "Aus Ansbach wird geschrieben: Ein
alter Achtundvierziger ist in dem Rabbiner Henry Hochheimer in
Baltimore dahingegangen. Er war vor 92 Jahren in Ansbach geboren und mit
Karl Schurz nach Baltimore gekommen. Der Hochheimer war ein Mann von
gründlichem Wissen und hat eine reiche literarische Tätigkeit
entfaltet." |
Zum Tod von Eduard Kupfer (1918)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Mai 1918:
"Ansbach, 16. Mai (1918). Unsere Gemeinde hat durch den Tod
des Herrn Eduard Kupfer einen schmerzlichen Verlust erlitten. Ein Mann von
echtem Schrot und Korn musste er auch in der Verwaltung der hiesigen
israelitischen Gemeinde seinen Platz finden, der er jahrelang zur Zierde
gereichte. Der Gedanke an treue Liebeserweisung bewog ihn zur Übernahme
der Vorstandschaft unserer Chewra Kadischa (Wohltätigkeitsverein).
Treu verwaltet er den Vorsitz der Gruppe des Hilfsvereins der Deutschen
Juden hier. Seiner Tugenden gedenkend, zollte ihm auch ein sehr großes
Trauergefolge aller Konfessionen, voran der Herr Oberbürgermeister, der Chevauxlegerverein
(sc. Militärverein/Kavallerie) mit der Fahne, neben den Mitgliedern der
israelitischen Gemeinde die Ehre des letzten Geleits. In trefflichen
Worten charakterisierte Herr Rabbiner Dr. Brader den
Verklärten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Mai 1918:
"Ansbach, 16. Mai (1918). Unsere Gemeinde hat durch den Tod
des Herrn Eduard Kupfer einen schmerzlichen Verlust erlitten. Ein Mann von
echtem Schrot und Korn musste er auch in der Verwaltung der hiesigen
israelitischen Gemeinde seinen Platz finden, der er jahrelang zur Zierde
gereichte. Der Gedanke an treue Liebeserweisung bewog ihn zur Übernahme
der Vorstandschaft unserer Chewra Kadischa (Wohltätigkeitsverein).
Treu verwaltet er den Vorsitz der Gruppe des Hilfsvereins der Deutschen
Juden hier. Seiner Tugenden gedenkend, zollte ihm auch ein sehr großes
Trauergefolge aller Konfessionen, voran der Herr Oberbürgermeister, der Chevauxlegerverein
(sc. Militärverein/Kavallerie) mit der Fahne, neben den Mitgliedern der
israelitischen Gemeinde die Ehre des letzten Geleits. In trefflichen
Worten charakterisierte Herr Rabbiner Dr. Brader den
Verklärten." |
Zum
Tod des Kempener Rabbiners Dr. Lazar Münz in Ansbach (1921)
(Dr. Münz lebte im Ruhestand in Ansbach; seine Tochter war verheiratet mit
Rabbiner Dr. Arnold Klein, Adas Israel in
Nürnberg)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Januar 1921:
"Rabbiner Dr. Lazar Münz – das Gedenken an den Gerechten
ist zum Segen – Ansbach, 7. Januar (1921). In Ansbach starb im
Alter von 74 Jahren der allbekannte frühere Kempener Rabbiner Dr. Lazar
Münz. Ein Leben reichen und segensvollen Wirkens für die Ideale von Tora
und Wahrheit wurden
beschlossen. Eine eingehende Würdigung folgt in nächster Nummer". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Januar 1921:
"Rabbiner Dr. Lazar Münz – das Gedenken an den Gerechten
ist zum Segen – Ansbach, 7. Januar (1921). In Ansbach starb im
Alter von 74 Jahren der allbekannte frühere Kempener Rabbiner Dr. Lazar
Münz. Ein Leben reichen und segensvollen Wirkens für die Ideale von Tora
und Wahrheit wurden
beschlossen. Eine eingehende Würdigung folgt in nächster Nummer". |
| |
 Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Januar 1921:
"In Ansbach starb im Alter von 84 Jahren der allbekannte frühere
Kempener Rabbiner Dr. Lazar Münz. Ein Leben reichen und segensvollen
Wirkens für die Ideale des Judentums wurde
beschlossen." Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Januar 1921:
"In Ansbach starb im Alter von 84 Jahren der allbekannte frühere
Kempener Rabbiner Dr. Lazar Münz. Ein Leben reichen und segensvollen
Wirkens für die Ideale des Judentums wurde
beschlossen." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1921:
"Rabbiner Dr. Lazar Münz - Das Gedenken an den Gerechten ist zum
Segen. Ansbach, 7. Januar 1921. Ein Meister und Lehrer in Israel, ein
Fürst der jüdischen Wissenschaft, ist aus unserer Mitte geschieden. Am
Montag, 24. Tewet, dem 3. Januar 1921, hat Herr Rabbiner Dr. Lazar
Münz im 84. Lebensjahre unerwartet seine reine Seele ausgehaucht. Als
Nachkomme hervorragender jüdischer Gelehrter, Schemen Rokeach (sc.
Rabbi Eleasar genannt Schemen Rokeach, über den Dr. Lasar Münz ein Buch
verfasste, erschienen Trier 1895) und Keter Kehuna, hat er den
hohen Geist dieser berühmten Männer in sich aufgenommen und durch sein
Leben in Wort und Schrift, zum vollendeten Ausdruck gebracht. Schon mit 17
Jahren besaß er ein so umfassendes, tiefgründiges talmudisches Wissen,
dass er von einigen der hervorragendsten Autoritäten jener Zeit, den
Oberrabbinern in Krakau und Leipnik die Hattarat Horaa (Lehrbefugnis)
erhielt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1921:
"Rabbiner Dr. Lazar Münz - Das Gedenken an den Gerechten ist zum
Segen. Ansbach, 7. Januar 1921. Ein Meister und Lehrer in Israel, ein
Fürst der jüdischen Wissenschaft, ist aus unserer Mitte geschieden. Am
Montag, 24. Tewet, dem 3. Januar 1921, hat Herr Rabbiner Dr. Lazar
Münz im 84. Lebensjahre unerwartet seine reine Seele ausgehaucht. Als
Nachkomme hervorragender jüdischer Gelehrter, Schemen Rokeach (sc.
Rabbi Eleasar genannt Schemen Rokeach, über den Dr. Lasar Münz ein Buch
verfasste, erschienen Trier 1895) und Keter Kehuna, hat er den
hohen Geist dieser berühmten Männer in sich aufgenommen und durch sein
Leben in Wort und Schrift, zum vollendeten Ausdruck gebracht. Schon mit 17
Jahren besaß er ein so umfassendes, tiefgründiges talmudisches Wissen,
dass er von einigen der hervorragendsten Autoritäten jener Zeit, den
Oberrabbinern in Krakau und Leipnik die Hattarat Horaa (Lehrbefugnis)
erhielt.
Nach elfjähriger Tätigkeit als Kreisrabbiner in Oswiecim wurde er von
der bedeutenden Gemeinde in Kempen in Posen, die damals 3.000 Juden
zählte und wo Malbim gewirkt hatte, als Rabbiner berufen. In 32jähriger
Tätigkeit hat er es mit Hingabe seiner ganzen Kraft verstanden, das
fromme alte Leben der Gemeinde ungestört zu erhalten. Während in allen
Gemeinden der Umgegend die Entweihung des Sabbats immer mehr um sich
griff, blieben in Kempen die zahlreichen jüdischen Geschäfte ohne
Ausnahme am Schabbat geschlossen. Nach seiner Pensionierung lebte
er einige Jahre im Kreise seiner Kinder in Nürnberg und wählte nachher
das ruhige, nahe gelegene Ansbach zu seinem Nuhmsitz
(Ruhesitz), wo er ungestört an der Vollendung seiner Werke in
bewundernswerter geistiger Frische bis zum letzten Augenblicke
unermüdlich abreitet. Vor allem sei hier zweier umfangreicher Werke
gedacht. Ein großes hebräisches Werk Schemot..., das diese
überaus schwierige Materie systematisch behandelt. Dieses Werk ist
bereits von hervorragenden jüdischen Gelehrten aufs Glänzendste
begutachtet worden, die es als überaus notwendiges Handwerk auf diesem
Gebiete begrüßen. Sodann ein umfassender Kommentar zu den Pirkei Awot
(Sprüche der Väter), der unter Heranziehung und Deutung analoger
haggadischer Stellen den eigentlichen Sinn der Sprüche der Välter
ermitteln will. Von den bereits veröffentlichten Werken und Abhandlungen
seien besonders hervorgehoben: 1. Religiöse Zeitfragen. 2. Drei Reden
politischer Tendenz. 3. Schemen Rokeach. 4. Torat Naschim, ein Buch über
Heilighaltung der Ehegesetze, das bereits in 3. Auflage erschienen ist.
Wie seine Schriften, so war auch sein ganzes Leben dem Dienste des
Judentums geweiht; sein ganzes Leben war eine einzige heilige Handlung,
dem Torastudium und der Betätigung frommer Werke gewidmet. Aus dieser
wahren Gottesfurcht strömte echte Menschenliebe, eine Milde und eine
Sanftmut, wie sie nur einem wahren Weisen eigen ist.
Die Beerdigung des Dahingeschiedenen, welche am Donnerstag (6. Januar
1921) in Ansbach stattfand, hatte eine große Anzahl seiner Freunde und
Verehrer herangezogen. An der Bahre würdigte als erster Redner der
Ortsrabbiner Dr. Brader in formvollendeter und vom Herzen kommender Rede
die überragende Persönlichkeit des Verblichenen und dessen Verdiente um
die Gemeinden, in denen er gewirkt und das gesamte Judentum. Hierauf gab
der älteste Sohn, Herr Dr. J. Münz, früher Rabbiner in Berent, jetzt in
Berlin wohnhaft, dem tiefen Schmerze der Familie ergreifenden Ausdruck.
Sodann widmete Herr Rabbiner Dr. A. Klein, Nürnberg, der Schwiegersohn
des Verklärten, schmerzerfüllt Worte der Liebe und Verehrung dem
heimgegangenen Lehrer und Meister. Im Namen des gesetzestreuen
Rabbinerverbandes schilderte sodann Herr Distriktsrabbiner Dr. Manes, Schwabach,
in ergreifender Weise die Verdienste des Entschlafenen. Zum Schlusse
beklagte Herr A. Grünbaum als Vertreter der Adat Jisrael,
Nürnberg, den schweren Verlust.
Es war der sehnlichste Wunsch des Entschlafenen, dass seine noch nicht
gedruckten Werke der Öffentlichkeit übergeben werden und Verbreitung
finden, ein Wunsch, der wohl bald in Erfüllung gehen wird. Möge so das
Andenken des Entschlafenen für alle Zeiten erhalten bleiben. Das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1929:
"(Ein literarischer Nachlass). Der bekannte Rabbiner Dr. Lazar Münz -
das Andenken an den Gerechten ist zum Segen, der jahrzehntelang im
Kempen als Rabbiner amtierte und in Ansbach (Bayern) seine Grabstätte
fand, hat unter anderen literarischen Arbeiten ein großes hebräisches
Werk über Ehescheidungsfragen Get mesudar ('geordnete Scheidung')
hinterlassen. Mehrere hervorragende talmudische Autoritäten haben sich in
ihren Besprechungen über dieses Werk sehr günstig geäußert. So
schreibt Prof. Dr. David Hoffmann - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen: 'Bereits vor mehreren Jahren hat mir der hoch verehrte
verstorbene Rabbiner Eleasar Münz, Enkel des Schemen Rokeach,
einen Teil seines Werkes Get Mesudar als Manuskript zur
Kenntnis gebracht. Seitdem hat es mich mit lebhaftem Bedauern erfüllt,
dass das bedeutsame Werk noch nicht im Druck erschienen ist und daher
seinem dringlichen Zwecke nicht dienstbar gemacht werden konnte. Das Buch
wird für alle Rabbinate, die sich mit Ehescheidungen zu befassen haben,
in kürzer Zeit ein unentbehrliches Hilfsmittel werden.' Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1929:
"(Ein literarischer Nachlass). Der bekannte Rabbiner Dr. Lazar Münz -
das Andenken an den Gerechten ist zum Segen, der jahrzehntelang im
Kempen als Rabbiner amtierte und in Ansbach (Bayern) seine Grabstätte
fand, hat unter anderen literarischen Arbeiten ein großes hebräisches
Werk über Ehescheidungsfragen Get mesudar ('geordnete Scheidung')
hinterlassen. Mehrere hervorragende talmudische Autoritäten haben sich in
ihren Besprechungen über dieses Werk sehr günstig geäußert. So
schreibt Prof. Dr. David Hoffmann - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen: 'Bereits vor mehreren Jahren hat mir der hoch verehrte
verstorbene Rabbiner Eleasar Münz, Enkel des Schemen Rokeach,
einen Teil seines Werkes Get Mesudar als Manuskript zur
Kenntnis gebracht. Seitdem hat es mich mit lebhaftem Bedauern erfüllt,
dass das bedeutsame Werk noch nicht im Druck erschienen ist und daher
seinem dringlichen Zwecke nicht dienstbar gemacht werden konnte. Das Buch
wird für alle Rabbinate, die sich mit Ehescheidungen zu befassen haben,
in kürzer Zeit ein unentbehrliches Hilfsmittel werden.'
Dieses wichtige und bedeutende Werk von Rabbiner Dr. Lazar Münz befindet
sich nunmehr im Drucke und wird in einigen Monaten erscheinen. Ediert wird
das Werk von dem Sohne Rabbiner Dr. J. Münz und dem Schwiegersohne
Rabbiner Dr. Arnold Klein (sc. Adas
Israel, Nürnberg).
 Subskriptionen
auf dieses Werk werden schon jetzt von den genannten Herausgebern
entgegengenommen." Subskriptionen
auf dieses Werk werden schon jetzt von den genannten Herausgebern
entgegengenommen."
Links: Titelblatt des "Get Musudar" vom Eleasar Münz,
erschienen Bilgoraj (bei Lublin, Polen) 1932 |
Goldene Hochzeit von Isidor und Babette Asch (1928)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni
1928: "Ansbach. Am Lag baomer konnten die Privatierseheleute
Isidor Asch und Babette das seltene Fest der goldenen Hochzeit feiern. Die
ganze Gemeinde nahm regen Anteil an dieser seltenen Feier und wurden dem
Jubelpaar von nah und fern viele Ehrungen zuteil. Möge es den Gefeierten
vergönnt sein, in Ansbach, wohin sie vor einem Jahre gezogen sind, in
geistiger und körperlicher Frische einen recht heiteren Lebensabend zu
verbringen. (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni
1928: "Ansbach. Am Lag baomer konnten die Privatierseheleute
Isidor Asch und Babette das seltene Fest der goldenen Hochzeit feiern. Die
ganze Gemeinde nahm regen Anteil an dieser seltenen Feier und wurden dem
Jubelpaar von nah und fern viele Ehrungen zuteil. Möge es den Gefeierten
vergönnt sein, in Ansbach, wohin sie vor einem Jahre gezogen sind, in
geistiger und körperlicher Frische einen recht heiteren Lebensabend zu
verbringen. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |
Zum Tod von Joseph Heilbrunn, langjähriger Kassier der Gemeinde
(1929)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1929: "Ansbach. Nach kurzer, tückischer Krankheit wurde in der
Vollkraft seines Wirkens Herr Joseph Heilbrunn aus diesem Leben abgerufen.
Den herben Verlust dieses edlen Mannes betrauert nicht nur seine Familie,
sondern die ganze Gemeinde, der er lange Jahre seine Dienste als Kassier
widmete. Am Grabe gab Herr Rabbiner Dr. Munk namens der Familien dem
schweren Verluste tiefgefühlten Ausdruck. Der Vorstand der israelitischen
Kultusgemeinde, Herr Kommerzienrat Dietenhöfer, verabschiedete sich in
bewegten Worten von dem eifrigen Mitarbeiter und treuen
Freunde." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1929: "Ansbach. Nach kurzer, tückischer Krankheit wurde in der
Vollkraft seines Wirkens Herr Joseph Heilbrunn aus diesem Leben abgerufen.
Den herben Verlust dieses edlen Mannes betrauert nicht nur seine Familie,
sondern die ganze Gemeinde, der er lange Jahre seine Dienste als Kassier
widmete. Am Grabe gab Herr Rabbiner Dr. Munk namens der Familien dem
schweren Verluste tiefgefühlten Ausdruck. Der Vorstand der israelitischen
Kultusgemeinde, Herr Kommerzienrat Dietenhöfer, verabschiedete sich in
bewegten Worten von dem eifrigen Mitarbeiter und treuen
Freunde." |
Zum 70. Geburtstag von Jakob Weil, ehemaliger Gemeindevorsteher und
Stadtrat (1929)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Dezember 1929: "Ansbach. Am 4. November (1929) vollendete Herr Jakob
Weil sein 70. Lebensjahr. Herr Weil war in früheren Jahren Vorstand
unserer Gemeinde und führte die Geschäfte der Verwaltung in
vorbildlicher Weise. Während zweier Wahlperioden war er auch Mitglied des
Stadtrates Ansbach und wirkte in demselben zur Zufriedenheit aller
Bürger. Wenn es nicht gelang, Herrn Weil dem Stadtrate zu erhalten, so
lag dies lediglich in der seitens der völkischen Verbände verursachten
Hetze gegen die jüdischen Bürger unserer Stadt. Während des Krieges
hatte Herr Weil im Stadtrate das Referat der Lebensmittelversorgung und
wenn gerade hier die Versorgung jederzeit gelang, so war dies, wie Herr
Oberbürgermeister in letzter Sitzung des jetzigen Stadtrates erwähnte,
lediglich dem Verdienste des Herrn Jakob Weil zu verdanken. Möge es ihm
vergönnt sein, sich noch lange Jahre der besten Gesundheit zu
erfreuen." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Dezember 1929: "Ansbach. Am 4. November (1929) vollendete Herr Jakob
Weil sein 70. Lebensjahr. Herr Weil war in früheren Jahren Vorstand
unserer Gemeinde und führte die Geschäfte der Verwaltung in
vorbildlicher Weise. Während zweier Wahlperioden war er auch Mitglied des
Stadtrates Ansbach und wirkte in demselben zur Zufriedenheit aller
Bürger. Wenn es nicht gelang, Herrn Weil dem Stadtrate zu erhalten, so
lag dies lediglich in der seitens der völkischen Verbände verursachten
Hetze gegen die jüdischen Bürger unserer Stadt. Während des Krieges
hatte Herr Weil im Stadtrate das Referat der Lebensmittelversorgung und
wenn gerade hier die Versorgung jederzeit gelang, so war dies, wie Herr
Oberbürgermeister in letzter Sitzung des jetzigen Stadtrates erwähnte,
lediglich dem Verdienste des Herrn Jakob Weil zu verdanken. Möge es ihm
vergönnt sein, sich noch lange Jahre der besten Gesundheit zu
erfreuen." |
Zum 60. Geburtstag des Gemeindevorstehers Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer (1930)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
August 1930: "Ansbach. Am 1. August beging Herr Kommerzienrat
Ludwig Dietenhöfer die Feier seines 60. Geburtstages. Der Jubilar hatte
sich allen ihm zugedachten offiziellen Ehrungen entzogen und verbrachte
den Tag in Abwesenheit von Ansbach nur im Kreise seiner engsten Familie.
Er wurde ihm dennoch eine Fülle herzlichster Ehrenbezeugungen von allen
Seiten zuteil, die mit Recht auf die allgemeine Beliebtheit und hohe
Verehrung für den Jubilar zurückschließen lassen kann. Seit über
fünfundzwanzig Jahren für die hiesige Kultusgemeinde unermüdlich
tätig, wurde Kommerzienrat Dietenhöfer zu wiederholten Malen durch
einstimmige Wahl an die Spitze der Gemeinde berufen. Die Tätigkeit, die
er als erster Vorstand viele Jahre hindurch entfaltet hat, war stets eine
segensreiche und von Erfolg bekrönte. Vom ernsten Willen beseelt, die
gerechten Wünsche aller Mitglieder nach Möglichkeit zu erfüllen, hat er
sich ein seltenes rückhaltloses Vertrauen erworben, das ihm in gleichem
Maße von den Beamten wie von den Mitgliedern der Gemeinde
entgegengebracht wird. Als verständnisvoller und oftmals bewährter
Beschützer der jüdischen Tradition ist er mit seinem klugen Rat und
seiner zielbewussten Führung der treueste und sicherste Förderer der
Ansbacher Gemeinde geworden. Sie hat ihm als kleines Zeichen ihrer
dankbaren Verehrung eine mit Widmung versehene hervorragend künstlerische
Bildaufnahme der Synagoge zu seinem Jubiläum überreicht. Der Verband
Bayerischer Israelitischer Gemeinden, dem der Jubilar seit seiner
Gründung als Mitglied der Tagung und seit sieben Jahren als Mitglied des
Rats angehört, sandte ein besonders herzliches Glückwunschschreiben, in
dem er Kommerzienrat Dietenhöfer seinen Dank für die hingebungsvolle
Arbeit abstattete, die er im Verbandes leistete. Der Verband gedachte
seines Wirkens im Bezirksausschuss Ansbach, seiner unermüdlichen
Tätigkeit als Baureferent für sämtliche Gemeinden des Landes sowie
seiner Mitarbeit bei allen großen Fragen, die den Verband, seinen Aufbau
und seine Arbeit betreffen. Der Verband feierte ihn als einen der Männer,
auf deren persönlichstem Wirken der Erfolg des Verbandes beruhe." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
August 1930: "Ansbach. Am 1. August beging Herr Kommerzienrat
Ludwig Dietenhöfer die Feier seines 60. Geburtstages. Der Jubilar hatte
sich allen ihm zugedachten offiziellen Ehrungen entzogen und verbrachte
den Tag in Abwesenheit von Ansbach nur im Kreise seiner engsten Familie.
Er wurde ihm dennoch eine Fülle herzlichster Ehrenbezeugungen von allen
Seiten zuteil, die mit Recht auf die allgemeine Beliebtheit und hohe
Verehrung für den Jubilar zurückschließen lassen kann. Seit über
fünfundzwanzig Jahren für die hiesige Kultusgemeinde unermüdlich
tätig, wurde Kommerzienrat Dietenhöfer zu wiederholten Malen durch
einstimmige Wahl an die Spitze der Gemeinde berufen. Die Tätigkeit, die
er als erster Vorstand viele Jahre hindurch entfaltet hat, war stets eine
segensreiche und von Erfolg bekrönte. Vom ernsten Willen beseelt, die
gerechten Wünsche aller Mitglieder nach Möglichkeit zu erfüllen, hat er
sich ein seltenes rückhaltloses Vertrauen erworben, das ihm in gleichem
Maße von den Beamten wie von den Mitgliedern der Gemeinde
entgegengebracht wird. Als verständnisvoller und oftmals bewährter
Beschützer der jüdischen Tradition ist er mit seinem klugen Rat und
seiner zielbewussten Führung der treueste und sicherste Förderer der
Ansbacher Gemeinde geworden. Sie hat ihm als kleines Zeichen ihrer
dankbaren Verehrung eine mit Widmung versehene hervorragend künstlerische
Bildaufnahme der Synagoge zu seinem Jubiläum überreicht. Der Verband
Bayerischer Israelitischer Gemeinden, dem der Jubilar seit seiner
Gründung als Mitglied der Tagung und seit sieben Jahren als Mitglied des
Rats angehört, sandte ein besonders herzliches Glückwunschschreiben, in
dem er Kommerzienrat Dietenhöfer seinen Dank für die hingebungsvolle
Arbeit abstattete, die er im Verbandes leistete. Der Verband gedachte
seines Wirkens im Bezirksausschuss Ansbach, seiner unermüdlichen
Tätigkeit als Baureferent für sämtliche Gemeinden des Landes sowie
seiner Mitarbeit bei allen großen Fragen, die den Verband, seinen Aufbau
und seine Arbeit betreffen. Der Verband feierte ihn als einen der Männer,
auf deren persönlichstem Wirken der Erfolg des Verbandes beruhe." |
Zum Tod von Anton Michelsohn, langjähriger
Vorsteher der Chewra Kadischa (1931)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Oktober 1931: "Ansbach, 28. August 1931. Im 74. Lebensjahr
entschließ Herr Anton Michelsohn, eine um die Kultusgemeinde Ansbach
verdiente Persönlichkeit. Michelsohn war viele Jahre erster Vorstand der Chewra-Kadischa. Seine Verdienste würdigten am Grab Herr Kommerzienrat
Dietenhöfer und Rabbiner Dr. Monk. Für die Chewra dankte Herr Haas dem
Heimgegangenen für die treuen Dienste." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Oktober 1931: "Ansbach, 28. August 1931. Im 74. Lebensjahr
entschließ Herr Anton Michelsohn, eine um die Kultusgemeinde Ansbach
verdiente Persönlichkeit. Michelsohn war viele Jahre erster Vorstand der Chewra-Kadischa. Seine Verdienste würdigten am Grab Herr Kommerzienrat
Dietenhöfer und Rabbiner Dr. Monk. Für die Chewra dankte Herr Haas dem
Heimgegangenen für die treuen Dienste." |
Zum 70. Geburtstag von Leo Stein, langjähriges Verwaltungsmitglied der
jüdischen Gemeinde (1935)
 Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Februar
1935: "Ansbach. Am 16. Januar konnte unser langjähriges
Verwaltungsmitglied, Herr Leo Steiner, seinen 70. Geburtstag feiern, woran
die ganze Gemeinde aufrichtig teilnahm. Der Vorstand der Kultusgemeinde,
Herr Kommerzienrat Dieterhöfer, überbrachte die Wünsche der Gemeinde
und Verwaltung und gedachte in anerkennenden Worten der treuen und
hingebenden Dienste, welche der Jubilar in der langen Reihe von Jahren der
Gemeinde widmete. Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte er
eine wundervolle Mappe. Herr Distriktsrabbiner Dr. Munk schloss sich
diesen Wünschen an in der frommen Hoffnung, dass es Herrn Steiner
vergönnt sein möge, noch viele Jahre an der Seite seiner getreuen
Lebensgefährtin zum Wohle der Gemeinde zu wirken." Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Februar
1935: "Ansbach. Am 16. Januar konnte unser langjähriges
Verwaltungsmitglied, Herr Leo Steiner, seinen 70. Geburtstag feiern, woran
die ganze Gemeinde aufrichtig teilnahm. Der Vorstand der Kultusgemeinde,
Herr Kommerzienrat Dieterhöfer, überbrachte die Wünsche der Gemeinde
und Verwaltung und gedachte in anerkennenden Worten der treuen und
hingebenden Dienste, welche der Jubilar in der langen Reihe von Jahren der
Gemeinde widmete. Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte er
eine wundervolle Mappe. Herr Distriktsrabbiner Dr. Munk schloss sich
diesen Wünschen an in der frommen Hoffnung, dass es Herrn Steiner
vergönnt sein möge, noch viele Jahre an der Seite seiner getreuen
Lebensgefährtin zum Wohle der Gemeinde zu wirken." |
Der langjährige Gemeindevorsteher Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer zieht nach
Nürnberg (1936)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni
1936: "Ansbach. Herr Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer
siedelte am 20. Mai 1936 von seiner Heimatgemeinde Ansbach nach Nürnberg
über und legte sein Amt als erster Vorsitzender der Gemeinde Ansbach
nieder. Sein Ausscheiden aus der Gemeinde bedeutet einen großen Verlust
für uns. Verstand es doch Herr Kommerzienrat Dietenhöfer sein
verantwortungsvolles Amt nahezu 25 Jahre zur vollsten Zufriedenheit seiner
Gemeinde in geradezu vorbildlicher Weise zu versehen. Aus Anlass seines
Ausscheidens fand am Samstag, 16. Mai 1936, vormittags feierlicher
Schlussgottesdienst statt. Herr Rabbiner Dr. Munk hielt eine Predigt, in
deren Verlauf er vom Wochendoppelabschnitt ausging und auf Vers 2 Kap. 27
4. Buch Moses zurückgriff. Er schilderte in tiefgründigen Worten das Schaffen
und Wirken des Herrn Kommerzienrates Dietenhöfer für seine Gemeinde und
gestaltete dadurch den Gottesdienst zu einer weihevollen Stunde. Sonntag,
17. Mai fand dann noch im gemeindlichen Sitzungssaal eine besondere
Abschiedsfeier statt. Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt
Justizrat Frankenburger, schilderte in markigen und treffenden Worten, was
Herr Dietenhöfer ins einer mehr als 33-jährigen Tätigkeit für seine
Gemeinde geleistet hat und welche Erfolge seiner aufopfernden
Arbeitskraft, seiner Entschlossenheit und Tatkraft zu danken waren. Nach
ihm wies Herr Leo Steiner auf seine wirtschaftlichen Verdienste,
namentlich auch den Einbau des Gemeindezimmers in den Hauptbau der
Synagoge, die Instandsetzung der Synagoge, Erweiterung der Friedhofsanlage
und Ankauf von Grundstücken hin. Herr Dr. Loevy sprach als Vertreter des
R.J.F. (Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten) und Herr Lehrer Neuberger
für die Schuljugend. Herr Rabbiner Dr. Munk rühmte namens der von ihm
vertretenen Bezirksgemeinden in treffenden Worten, welch segensreiche
Tätigkeit Herr Kommerzienrat Dietenhöfer für die Gemeinden des Bezirks
im bayerischen Gemeindeverband und im Rat entfaltete, und was für die
vielen Gemeinden auf die Initiative des Herrn Dietenhöfer hin erreicht
wurde. In seinem Schlusswort stattete der Versammlungsleiter den
herzlichsten Dank der Gemeindeangehörigen ab und überreichte ein
sinnvolles Geschenk der Gemeinde." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni
1936: "Ansbach. Herr Kommerzienrat Ludwig Dietenhöfer
siedelte am 20. Mai 1936 von seiner Heimatgemeinde Ansbach nach Nürnberg
über und legte sein Amt als erster Vorsitzender der Gemeinde Ansbach
nieder. Sein Ausscheiden aus der Gemeinde bedeutet einen großen Verlust
für uns. Verstand es doch Herr Kommerzienrat Dietenhöfer sein
verantwortungsvolles Amt nahezu 25 Jahre zur vollsten Zufriedenheit seiner
Gemeinde in geradezu vorbildlicher Weise zu versehen. Aus Anlass seines
Ausscheidens fand am Samstag, 16. Mai 1936, vormittags feierlicher
Schlussgottesdienst statt. Herr Rabbiner Dr. Munk hielt eine Predigt, in
deren Verlauf er vom Wochendoppelabschnitt ausging und auf Vers 2 Kap. 27
4. Buch Moses zurückgriff. Er schilderte in tiefgründigen Worten das Schaffen
und Wirken des Herrn Kommerzienrates Dietenhöfer für seine Gemeinde und
gestaltete dadurch den Gottesdienst zu einer weihevollen Stunde. Sonntag,
17. Mai fand dann noch im gemeindlichen Sitzungssaal eine besondere
Abschiedsfeier statt. Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt
Justizrat Frankenburger, schilderte in markigen und treffenden Worten, was
Herr Dietenhöfer ins einer mehr als 33-jährigen Tätigkeit für seine
Gemeinde geleistet hat und welche Erfolge seiner aufopfernden
Arbeitskraft, seiner Entschlossenheit und Tatkraft zu danken waren. Nach
ihm wies Herr Leo Steiner auf seine wirtschaftlichen Verdienste,
namentlich auch den Einbau des Gemeindezimmers in den Hauptbau der
Synagoge, die Instandsetzung der Synagoge, Erweiterung der Friedhofsanlage
und Ankauf von Grundstücken hin. Herr Dr. Loevy sprach als Vertreter des
R.J.F. (Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten) und Herr Lehrer Neuberger
für die Schuljugend. Herr Rabbiner Dr. Munk rühmte namens der von ihm
vertretenen Bezirksgemeinden in treffenden Worten, welch segensreiche
Tätigkeit Herr Kommerzienrat Dietenhöfer für die Gemeinden des Bezirks
im bayerischen Gemeindeverband und im Rat entfaltete, und was für die
vielen Gemeinden auf die Initiative des Herrn Dietenhöfer hin erreicht
wurde. In seinem Schlusswort stattete der Versammlungsleiter den
herzlichsten Dank der Gemeindeangehörigen ab und überreichte ein
sinnvolles Geschenk der Gemeinde." |
Sonstige Mitteilungen
In
Ansbach gibt es noch eine Landjudenschafts- und Stiftungskasse (1847)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Orient"
vom 22. Januar 1847: "In unserer Kreishauptstadt Ansbach
besteht noch aus alter Zeit eine sogenannte Landjudenschafts- und Stiftungskasse,
zu welcher unsere Gemeinden mit beträchtlichen Summen zu konkurrieren
haben. Gegen dies und gegen die Verwaltungsart, die jedoch in ganz
gesetzlicher Form besteht, wollen nun mehrere Gemeinden einen Kampf auf
Leben und Tod erheben, und wer unsere Landgemeinden kennt, der weiß, wie
willkommen eine solche Aussicht manchem ist."
Artikel in der Zeitschrift "Der Orient"
vom 22. Januar 1847: "In unserer Kreishauptstadt Ansbach
besteht noch aus alter Zeit eine sogenannte Landjudenschafts- und Stiftungskasse,
zu welcher unsere Gemeinden mit beträchtlichen Summen zu konkurrieren
haben. Gegen dies und gegen die Verwaltungsart, die jedoch in ganz
gesetzlicher Form besteht, wollen nun mehrere Gemeinden einen Kampf auf
Leben und Tod erheben, und wer unsere Landgemeinden kennt, der weiß, wie
willkommen eine solche Aussicht manchem ist." |
Antijüdische Äußerungen eines Pfarrers (1870)
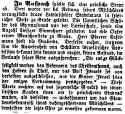 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juli 1870: "In Ansbach spielte sich eine peinliche Szene ab. Dort wurde der bei Rettung
seiner Mitschülers verunglückte brave Lateinschüler Stadelmann in
feierlicher Weise zu Grabe geleitet. Die sämtlichen Schüler des
Gymnasiums und der Lateinschule, sowie eine Anzahl hiesiger Einwohner
geleiteten das edle Opfer reiner Menschenliebe zu Grabe. Herr Pfarrer
Caselmann hielt die Grabrede. Derselbe nahm, trotzdem ihm die Anwesenheit
von Schülern israelitischer Konfession bekannt sein konnte und musste,
keinen Anstand, im Verlaufe seiner Rede auszusprechen: 'Die ewige
Glückseligkeit werden den Bekennern des Christentums, auch den Heiden
zuteil, nur das Volk Israel sei von derselben ausgeschlossen, nur die
Kinder Israel seien der ewigen Verdammung preisgegeben.' - Diese Worte
mussten auf das jugendliche Gemüt der israelitischen Knaben einen umso
peinlicheren Eindruck machen, als dieselben - unbekümmert um das
Glaubensbekenntnis ihres dahingeschiedenen Mitschülers - demselben die
letzte Ehre zu erweisen gekommen waren." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juli 1870: "In Ansbach spielte sich eine peinliche Szene ab. Dort wurde der bei Rettung
seiner Mitschülers verunglückte brave Lateinschüler Stadelmann in
feierlicher Weise zu Grabe geleitet. Die sämtlichen Schüler des
Gymnasiums und der Lateinschule, sowie eine Anzahl hiesiger Einwohner
geleiteten das edle Opfer reiner Menschenliebe zu Grabe. Herr Pfarrer
Caselmann hielt die Grabrede. Derselbe nahm, trotzdem ihm die Anwesenheit
von Schülern israelitischer Konfession bekannt sein konnte und musste,
keinen Anstand, im Verlaufe seiner Rede auszusprechen: 'Die ewige
Glückseligkeit werden den Bekennern des Christentums, auch den Heiden
zuteil, nur das Volk Israel sei von derselben ausgeschlossen, nur die
Kinder Israel seien der ewigen Verdammung preisgegeben.' - Diese Worte
mussten auf das jugendliche Gemüt der israelitischen Knaben einen umso
peinlicheren Eindruck machen, als dieselben - unbekümmert um das
Glaubensbekenntnis ihres dahingeschiedenen Mitschülers - demselben die
letzte Ehre zu erweisen gekommen waren." |
Diskussion
in der Kirchensynode zur Frage, ob für die "Bekehrung der Israeliten"
in den Kirchen gebetet werden sollte (1885)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1885: "Ansbach, 23. September (1885). In
der heutigen Sitzung der hier versammelten Generalsynode fand eine
lebhafte Diskussion über folgenden Gegenstand statt: Zu einem Antrag der
Synode Windsbach wegen Aufnahme der sonntäglichen Fürbitte für die
Mission unter den Heiden und für die Bekehrung Israels hatte der
Ausschuss sich zu dem Antrage geeinigt: 'Hohe Generalsynode wird ersucht,
den Antrag der Diözesansynode Windsbach dem hohen Kirchenregimente zur
geneigten Berücksichtigung zu empfehlen und dasselbe zu bitten, dieser
Fürbitte die geeignete Fassung zu geben.' Referent Kirchenrat Dekan
Engelhardt empfahl den Ausschussantrag. Dekan Seßner von Feuchtwangen
äußerte sich dahin, dass die Israeliten es übel nehmen müssten, wenn
für ihre Bekehrung gebetet würde. Direkt Schreiber von Augsburg nannte
die Fürbitte beleidigend. Auch Senior Brendel von Augsburg hielt die
Fürbitte für unangemessen. Präsident Dr. von Stählin erklärte, die
Fürbitte für Israel sei an und für sich ganz recht, aber es fromme
nicht Alles. Er fürchte unangenehme Folgen, die Beschuldigung des
Antisemitismus, von dem wir in unserem Lande nichts wüssten. Bei der
Abstimmung wurde die Aufnahme der Mission unter den Heiden in das
sonntägliche Gebet mit großer Mehrheit angenommen, die Fürbitte für
die Israeliten aber mit allen gegen 33 Stimmen abgelehnt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1885: "Ansbach, 23. September (1885). In
der heutigen Sitzung der hier versammelten Generalsynode fand eine
lebhafte Diskussion über folgenden Gegenstand statt: Zu einem Antrag der
Synode Windsbach wegen Aufnahme der sonntäglichen Fürbitte für die
Mission unter den Heiden und für die Bekehrung Israels hatte der
Ausschuss sich zu dem Antrage geeinigt: 'Hohe Generalsynode wird ersucht,
den Antrag der Diözesansynode Windsbach dem hohen Kirchenregimente zur
geneigten Berücksichtigung zu empfehlen und dasselbe zu bitten, dieser
Fürbitte die geeignete Fassung zu geben.' Referent Kirchenrat Dekan
Engelhardt empfahl den Ausschussantrag. Dekan Seßner von Feuchtwangen
äußerte sich dahin, dass die Israeliten es übel nehmen müssten, wenn
für ihre Bekehrung gebetet würde. Direkt Schreiber von Augsburg nannte
die Fürbitte beleidigend. Auch Senior Brendel von Augsburg hielt die
Fürbitte für unangemessen. Präsident Dr. von Stählin erklärte, die
Fürbitte für Israel sei an und für sich ganz recht, aber es fromme
nicht Alles. Er fürchte unangenehme Folgen, die Beschuldigung des
Antisemitismus, von dem wir in unserem Lande nichts wüssten. Bei der
Abstimmung wurde die Aufnahme der Mission unter den Heiden in das
sonntägliche Gebet mit großer Mehrheit angenommen, die Fürbitte für
die Israeliten aber mit allen gegen 33 Stimmen abgelehnt." |
Neunte freie Konferenz der bayerischen Rabbiner in Ansbach (1904)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1904:
"Ansbach. Mittwoch, 29. August wurde in hiesiger Stadt die neunte
freie Konferenz der bayerischen Rabbiner abgehalten. Gegenstand der
Beratungen war zunächst die Einführung eines einheitlichen
Religionslehrbuches für die bayerischen Gymnasien und Realschulen.
Gemäß den Anträgen des 'Israelitischen Lehrervereins in Bayern', eine
Kommission zur Regelung und Hebung des israelitischen
Religionslehrerstandes durch Delegierung einiger bayerischer Rabbinen zu
ergänzen, wurde auch über diese wichtige Materie, sowie über
verschiedene andere, das bayerische Judentum interessierende Fragen
Beratung gepflogen. Die Versammlung ließ an Seine Königliche Hoheit,
Prinzregent Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser, ein
Huldigungstelegramm abgehen, welches durch ein Antworttelegramm aus
Hohenschwangau huldvollst Erwiderung des Regenten fand. Die Versammlung
begann und schloss mit begeisterten Huldigungen für den greisen Lenker
des bayerischen Staats wie für das Herrscherhaus und das geliebte
bayerische Vaterland. Auf den Verlauf der Verhandlungen wird noch
eingehender zurückgekommen werden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1904:
"Ansbach. Mittwoch, 29. August wurde in hiesiger Stadt die neunte
freie Konferenz der bayerischen Rabbiner abgehalten. Gegenstand der
Beratungen war zunächst die Einführung eines einheitlichen
Religionslehrbuches für die bayerischen Gymnasien und Realschulen.
Gemäß den Anträgen des 'Israelitischen Lehrervereins in Bayern', eine
Kommission zur Regelung und Hebung des israelitischen
Religionslehrerstandes durch Delegierung einiger bayerischer Rabbinen zu
ergänzen, wurde auch über diese wichtige Materie, sowie über
verschiedene andere, das bayerische Judentum interessierende Fragen
Beratung gepflogen. Die Versammlung ließ an Seine Königliche Hoheit,
Prinzregent Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser, ein
Huldigungstelegramm abgehen, welches durch ein Antworttelegramm aus
Hohenschwangau huldvollst Erwiderung des Regenten fand. Die Versammlung
begann und schloss mit begeisterten Huldigungen für den greisen Lenker
des bayerischen Staats wie für das Herrscherhaus und das geliebte
bayerische Vaterland. Auf den Verlauf der Verhandlungen wird noch
eingehender zurückgekommen werden." |
Über einen Toraschreinvorhang aus Ansbach (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juni 1908: "Ein
Parochet der Gemeinde Ansbach. Wir führen hier unseren Lesern die
Abbildung eines Erzeugnisses der alten Goldstickerkunst vor, das 175 Jahre
alt ist; ein Alter, das allein genügt, um die Solidarität dieser
kunstvollen Arbeit darzutun. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juni 1908: "Ein
Parochet der Gemeinde Ansbach. Wir führen hier unseren Lesern die
Abbildung eines Erzeugnisses der alten Goldstickerkunst vor, das 175 Jahre
alt ist; ein Alter, das allein genügt, um die Solidarität dieser
kunstvollen Arbeit darzutun.
Der Parochet zeigt die drei Kronen, die Krone der Tora, die Krone des
Priestertums und die Krone des Königtums, ferner die Gesetzestafeln, den
Tisch mit den Schaubroten, den Leuchter auch den Opferaltar, auf welchem
der Kopf eines Opfertieres vom Feuer verzehrt wird, und das Wasserbecken
mit den Wasserstrahlen.
Das Paroches wie der Kapores besteht auf zweierlei Samt (blau und
gelbbraun) und zeigt Spreng- und Anlegearbeit in künstlerischer
Ausführung. Grüne Trauben, welche die Seiten des Paroches zieren, sind
in Lyoner Gold gefertigt.
Das Paroches ist 25 Jahre älter als die 150 Jahre alte Ansbacher
Gemeindesynagoge. Es zeugt für die bescheidene Opferfreudigkeit
jener Zeit, dass der Spender nicht darauf genannt ist und heute auch nicht
mit Sicherheit ermittelt werden kann. Das Paroches soll nach dem Muster
eines der Gemeinde Ichenhausen gehörigen gefertigt sein, als dessen
Spender eine Familie Höchstetter festgestellt ist.
Die Stickerei und die Echtheit des dazu verwendeten Goldes hat in den 175
Jahren, die darüber hinweggegangen sind, erfolgreich Widerstand
geleistet. Sie ist bis auf einige Stellen so gut wie neu. Nicht so der
Samt. Ihm hat der Zahn der Zeit so stark zugesetzt. dass der die Stickerei
tragende Stoff brüchig wurde und so das Kunstwerk Gefahr lief, ebenfalls
zu verfallen. Man hat nun versucht die kostbare Stickerei von dem
verfallenden Samte abzunehmen und sie unversehrt und unverändert auf
neuem Samt anzubringen. - Die Art, wie diese Übertragung gelungen ist,
bildet ein Kunstwerk für sich, das aus der Goldstickerei des Frl. Ahrona
Wertheimer in München Kanalstraße 19a hervorgegangen ist. Dieselbe
Goldstickererin hat auch das Paroches für die Einweihung der neuen
Synagoge in Frankfurt am Main hergestellt und ist seitdem mit der
Lieferung von zwei anderen Paroches für die Frankfurter
Religionsgesellschaft betrat worden.
Es wäre von Interesse zu erfahren, ob das Paroches zu Ichenhausen, dem
dem hier abgebildeten als Muster gedient haben soll und also noch älter
sein muss, ebenfalls noch erhalten ist. - Jedenfalls dürfte es wenige
Erzeugnisse der alten Goldstickekunst geben, die sich so lange und so gut
erhalten haben." |
Bezirkstagung der mittelfränkischen Aguda-Gruppen
in Ansbach am 1. Mai 1921
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni 1921:
"Bezirkstagung der mittelfränkischen Aguda-Gruppen. Ansbach, 1. Mai
(unlieb verspätet). Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni 1921:
"Bezirkstagung der mittelfränkischen Aguda-Gruppen. Ansbach, 1. Mai
(unlieb verspätet).
Text wird nicht abgeschrieben - bei Interesse anklicken. |
 |
Verbandstagung des Bayerischen Verbandes gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine
in der Agudas Jisroel Jugend-Organisation in Ansbach (1924)
vgl. Informationen über Artikel
"Agudat Yisrael" bei wikipedia
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Oktober 1924:
"Verbandstagung in Ansbach. Am Sonntag, den 14. September fand
in Ansbach die Verbandstagung des Bayrischen Verbandes gesetzestreuer
jüdischer Jugendvereine in der Agudas Jisrael Jugend-Organisation, statt.
Es war die erste Tagung dieses Verbandes, der nunmehr 1 1/2 Jahre und die
bayerischen Jugendgruppen umfassend, mit trefflichen Erfolgen an dem
Ausbau der A.J.-Jugend-Organisation mitwirkt. Erschienen waren etwa 300
Gäste aus Nürnberg, Fürth, Regensburg, Würzburg, Ansbach, Brückenau,
Gunzenhausen, Treuchtlingen, Ellingen, Berolzheim, Sugenheim, Adelsdorf,
Altenmuhr, Wittelshofen, Heidenheim, Thüngen usw. Nach einem Schiur (Toralernstunde
bzw. -vortrag), der morgens um 8 Uhr die Tagung einleitete und nach
den verschiedenen Begrüßungsansprachen erstattete Gustav Münz im Namen
der Verbandsleitung den Tätigkeitsbericht. Eine ausgedehnte Diskussion,
die sich daran anschloss, füllte den Rest des Vormittages aus. Nach Tisch
eröffnete den Reigen der Redner Dr. Max Cohen - Köln (Mitglied des
Organisationsvorstandes in Köln) mit einem Vortrag über 'Jüdische
Gebotserfüllung'. In begeisternden, wunderschönen Worten suchte er
darzutun, dass Hislahawus und Jiras Haschem (Gottesfurcht), verbunden mit
der richtigen Erfassung der Mizwaus (Gebote) nur die richtige
Gebotserfüllung verbürgen könne. Sodann sprach Herr Rabbiner Dr. Brader
- Ansbach über 'Agudas Jisroel'. Anhand einer schönen Midraschstelle
führte er in großartiger fesselnder Weise aus, wie Mischpot und Zedokoh
(Recht und Gerechtigkeit) die zwei Programmpunkte der Agudas Jisroel
seien, Mischpot das Recht, das leider erst erkämpft werden muss in
Dingen, die das jüdische Volk betreffen, ein entscheidendes Wort
mitsprechen zu dürfen und 'Zedokoh', die dem Volksganzen und seiner
Erhaltung in körperlicher wie geistiger Beziehung dienende Fürsorge.
Henry Pels - Hamburg sprach sodann als Abgesandter des Landesdirektoriums
des Keren Hathora und seine Ziele. Moritz Klugmann - Nürnberg referierte
sodann im Namen der Palästina-Zentrale über deren Tätigkeit für Erez
Jisroel. Als 'Neilohredner' begann dann Max Gutmann - Nürnberg seinen
Vortrag über 'Reparationsprobleme und Judenfrage'. Ein solches Problem
bestehe auch innerhalb des Judentums. Denn, was das Mittelalter an
physischer Kraft und die Emanzipation an kulturellen Werten verwüstet
hat, muss nun wieder gutgemacht werden. In meisterhafter Weise zeichnete
er mit jugendlichem Feuer die Mängel und Schäden der Zeit und zeigte
auch die Wege, wo die Reparation wieder einsetzen muss. Dieser letztere
Teil, der die Eigenart der bayerischen Landgemeinden, der ältesten
Kehillos in Deutschland so wundervoll nachfühlte und der damit auch die
Ziele des bayerischen Verbandes wiedergab, war von besonderem Baifall
begleitet. Gegend Abend musste die glänzend verlaufene Tagung geschlossen
werden, nachdem noch Herr Julius Sichel - Nürnberg die Grüße der
Nürnberger Ortsgruppe und Herr Sekretär Posen die Grüße im Namen der
Württembergisch-Badischen Landesverbandes der A.H. der Versammlung zur
Kenntnis brachten. Eine gelungene lustige Vorstellung vermittelte noch
für die Abendstunden eine angenehme Unterhaltung. Begeistert zog die
Jugend von dannen, gestärkt durch das Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit in gemeinsamer Pflichterfüllung. Die Tagung war ein
bedeutender Punkt in der Geschichte der Agudas-Jugend Deutschlands."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Oktober 1924:
"Verbandstagung in Ansbach. Am Sonntag, den 14. September fand
in Ansbach die Verbandstagung des Bayrischen Verbandes gesetzestreuer
jüdischer Jugendvereine in der Agudas Jisrael Jugend-Organisation, statt.
Es war die erste Tagung dieses Verbandes, der nunmehr 1 1/2 Jahre und die
bayerischen Jugendgruppen umfassend, mit trefflichen Erfolgen an dem
Ausbau der A.J.-Jugend-Organisation mitwirkt. Erschienen waren etwa 300
Gäste aus Nürnberg, Fürth, Regensburg, Würzburg, Ansbach, Brückenau,
Gunzenhausen, Treuchtlingen, Ellingen, Berolzheim, Sugenheim, Adelsdorf,
Altenmuhr, Wittelshofen, Heidenheim, Thüngen usw. Nach einem Schiur (Toralernstunde
bzw. -vortrag), der morgens um 8 Uhr die Tagung einleitete und nach
den verschiedenen Begrüßungsansprachen erstattete Gustav Münz im Namen
der Verbandsleitung den Tätigkeitsbericht. Eine ausgedehnte Diskussion,
die sich daran anschloss, füllte den Rest des Vormittages aus. Nach Tisch
eröffnete den Reigen der Redner Dr. Max Cohen - Köln (Mitglied des
Organisationsvorstandes in Köln) mit einem Vortrag über 'Jüdische
Gebotserfüllung'. In begeisternden, wunderschönen Worten suchte er
darzutun, dass Hislahawus und Jiras Haschem (Gottesfurcht), verbunden mit
der richtigen Erfassung der Mizwaus (Gebote) nur die richtige
Gebotserfüllung verbürgen könne. Sodann sprach Herr Rabbiner Dr. Brader
- Ansbach über 'Agudas Jisroel'. Anhand einer schönen Midraschstelle
führte er in großartiger fesselnder Weise aus, wie Mischpot und Zedokoh
(Recht und Gerechtigkeit) die zwei Programmpunkte der Agudas Jisroel
seien, Mischpot das Recht, das leider erst erkämpft werden muss in
Dingen, die das jüdische Volk betreffen, ein entscheidendes Wort
mitsprechen zu dürfen und 'Zedokoh', die dem Volksganzen und seiner
Erhaltung in körperlicher wie geistiger Beziehung dienende Fürsorge.
Henry Pels - Hamburg sprach sodann als Abgesandter des Landesdirektoriums
des Keren Hathora und seine Ziele. Moritz Klugmann - Nürnberg referierte
sodann im Namen der Palästina-Zentrale über deren Tätigkeit für Erez
Jisroel. Als 'Neilohredner' begann dann Max Gutmann - Nürnberg seinen
Vortrag über 'Reparationsprobleme und Judenfrage'. Ein solches Problem
bestehe auch innerhalb des Judentums. Denn, was das Mittelalter an
physischer Kraft und die Emanzipation an kulturellen Werten verwüstet
hat, muss nun wieder gutgemacht werden. In meisterhafter Weise zeichnete
er mit jugendlichem Feuer die Mängel und Schäden der Zeit und zeigte
auch die Wege, wo die Reparation wieder einsetzen muss. Dieser letztere
Teil, der die Eigenart der bayerischen Landgemeinden, der ältesten
Kehillos in Deutschland so wundervoll nachfühlte und der damit auch die
Ziele des bayerischen Verbandes wiedergab, war von besonderem Baifall
begleitet. Gegend Abend musste die glänzend verlaufene Tagung geschlossen
werden, nachdem noch Herr Julius Sichel - Nürnberg die Grüße der
Nürnberger Ortsgruppe und Herr Sekretär Posen die Grüße im Namen der
Württembergisch-Badischen Landesverbandes der A.H. der Versammlung zur
Kenntnis brachten. Eine gelungene lustige Vorstellung vermittelte noch
für die Abendstunden eine angenehme Unterhaltung. Begeistert zog die
Jugend von dannen, gestärkt durch das Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit in gemeinsamer Pflichterfüllung. Die Tagung war ein
bedeutender Punkt in der Geschichte der Agudas-Jugend Deutschlands." |
Bericht über die 50. Mitgliederversammlung des Jüdischen Lehrervereins für Bayern
e.V. am 30. und 31. August 1931 in Ansbach
 |
 |
 |
| Oben stehender
Bericht wird nicht abgeschrieben, da sein Inhalt nicht direkt mit der
jüdischen Geschichte Ansbachs zu tun hat; bei Interesse bitte
anklicken. |
Bericht: "'Jüdische
Kinderspielzeug'. Zur Ausstellung der 'Breslauer Kunststube' auf der
Versammlung des Bayerischen Jüdischen Lehrervereins in
Ansbach." |
Vorbereitungen zum Pessachfest (Artikel von 1932)
David Wallersteiner (1854-1938) stammte aus Kappel bei Bad
Buchau. Die geschilderten Erinnerungen werden sich auch auf Kappel
beziehen. David Wallersteiner war in Ansbach als Kantor und Schochet tätig. Er
konnte 1934 - im Alter von 80 Jahren - mit seiner Familie nach Erez Jisrael
emigrieren, wo er vier Jahre später gestorben ist.
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. März 1932: "Aus meinen
Kindertagen. Von David Wallersteiner in Ansbach. (Einer größeren
Schilderung entnommen.) Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. März 1932: "Aus meinen
Kindertagen. Von David Wallersteiner in Ansbach. (Einer größeren
Schilderung entnommen.)
… Gleich nach Purim wurde ein großer Raum im Gemeindehaus (wohl eine
Seltenheit), das jüdische Gemeindewaschhaus, ausgeräumt, frisch ausgeweißt,
die Bodensteine gerötelt, dann die Mazzenmaschine, die damals noch mit
Handbetrieb eingerichtet war, mit den nur zur Mazzotbereitung nötigen Geräten
aufgestellt. Ein langer Tisch, auf den die Maschine den dünnen Teig
brachte, war mit Zink belegt. Alles half zusammen, damit der Teig
schnellstens in den Ofen kam und nicht zur Gärung kommen konnte. Der
Backofen, der ausschließlich nur zum Mazzenbacken diente, ward vorher
instand gesetzt. Dass wir Kinder bei diesen Vorbereitungen unsere
Neugierde zu befriedigen suchten, werdet Ihr begreifen. Jede Hausfrau nahm
von ihrem zu verbackenden Mehl eine kleine Handvoll und gab es in ein an
der Wand hängendes neues Leinensäckchen, und wenn das allgemeine Backen
vorüber war, ward aus diesem Mehl von den Frauen der Eruw
gemacht, sie verzierten ihn mit dem Mogen Dovid (Davidstern) und mit dem
Stupfeleisen, mit dem man auch die Mazzot
schäl Mizwa für die beiden Sedernächte als Kohen
Levi weIsrael bezeichnete (sc. drei Mazzen am Sedertisch repräsentieren
Priester, Leviten und Israel), wurden ringsherum Rosen gestochen. Diesen
Eruw legte man am Erew Pessach
(Vortag zum Pessachfest; am Tag des Sederabends) auf den Almemor und nach Mincha wurde Eruwei Chazerot
damit gemacht. Von den großen Freuden, die wir empfanden, wenn wir dem Bäcker,
auf rein gewaschenen Händen den ausgestochenen, gestupfelten, dünnen
Mazzotteig hinreichen durften, könnte Ihr heutigen Kinder Euch keinen
Begriff mehr machen, nachdem das Herstellen der Mazzot jetzt fabrikmäßig
geschieht und die Kinder deshalb nicht mehr mithelfen können.
Acht Tage vor Pessach fuhren wir Knaben mit einem Handwägelchen vor jedes
jüdische Haus und riefen ‚Chomezholz!’ (d.i. das Holz für das
Chomezfeuer) und das gespendete Holz brachten wir einstweilen in einem
Schopf unter. Am Vorabend des Erew Pessach halfen wir getreulich und
voller Freuden Chomezbateln, hielten die Kerze, eine große Feder aus
einem Gänseflügel und einem Löffel, in welchem das kleine Chomez (d.i.
der letzte Rest Gesäuertes, das vor Pessach verbrannt wird) mit der Feder
eingestrichen wurde; außerdem kam noch der vom vergangenen Jahr
aufbewahrte Afikaumen (= Afikomen, Rest einer der Mazzen des Sedertisches),
ein Stück Brot oder Berches und die gebrauchte Hafdolo-Kerze hinzu. Alles
zusammen wurde in einen Lappen, in Papier oder auch in ein Schächtelchen
eingebunden und bis zum Verbrennen an einen sicheren Ort gelegt, dass
nicht Mäuse etwas davon verschleppen konnten. Ein besonderer Reiz war es,
wenn wir an Erev Pesach schon sehr früh erwachten und die frischen
Gardinen sahen, welche die Mutter noch in der Nacht aufgesteckt hatte; die
ganze Wohnung atmete schon echte Jom-tow-Stimmung (Feiertagsstimmung).
Erev Pesach morgens ging man schon früher als sonst in die Synagoge,
nachher versammelten wir uns wieder, fuhren das aufbewahrte Holz in den
Schulhof, dort bauten wir einen Holzstoß auf und legten das aus jedem
Haus gebrachte Chomez darauf. Um halb 10 Uhr zündeten wir den Holzstoß
an, das gab ein hell-loderndes Feuer. Um 10 Uhr kamen die Männer um …
zu sagen. Wir bildeten uns auf unsere Geschäftigkeit nicht wenig ein,
freuten uns aber auch herzlich, wenn die Männer uns lobten, dass wir ein
so schönes Feuer zusammengebracht hätten. Die Asche kehrten wir fein säuberlich
zusammen und trugen sie in einem Blechgefäß in den Bach. Auf Pessach
bekamen wir neue Kleider, Schule und Mützen, die wir schon Erev Pesach
nachmittags anziehen durften und die wir gegenseitig mit Stolz
betrachteten. Wenn diese Schau vorüber war, gingen wir spazieren, suchten
Veilchen und wenn wir welche fanden, banden wir sie zu Sträußchen für
den Sedertisch". |
Auftritt
von Julius Streicher in Ansbach (1934)
Anmerkung: der Text wird an dieser Stelle nur kurz kommentiert: zu bedenken
ist, dass die jüdischen Periodika seit 1933 keine kritischen Meldungen mehr
über die nationalsozialistische Politik veröffentlichen durften. Daher wurden
solche Mitteilungen gewöhnlich in einer Weise geschrieben, dass der Leser
"zwischen den Zeilen" Botschaften vernehmen konnte; hier u.U. noch die
Hoffnung, dass die Nationalsozialisten tatsächlich
"Gesetzlosigkeiten" gegen Juden bekämpfen würden, andererseits die
Lüge Streichers, er hätte ein Pogrom in Franken bis dahin geradezu
verhindert.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1934: "Aus
einer Ansprache Julius Streichers. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1934: "Aus
einer Ansprache Julius Streichers.
Ansbach, 6. Mai (1934). Am Samstag Mittag fand in Ansbach die
feierliche Übernahme der Leitung der Regierung von Mittel- und
Oberfranken durch den Gauleiter Julius Streicher statt. In seiner
Ansprache an die Beamtenschaft erklärte Streicher, nach einem Berichte
des DNB. (auch in der 'Frankfurter Zeitung' vom 7. Mai) zur Judenfrage,
dass dieses Problem nicht gelöst werden könne dadurch, dass man
Gesetzlosigkeiten begehe. Er warne jeden, etwas zu unternehmen, was er
nciht billigen könne. Wenn man draußen in der Welt sage, es hätten
Pogrome in Franken stattgefunden, so erkläre er feierlich: 'Wenn ich
nicht gewesen wäre, dann wäre vielleicht ein Pogrom über Franken
gegangen. Ich habe niemals einen Befehl gegeben, der nicht zu verantworten
wäre, obwohl die, die mich anklagen, es nicht verdient hätten, dass man
sie, nachdem sie 14 Jahre lang das Volk gegen uns gehetzt haben, einem
Schutz unterstellt. Aber ich kläre mein Volk auf und lasse das mir nicht
verwehren.'" |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und
Privatpersonen
Anzeige
von Leon Joel (1936)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1936: "Ia
Woll-Tallessim (Gebetsschäle), verbesserte Qualität. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1936: "Ia
Woll-Tallessim (Gebetsschäle), verbesserte Qualität.
100 x 140 cm Mark 7,25 130 x 170 cm Mark
11.-
140 x 180 cm Mark 12,-. 150 x 190 cm Mark 13.50.
fertig Mark 2.- mehr.
Porto und Verpackung 50 Pfennig. Wiederverkäufer Rabatt. Leon
Joel, Ansbach / Mittelfranken." |
Mechanische Nähseiden-Fabrik Eduard Kupfer - Ansbach
(1937 !)
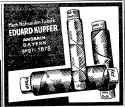 Anzeige
in der "CV-Zeitung" vom 1. April 1937. Anzeige
in der "CV-Zeitung" vom 1. April 1937. |
Weitere Dokumente
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries; Anmerkungen
gleichfalls von Peter Karl Müller)
Erinnerungsarbeit -
einzelne Presseartikel
Über
die Geschichte der Familie Theobald und Lilly Hirschkind aus Ansbach (Artikel
von 2009)
Artikel von Kathrin Handschuh im "Wiesbadener Tagblatt" vom 7.
August 2009: Unter die Haut - ERINNERUNGSBLÄTTER Die Schicksale der jüdischen Familien Hirschkind und Rottenberg.
Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen: Die Schicksale jüdischer Familien aus
Wiesbaden, die im monatlichen Wechsel an den Erinnerungsstelen am ehemaligen Standort der Synagoge am Michelsberg vom "Verein Aktives Museum" präsentiert werden. Dort sind noch bis Ende des Monats die Lebenswege der Familien Hirschkind und Rottenberg nachzulesen.
Das Ehepaar Theobald und Lilly Hirschkind war im Juli 1934 in die Wilhelminenstraße gezogen - um den judenfeindlichen Strömungen in ihrer Heimat im schwäbischen
Ansbach zu entgehen. "Warum sie sich ausgerechnet für Wiesbaden entschieden, ist unklar", sagt Georg Schneider, zuständig für den Bereich Geschichte. Doch die Ruhe währte nur kurz: Auch hier begann spätestens mit der Reichspogromnacht 1938 die Verfolgung. Gemeinsam musste das Paar, das in Ansbach eine Nähseidenfabrik betrieben hatte, rund 150 000 Reichsmark Judenvermögensabgabe zahlen.
Im Dezember 1938 stieß auch Lillys Schwester Dora hinzu. Auch sie wurde von den Nazis zur Kasse gebeten und musste
100.000 Reichsmark zahlen. Doras Tochter Beate Lutz emigrierte in die USA. Dora Hirschkind wurde am 10. Juni 1942 in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort getötet. Ihr gesamtes Vermögen fiel an das Deutsche Reich. Auch Theobald und Lilly Hirschkinds Leben endete im Vernichtungslager: Theobald starb am 3. März 1943. Seine Frau wurde nach Auschwitz verschleppt und dort am 15. Mai 1944 im Gas ermordet.
Patin der Familie ist übrigens die Wiesbadenerin Sabine Siegmund - sie ist heute Eigentümerin des Hauses an der Wilhelminenstraße. "Ich bin froh und dankbar, dass wir helfen können, das Schicksal der Familie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen", sagt sie.
der weitere Abschnitt geht auf die Wiesbadener Familie Rottenberg ein. |
Anmerkung nach dem "Gedenkbuch
des Bundesarchives":
Theobald Hirschkind (geb. 1874 in Baiersdorf, zuletzt wohnhaft in
Wiesbaden, deportiert von Frankfurt am 1. September 1942 in das Ghetto
Theresienstadt, wo er am 3. März 1943 umgekommen ist.
Lilli Hirschkind geb. Kupfer (geb. 1882 in Burgkunstadt, zuletzt
wohnhaft in Wiesbaden; deportiert von Frankfurt am 1. September 1942 in
das Ghetto Theresienstadt, am 15. Mai 1944 nach
Auschwitz. |
|