|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"
Zürich (Kanton
Zürich, Schweiz)
Jüdische Geschichte in Zürich -
Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)
und ihre Synagoge in der Löwenstraße
Hinweis:
die Website der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich finden Sie unter www.icz.org
Links zu Seiten mit
Texten aus der Geschichte der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich von
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert bis in die 1930er-Jahre:
- Seite "Allgemeine Berichte und
Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben"
- Seite "Aus der Geschichte
der Rabbiner und Lehrer der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich"
- Seite "Texte zu Personen aus der
jüdischen Gemeinde"
Weitere Seiten zur jüdischen Geschichte in Zürich:
- Seite zur Israelitischen Religionsgesellschaft
in Zürich (IRGZ) und ihre Synagoge in der Freigutstraße
- Seite zur jüdischen Gemeinde Agudas
Achim
- Seite zu den jüdischen Friedhöfen
in Zürich (Überblick in der Seite zu den jüdischen Friedhöfen der
Schweiz)
Übersicht:
Zur Geschichte der Synagogen in Zürich
Bereits im Mittelalter hatte die damalige
jüdische Gemeinde der Stadt eine Synagoge. Sie befand sich im Bereich des
mittelalterlichen Wohngebietes (überwiegend in den beiden damaligen
Brunnengassen; eine davon ist die heutige Froschaugasse, die auch Judengasse
genannt wurde). Bei der Synagoge handelte es sich um das heutige Gebäude
Froschaugasse 4 (erste Nennung als "Judenschuol" 1363), von dem noch
Teile auf das Mittelalter (bis zum 13. Jahrhundert) zurückgehen. Der
spätmittelalterliche Synagogenraum befand sich im Erdgeschoss des hinteren
Bauteiles. Hier ging durch zahlreiche Umbauten in den folgenden Jahrhunderten
allerdings viel von der mittelalterlichen Bausubstanz verloren. So wurden die Ostfassade
neu errichtet, der Boden tiefer gelegt; Türen und Fenster erhielten im 20.
Jahrhundert ihre jetzige Gestalt. Nur ein kleiner Rest des
spätmittelalterlichen Raumschmuckes (Wandmalereifragmente aus dem 14.
Jahrhundert in Form von Blattranken in roter und schwarzer Farbe) blieb
erhalten. Archäologische Untersuchungen konnten in dem Gebäude beim letzten
Umbau des Hauses im Jahr 2002 durchgeführt werden.
Im mittelalterlichen Gebäude Froschaugasse 4 war die Synagoge bereits
vor der Verfolgung in der Pestzeit untergebracht, vermutlich schon Ende des 13.
Jahrhunderts. Nach der Judenverfolgung 1349 stand das Gebäude einige Zeit leer
(1357 bis 1368 nachgewiesen), danach wohnten christliche Familien im Haus (1370
bis 1376 nachgewiesen). Kurz vor 1380 lebten wieder Juden im Gebäude; die
Synagoge wurde erneut zu Gottesdiensten verwendet. 1435/36 wurden die Juden aus
der Stadt ausgewiesen. Danach stand das Gebäude wiederum zunächst leer,
spätestens seit 1455 war es erneut von Christen bewohnt.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die ersten jüdischen
Personen (u.a. aus den Endingen und Lengnau) wieder in Zürich zuziehen. 1850
lebten im Kanton Zürich 80 jüdische Personen, 1862 175, davon 100 im
Stadtbezirk Zürich. Nach Aufhebung aller rechtlichen Beschränkungen für die
Juden im Kanton konnte am 29. März 1862 der "Israelitische
Kultusverein" gegründet werden. 1880 wurde der Name dieses Vereins in
"Israelitische Cultusgemeinde" umgewandelt.
Eine erster Betsaal konnte im Herbst 1864 in einem "ausgezeichnet
schönen Lokal" im Bereich des mittelalterlichen jüdischen Wohngebietes im
Niederdorf an der Brunngasse eingerichtet werden; für den Raum waren 320 Fr.
jährlich an Miete zu bezahlen. Zur Einrichtung des Betsaales erhielt die
Gemeinde von der Stadt einen Kredit in Höhe von 3.000 Fr., der binnen 5 Jahren
zurückzuzahlen war.
Auf Grund der schnell steigenden Zahl der jüdischen Gemeindeglieder reichte der
Raum bald nicht mehr aus: 1867 konnte ein neuer Betsaal im alten
Kornhaus eingerichtet werden. Der Raum wurde von der Stadt gegen eine Miete von
jährlich 1.000 Fr. überlassen (Anmerkung: das 1897 abgebrochene alte Kornhaus
stand an der Münsterbrücke beim Fraumünster, wo jetzt die Statue von
Bürgermeister Hans Waldmann steht). In diesem Betsaal konnte man bereits eine
Frauenempore einrichten. Es gab 24 Plätze für die Männer und 8
Frauenplätze.
Am 26. Februar 1879 beschloss die Gemeinde den Bau einer Synagoge,
nachdem der Betsaal im alten Kornhaus gekündigt worden war. Bis zur
Verwirklichung vergingen jedoch noch weitere fünf Jahre.
Im August 1880 richtete die Gemeinde den inzwischen dritten Betsaal
seit 1864 im alten Theaterfoyer ein, danach bezog man vorübergehend noch einen Betsaal
im Gebäude Brunngasse 15.
Der 1879 beschlossene Bau einer Synagoge konnte 1883/84 auf einem
Grundstück an der Löwenstraße verwirklicht werden. Die Grundsteinlegung
war am 6. Juli 1883, die Einweihung bereits am 16./17. September 1884 durch
Rabbiner Dr. Hermann Engelbert aus St. Gallen. Ausgeführt worden sind die
Pläne der Architekten Chiodera und Tschudy, die eine Synagoge in maurischen
Stil entworfen hatten. Ein bereits zum Tag der Einweihung angeschafftes
Harmonium sorgte von vornherein zum Streit mit den orthodoxen Mitgliedern der
Gemeinde.
Wenige Jahre nach der Einweihung musste die Synagoge aus Platzgründen umgebaut
werden. So wurden 1890 weitere Plätze auf der Frauenempore eingerichtet.
1897 konnten die orthodoxen Gemeindeglieder einen Betsaal in dem neben der
Synagoge erstellten Schulhaus der Gemeinde einrichten. Über die weitere
Geschichte der Beträume und der Synagoge der orthodoxen Religionsgesellschaft
siehe Seite zur Synagoge Freigutstraße (interner
Link).
Seit 1899 wurde der Bau einer neuen, größeren Synagoge geplant. 1907
standen in einer Gemeindeversammlung zur Wahl: eine neue Synagoge für die ganze
Gemeinde mit 800 bis 1.000 Plätzen, die die Synagoge in der Löwenstraße
ersetzen sollte oder eine zweite Synagoge zusätzlich zur Synagoge in der
Löwenstraße. Mit dem Bau der Synagoge in der Freigutstraße durch die seit
1898 bestehende orthodoxe Israelitische Religionsgesellschaft wurde der zweite
Weg bestritten. Dennoch gab es auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder
Planungen zum Bau einer neuen Synagoge der Israelitischen Cultusgemeinde,
die jedoch allesamt nicht verwirklicht wurden.
An der Synagoge in der Löwenstraße hielt die Gemeinde bis zur Gegenwart fest:
1936, 1952 und zuletzt 1993 wurde die Synagoge renoviert, 1993 durch die
Architekten Bernard San, Michael Berlowitz und Ron
Epstein.
Texte zur Geschichte der Synagogen
Anmerkung: die nachstehenden Texte fanden sich in jüdischen Periodika des
19./20. Jahrhunderts. Texte zu den orthodoxen Bethäusern bzw. der Synagoge
Freigutstraße finden sich auf der dortigen Seite (wird noch erstellt).
Überblick über die Geschichte der Israelitischen
Kultusgemeinde Zürich und ihre Einrichtungen (1913)
 Artikel
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Mai 1913:
"Bunte Chronik. Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich. Artikel
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Mai 1913:
"Bunte Chronik. Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich.
Dem Geschäftsbericht der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich über das
Jahr 1912 entnehmen wir folgendes: am 3. März 1862 wurden alle
Beschränkungen für die Juden im Kanton Zürich aufgehoben. Kurz darauf,
am 29. März 1862 konstituierte sich in Zürich der Israelitische
Kultusverein mit 12 Mitgliedern, von denen noch zwei am Leben sind, die
Herren Brundschwig-Nachmühl und Leopold Weil. Im Jahre 1880 wurde der
Name des Vereins in den noch heute geführten 'Israelitische
Kultusgemeinde' umgewandelt.
Das erste Betlokal befand sich im Niederdorf (Mietzins Fr. 320).
Von dort siedelte man 1867 in das alte Kornhaus in der Nähe des alten
Tonhalteareals über (von der Stadt Zürich für 1.000 Fr.) jährlich
gemietet), von da in das alte Theaterfoyer und von dort in die Brunngasse
Nr. 15. Am 26. Februar 1879 wurde der Bau einer Synagoge
beschlossen, am 16. September wurde die neue Synagoge in der Löwenstraße
eingeweiht.
Der erste Rabbiner der Gemeinde, 1869-1872 war Dr. Levin, jetzt
Prediger der Reformgemeinde in Berlin. Nach einem längeren Provisorium
wurde, 1877-1881, Dr. Kisch, jetzt Garnisonsprediger in Prag, angestellt.
Sein Nachfolger wurde als Prediger und Rektor der Religionsschule bis 1892
Dr. Landau (Jetzt Bezirksrabbiner in Weilburg); seit 1893 fungiert
Rabbiner Dr. Littmann. Kantor wurde 1867 Herr Alfred Lang seligen
Andenkens; ihm folgte Herr Tominberg, und seit 1896 wirkt als
Religionslehrer Dr. David Strauß.
Die Schule umschloss 1894 130 Schüler, im Jahre 1912 230. Seit
1898 besitzt die Gemeinde ein eigenes Schulhaus.
Die Armenpflege ist seit 1901 geregelt, sie hat in den letzten 10
Jahren ca. 125.000 Fr. an Unterstützungen ausgegeben.
Der Friedhof ist 1865 angelegt worden; Verhandlungen mit der Stadt
betreffend Beteiligung am allgemeinen städtischen Friedhof wurden im
Jahre 1877 von der Generalversammlung endgültig abgelehnt: 1892 wurde die
Abdankungshalle errichtet.
Die Gemeinde hatte 1870 37 Mitglieder, 1880 80, 1884 198, 1900 305, 1912
ca. 500; das Budget betrug 1862 Fr. 30.000, 1912 Fr. 70.000.
Im Jahre 1895 kam es zu religiösen Wirren in der Gemeinde; es
wurde zur Herstellung des Friedens für die orthodoxen Mitglieder ein
ihren Wünschen entsprechender Gottesdienst im Betsaal errichtet.
Interessant ist, dass im August 1877 der Versuch gemacht wurde, die
Gemeinde unter Aufsicht des Staates zu stellen; das Gesuch wurde
abgelehnt, da sonst auch andere Sekten sich um einen Staatsbeitrag
bewerben könnten." |
Die jüdische Cultusgemeinde hat eine erste Synagoge (1864/65)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1864: "Zürich
(Privatmitteilung). Die hiesige Gemeinde, die sich vor ungefähr 2 Jahren
konstituierte, und damals nur 12 Familien zählte, hat sich mit Gottes
Hilfe in diesem kurzen Zeitraume sehr ansehnlich vermehrt, so dass sie
jetzt mehr als doppelt so stark ist. Aber immer noch fehlte ihr ein
passendes Lokal zur Synagoge, bis sich nun der höchst liberale Stadtrat
dazu entschloss, der Gemeinde ein ausgezeichnet schönes Lokal
unentgeltlich zur Synagoge zu überlassen. Da die Gemeinde nicht über so
viel Mittel verfügen konnte, um das neue Gotteshaus passend einzurichten
und in Stand zu setzen, schossen diese edlen Väter der Stadt sogar noch
3.000 Fr. - so hoch sind die Kosten veranschlagt - der Gemeinde vor,
welches Darlehen von derselben in Raten innerhalb fünf Jahre
zurückgezahlt werden soll. - Es besteht hier auch seit einiger Zeit eine
Restauration des Herrn, in der Fremde ganz koscher speisen zu können. -
Höchst unerfreulich ist der Umstand, dass hier von einer gewissen Partei
vielfach gegen den Handelsvertrag mit Frankreich agitiert wurde, weil in
demselben durch die Weigerung Frankreichs, andernfalls den Vertrag
abzuschließen, die Emanzipation der Juden in der Schweiz ausgesprochen
wurde, umso mehr ist das hochherzige Verfahren des Züricher Stadtrats
anzuerkennen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1864: "Zürich
(Privatmitteilung). Die hiesige Gemeinde, die sich vor ungefähr 2 Jahren
konstituierte, und damals nur 12 Familien zählte, hat sich mit Gottes
Hilfe in diesem kurzen Zeitraume sehr ansehnlich vermehrt, so dass sie
jetzt mehr als doppelt so stark ist. Aber immer noch fehlte ihr ein
passendes Lokal zur Synagoge, bis sich nun der höchst liberale Stadtrat
dazu entschloss, der Gemeinde ein ausgezeichnet schönes Lokal
unentgeltlich zur Synagoge zu überlassen. Da die Gemeinde nicht über so
viel Mittel verfügen konnte, um das neue Gotteshaus passend einzurichten
und in Stand zu setzen, schossen diese edlen Väter der Stadt sogar noch
3.000 Fr. - so hoch sind die Kosten veranschlagt - der Gemeinde vor,
welches Darlehen von derselben in Raten innerhalb fünf Jahre
zurückgezahlt werden soll. - Es besteht hier auch seit einiger Zeit eine
Restauration des Herrn, in der Fremde ganz koscher speisen zu können. -
Höchst unerfreulich ist der Umstand, dass hier von einer gewissen Partei
vielfach gegen den Handelsvertrag mit Frankreich agitiert wurde, weil in
demselben durch die Weigerung Frankreichs, andernfalls den Vertrag
abzuschließen, die Emanzipation der Juden in der Schweiz ausgesprochen
wurde, umso mehr ist das hochherzige Verfahren des Züricher Stadtrats
anzuerkennen." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1865:
"Zürich, den 5. Juli (1865) (Privatmitteilung). Die hiesige
Kultusgemeinde, welche jetzt gegen 30 Mitglieder zählt und seit
vergangenem Herbst ein ihr von dem Stadtrat in sehr freundlicher Weise
überlassenes Lokal als Synagoge benutzt, hat nun auch einen Acker zur
Anlegung eines Friedhofes angekauft. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1865:
"Zürich, den 5. Juli (1865) (Privatmitteilung). Die hiesige
Kultusgemeinde, welche jetzt gegen 30 Mitglieder zählt und seit
vergangenem Herbst ein ihr von dem Stadtrat in sehr freundlicher Weise
überlassenes Lokal als Synagoge benutzt, hat nun auch einen Acker zur
Anlegung eines Friedhofes angekauft.
Der greise, noch immer geistesfrische Steinheim wohnt seit einigen Wochen
in hiesiger Stadt." |
Grundsteinlegung zur neuen Synagoge (Juli 1883)
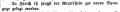 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Juli 1883:
"In Zürich ist jüngst der Grundstein zur neuen Synagoge gelegt
worden." Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Juli 1883:
"In Zürich ist jüngst der Grundstein zur neuen Synagoge gelegt
worden." |
Ankündigung der Einweihung der Synagoge (September
1884)
Anmerkung: diese Ankündigung erschien in der konservativ-orthodoxen
Zeitschrift "Der Israelit" und wurde mit einem Aufruf verbunden, die
Orthodoxen der Gemeinde mögen sich gegen die Aufstellung eines Harmoniums zur
Wehr setzen.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September 1884: "Zürich,
10. September (1884). Die hiesige neue Synagoge wird am Dienstag, den 16.
dieses Monats eingeweiht. Die Synagoge ist für 200 Herren- und 170
Frauensitzplätze eingerichtet, enthält überdies ein Lokal für die
Religionsschule, die gegenwärtig von 80 Kindern besucht wird. Der Bau
samt Platz kostet über 200.000 Franken. Zur Einweihungsfeier sind auch
der Regierungsrat, Stadtrat und die Geistlichen der Stadt geladen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September 1884: "Zürich,
10. September (1884). Die hiesige neue Synagoge wird am Dienstag, den 16.
dieses Monats eingeweiht. Die Synagoge ist für 200 Herren- und 170
Frauensitzplätze eingerichtet, enthält überdies ein Lokal für die
Religionsschule, die gegenwärtig von 80 Kindern besucht wird. Der Bau
samt Platz kostet über 200.000 Franken. Zur Einweihungsfeier sind auch
der Regierungsrat, Stadtrat und die Geistlichen der Stadt geladen.
Diese Mitteilung hätte an und für sich nichts Besonderes, wenn nicht
noch eine Sache im 'Hintergrunde' wäre, welche für die Frommen, oder
besser gesagt, für die nur etwas religiös gesinnten Mitglieder der
hiesigen Gemeinde eine Prinzipienfrage betrifft.
Der Vorstand hat, ohne die Genehmigung der Gemeinde einzuholen, die
Absicht, am Tage der Einweihung eine Orgel en miniature - Harmonium - in
der Synagoge aufzustellen und würde es ja durch die Einführung
derselben, dem gesetzestreuen Glaubensgenossen unmöglich gemacht, seine
Andacht in einer mit einem Harmonium versehenen Synagoge zu
verrichten.
Es sind in der Gemeinde Zürich noch eine Anzahl Mitglieder, welche auf
gesetzestreuem Boden stehen und ergeht der Mahnruf an dieselben: 'Seid auf
der Hut und lasst Euch nicht ein religionsgesetzlich verbotenes Instrument
in Eurer Synagoge aufstellen, protestieret mit allen Euch zu Gebote
stehenden Mitteln gegen die projektierte Aufstellung eines Harmoniums,
noch ist von der Gemeinde kein Beschluss gefasst und der Friede in Eurer
Gemeinde, der während der Bauzeit geherrscht, wird auch weiter
fortbestehen, wenn von solchen Neuerungen, welche nur von einigen
Mitgliedern, die alle Jahre 2-3 Mal die Synagoge besuchen, einzuführen
gesucht werden, abgesehen wird." |
Die Einweihung der Synagoge (September 1884)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Oktober 1884:
"Man schreibt uns aus Zürich vom 19. September. Am 17. dieses Monats
fand die Einweihung der neuen Synagoge unter den üblichen recht erhebend
ausgeführten Festlichkeiten statt. Die Festpredigt hielt Rabbiner Dr.
Engelbert aus St. Gallen. Er sprach über die Geschicke der jüdischen
Gemeinde in Zürich, ihre kleinen Anfänge und ihr allmähliches Wachstum,
ihre religiöse Treue und Opferwilligkeit, die es ihr endlich ermöglicht
hat, das Gotteshaus zu bauen, sich selber zum Heil und Segen; er
erörterte die Bedeutung des Tempels, der in der hebräischen
Überlieferung stets als ein Bethaus, als ein Lehrhaus und als ein
Versammlungshaus gegolten hat. Am Schlusse gab der Redner dem Gedanken
Ausdruck, es werde einst eine Zeit kommen, wo alle Menschen durch Glaube
und Liebe zu einem Bunde der Menschlichkeit sich vereinen, wo das Reich
der Wahrheit, des Lichtes und Friedens sich verwirklichen wird. Das
israelitische Gotteshaus ist bestimmt, zu diesem Endziele das Seinige
beizutragen. Die Synagoge hat sich auch in akustischer Beziehung
vorzüglich bewährt und die durch den maurischen Stil gebotenen
phantasievollen Dekorationen haben, dank der gedämpften Beleuchtung,
weniger aufregend und zerstreuend gewirkt, als es der Reichtum farbigen
Schmuckes an sich erwarten ließ. Am Abend fand ein heiteres Festmahl
statt, an welchem etwa 270 Personen teilnahmen. Unter den Toasten war der
des Pfarrers Dr. Furrer, des bekannten Kenners jüdischen Landes und
Lebens bemerklich. Sein Hoch galt den Geist des mutigen Glaubens, Hoffens
und Liebens, der die Synagoge gebaut hat. Vor 500 Jahren gab es in Zürich
drei Synagoge, Pest und Fanatismus haben damals die Israeliten vertrieben;
heute leben wir in einer helleren Zeit, wo jede religiöse Überzeugung
geachtet wird, weil sie in ein Geheimnis des Unendlichen mündet. Die
Menschheit verdankte Israel die Psalmen, den Dekalog, das Beispiel eines
mutigen Idealismus, der in allen Anfechtungen standhaft bleibt. Dem
Bankett folgte ein Ball." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Oktober 1884:
"Man schreibt uns aus Zürich vom 19. September. Am 17. dieses Monats
fand die Einweihung der neuen Synagoge unter den üblichen recht erhebend
ausgeführten Festlichkeiten statt. Die Festpredigt hielt Rabbiner Dr.
Engelbert aus St. Gallen. Er sprach über die Geschicke der jüdischen
Gemeinde in Zürich, ihre kleinen Anfänge und ihr allmähliches Wachstum,
ihre religiöse Treue und Opferwilligkeit, die es ihr endlich ermöglicht
hat, das Gotteshaus zu bauen, sich selber zum Heil und Segen; er
erörterte die Bedeutung des Tempels, der in der hebräischen
Überlieferung stets als ein Bethaus, als ein Lehrhaus und als ein
Versammlungshaus gegolten hat. Am Schlusse gab der Redner dem Gedanken
Ausdruck, es werde einst eine Zeit kommen, wo alle Menschen durch Glaube
und Liebe zu einem Bunde der Menschlichkeit sich vereinen, wo das Reich
der Wahrheit, des Lichtes und Friedens sich verwirklichen wird. Das
israelitische Gotteshaus ist bestimmt, zu diesem Endziele das Seinige
beizutragen. Die Synagoge hat sich auch in akustischer Beziehung
vorzüglich bewährt und die durch den maurischen Stil gebotenen
phantasievollen Dekorationen haben, dank der gedämpften Beleuchtung,
weniger aufregend und zerstreuend gewirkt, als es der Reichtum farbigen
Schmuckes an sich erwarten ließ. Am Abend fand ein heiteres Festmahl
statt, an welchem etwa 270 Personen teilnahmen. Unter den Toasten war der
des Pfarrers Dr. Furrer, des bekannten Kenners jüdischen Landes und
Lebens bemerklich. Sein Hoch galt den Geist des mutigen Glaubens, Hoffens
und Liebens, der die Synagoge gebaut hat. Vor 500 Jahren gab es in Zürich
drei Synagoge, Pest und Fanatismus haben damals die Israeliten vertrieben;
heute leben wir in einer helleren Zeit, wo jede religiöse Überzeugung
geachtet wird, weil sie in ein Geheimnis des Unendlichen mündet. Die
Menschheit verdankte Israel die Psalmen, den Dekalog, das Beispiel eines
mutigen Idealismus, der in allen Anfechtungen standhaft bleibt. Dem
Bankett folgte ein Ball." |
Über Harmonium und Damengesang in der Synagoge - orthodoxe Kritik (1884)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1884: "Zürich,
November (1884). Bezugnehmend auf eine Korrespondenz Ihres geschätzten
Blattes in Betreff der projektierten Aufstellung eines Harmoniums in der
hiesigen neuerbauten Synagoge muss ich Ihnen leider heute mitteilen, dass
nicht nur bis heute dasselbe nicht aus der Synagoge entfernt wurde,
sondern der Gottesdienst findet sogar mit Damengesang statt. Unter solchen
Verhältnissen dürfen doch die hiesigen religiösen Mitglieder der
Gemeinde nicht schweigen und sind vor Gott und ihrem Gewissen
verpflichtet, gegen diese gesetzwidrige Neuerung Protest einzulegen, sowie
dieselben laute Entscheid der größten rabbinischen Autoriten, - solange
diese Neuerung in der Synagoge stattfindet, - weder an dem öffentlichen
Gottesdienst teilnehmen, noch überhaupt die Synagoge betreten dürfen.
Aus diesem Grund geht der wiederholte Ruf an die religiös gesinnten
Mitglieder hiesiger Gemeinde! Vereinigt Euch zu gemeinsamem Vorgehen gegen
die ohne Genehmigung der Gemeinde, vom Vorstande allein eingeführte
Neuerung, da Euch vom Religionsgesetz aus nichts anderes übrig bleibt,
als aus der Gemeinde auszutreten oder die Entfernung dieses spezifisch
kirchlichen Instruments aus der Synagoge herbeizuführen. (In Erfurt hat
sich neuerdings in Folge der Einführung eines ähnlichen Instrumentes in
der Synagoge eine Separatgemeinde gebildet, deren gemietetes,
anspruchsloses Lokal während der hohen Feiertage zahlreicheren Besuchs zu
erfreuen hatte, als die neuerbaute, prachtvolle Synagoge. - Red.). Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1884: "Zürich,
November (1884). Bezugnehmend auf eine Korrespondenz Ihres geschätzten
Blattes in Betreff der projektierten Aufstellung eines Harmoniums in der
hiesigen neuerbauten Synagoge muss ich Ihnen leider heute mitteilen, dass
nicht nur bis heute dasselbe nicht aus der Synagoge entfernt wurde,
sondern der Gottesdienst findet sogar mit Damengesang statt. Unter solchen
Verhältnissen dürfen doch die hiesigen religiösen Mitglieder der
Gemeinde nicht schweigen und sind vor Gott und ihrem Gewissen
verpflichtet, gegen diese gesetzwidrige Neuerung Protest einzulegen, sowie
dieselben laute Entscheid der größten rabbinischen Autoriten, - solange
diese Neuerung in der Synagoge stattfindet, - weder an dem öffentlichen
Gottesdienst teilnehmen, noch überhaupt die Synagoge betreten dürfen.
Aus diesem Grund geht der wiederholte Ruf an die religiös gesinnten
Mitglieder hiesiger Gemeinde! Vereinigt Euch zu gemeinsamem Vorgehen gegen
die ohne Genehmigung der Gemeinde, vom Vorstande allein eingeführte
Neuerung, da Euch vom Religionsgesetz aus nichts anderes übrig bleibt,
als aus der Gemeinde auszutreten oder die Entfernung dieses spezifisch
kirchlichen Instruments aus der Synagoge herbeizuführen. (In Erfurt hat
sich neuerdings in Folge der Einführung eines ähnlichen Instrumentes in
der Synagoge eine Separatgemeinde gebildet, deren gemietetes,
anspruchsloses Lokal während der hohen Feiertage zahlreicheren Besuchs zu
erfreuen hatte, als die neuerbaute, prachtvolle Synagoge. - Red.). |
Spende einer Torarolle für die Gemeinde (1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familieblatt" vom 15. September
1905: "Zürich. Herr Salomo Guggenheimer-Wyler hat anlässlich
der Barmizwohfeier seines Sohnes Silvain der Gemeinde eine neue Sefer Tora
mit prachtvollem Mäntelchen zum Geschenk gemacht. Es ist das in kurzer
Zeit die zweite Sefer Torah, die die Gemeinde zum Geschenk erhält, ein
schönes Zeichen dafür, dass der altjüdische Sinn bei uns noch nicht
erstorben ist." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familieblatt" vom 15. September
1905: "Zürich. Herr Salomo Guggenheimer-Wyler hat anlässlich
der Barmizwohfeier seines Sohnes Silvain der Gemeinde eine neue Sefer Tora
mit prachtvollem Mäntelchen zum Geschenk gemacht. Es ist das in kurzer
Zeit die zweite Sefer Torah, die die Gemeinde zum Geschenk erhält, ein
schönes Zeichen dafür, dass der altjüdische Sinn bei uns noch nicht
erstorben ist." |
Fragen eines Synagogenneubaus und des orthodoxen Betsaales (1907)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 13. September
1907: "Zürich. Die Generalversammlung der jüdischen Gemeinde, bei
der von ca. 411 Mitgliedern etwa 160 anwesend waren, beschäftigte sich
zuerst und hauptsächlich mit dem Synagogenbau. Die bisherige Synagoge mit
ihren 163 Männer- und 157 Frauenplätzen ist längst zu klein. Eine neue
Synagoge mit 800 bis 1000 Plätzen würde auf etwa 1 Million Francs Kosten
kommen, während eine zweite Synagoge mit einer viertel Million Francs
sich erbauen lässt. Die Lösung der finanziellen Frage macht
Schwierigkeiten, und die Versammlung beschließt deshalb, die
Baukommission auf 1 Mitglieder zu erhöhen und ihr die weitere Beratung
dieser Angelegenheit zu überlassen. Der Bericht des Präsidenten Dr.
Guggenheim über das Aufrufen zur Tora an den Wochentagen rief eine
lebhafte Debatte hervor. Der Bericht sagte folgendes: Die Gemeinde hat
seit ihrer Gründung in den 1860er-Jahren in überwiegender Majorität der
neueren Richtung angehört. Anfangs der 1880er-Jahre begann eine rührige
orthodoxe Minorität sich zu regen; 1887 verlangte sie die Inspektion der Schule
durch einen auswärtigen Rabbiner; 1893 verlangte sie einen
Separatgottesdienst; der damalige Vorstand wollte keinen Staat im Staate
und die Gemeinde änderte die Statuten dahin, dass, wer sich einer anderen
am Orte bestehenden Gemeinde anschließt, aus der Gemeinde ausgeschlossen
werden könne; die Minorität fochte diese Statutenänderung vor dem
Bezirksgericht an und ging, hier angewiesen, vor das Obergericht; im
letzten Moment wurde am 2. Mai 1896 der bekannte Vertrag abgeschlossen,
wonach die Gemeinde sich verpflichtete, für 25 Jahre, sofern 10
Mitglieder der Gemeinde das Verlangen stellen, in dem neu erbauten
Schulhaus einen Separatgottesdienst einzurichten, der den Bedürfnissen
dieser Minorität entspricht, also ohne Harmonium und gemischten Chor und
dergleichen. Die Gemeinde verfuhr vertragsgemäß, aber es ergaben sich
bald wieder Schwierigkeit, die dennoch zur Begründung einer eigenen
orthodoxen Gemeinde führten. Nur Wenige blieben in dem Betsaal. Auch mit
diesen gab es ab und zu Differenzen. In den letzten Jahren war Friede.
Aber neuerdings sind drei beschwerden von Gemeindemitgliedern eingegangen,
denen das Aufrufen zur Tora an Wochentagen bei ihrer Jahrzeit verweigert
wurde, weil sie keine Tefillin trugen. Der Vorstand hat die Beschwerde
für begründet gefunden, da darin eine Beleidigung liege; in Basel werden
Jahrzeiter auch ohne Tefillin aufgerufen, und der orthodoxe Rabbiner Dr.
Cohn sehe dem ruhig zu. Die hiesigen Orthodoxen weigern sich aber
hartnäckig nachzugeben und erklären die Gemeinde für vertraglich
verpflichtet, den Gottesdienst im Betsaal ganz nach ihren Bedürfnissen zu
belassen. - In der Diskussion wurde von fast allen Rednern anerkannt, dass
die Gemeinde den Betsaal in orthodoxer Richtung zu belassen habe,
andererseits aber auch betont, dass man für die Beschwerdeführer
ebenfalls Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 13. September
1907: "Zürich. Die Generalversammlung der jüdischen Gemeinde, bei
der von ca. 411 Mitgliedern etwa 160 anwesend waren, beschäftigte sich
zuerst und hauptsächlich mit dem Synagogenbau. Die bisherige Synagoge mit
ihren 163 Männer- und 157 Frauenplätzen ist längst zu klein. Eine neue
Synagoge mit 800 bis 1000 Plätzen würde auf etwa 1 Million Francs Kosten
kommen, während eine zweite Synagoge mit einer viertel Million Francs
sich erbauen lässt. Die Lösung der finanziellen Frage macht
Schwierigkeiten, und die Versammlung beschließt deshalb, die
Baukommission auf 1 Mitglieder zu erhöhen und ihr die weitere Beratung
dieser Angelegenheit zu überlassen. Der Bericht des Präsidenten Dr.
Guggenheim über das Aufrufen zur Tora an den Wochentagen rief eine
lebhafte Debatte hervor. Der Bericht sagte folgendes: Die Gemeinde hat
seit ihrer Gründung in den 1860er-Jahren in überwiegender Majorität der
neueren Richtung angehört. Anfangs der 1880er-Jahre begann eine rührige
orthodoxe Minorität sich zu regen; 1887 verlangte sie die Inspektion der Schule
durch einen auswärtigen Rabbiner; 1893 verlangte sie einen
Separatgottesdienst; der damalige Vorstand wollte keinen Staat im Staate
und die Gemeinde änderte die Statuten dahin, dass, wer sich einer anderen
am Orte bestehenden Gemeinde anschließt, aus der Gemeinde ausgeschlossen
werden könne; die Minorität fochte diese Statutenänderung vor dem
Bezirksgericht an und ging, hier angewiesen, vor das Obergericht; im
letzten Moment wurde am 2. Mai 1896 der bekannte Vertrag abgeschlossen,
wonach die Gemeinde sich verpflichtete, für 25 Jahre, sofern 10
Mitglieder der Gemeinde das Verlangen stellen, in dem neu erbauten
Schulhaus einen Separatgottesdienst einzurichten, der den Bedürfnissen
dieser Minorität entspricht, also ohne Harmonium und gemischten Chor und
dergleichen. Die Gemeinde verfuhr vertragsgemäß, aber es ergaben sich
bald wieder Schwierigkeit, die dennoch zur Begründung einer eigenen
orthodoxen Gemeinde führten. Nur Wenige blieben in dem Betsaal. Auch mit
diesen gab es ab und zu Differenzen. In den letzten Jahren war Friede.
Aber neuerdings sind drei beschwerden von Gemeindemitgliedern eingegangen,
denen das Aufrufen zur Tora an Wochentagen bei ihrer Jahrzeit verweigert
wurde, weil sie keine Tefillin trugen. Der Vorstand hat die Beschwerde
für begründet gefunden, da darin eine Beleidigung liege; in Basel werden
Jahrzeiter auch ohne Tefillin aufgerufen, und der orthodoxe Rabbiner Dr.
Cohn sehe dem ruhig zu. Die hiesigen Orthodoxen weigern sich aber
hartnäckig nachzugeben und erklären die Gemeinde für vertraglich
verpflichtet, den Gottesdienst im Betsaal ganz nach ihren Bedürfnissen zu
belassen. - In der Diskussion wurde von fast allen Rednern anerkannt, dass
die Gemeinde den Betsaal in orthodoxer Richtung zu belassen habe,
andererseits aber auch betont, dass man für die Beschwerdeführer
ebenfalls |
 die
Möglichkeit schaffen müsse zu ihrem Recht zu kommen. Auf Anfrage wird
erklärt, dass der Rabbiner den Standpunkt des Vorstandes teile. An
Antrag, an allen Tagen, an denen aus der Tora vorgelesen würde, auch in
der Synagoge deshalb Minjan zu machen, wurde zurückgezogen und
beschlossen, dass derjenige, welcher am Jahrzeitstage aus dem angeführten
Grund nicht in den Betsaal gehen wollte, davon rechtzeitig Mitteilung an
den Vorstand machen sollte, der dann für ihn Gottesdienst in der Synagoge
abhalten lassen werde." die
Möglichkeit schaffen müsse zu ihrem Recht zu kommen. Auf Anfrage wird
erklärt, dass der Rabbiner den Standpunkt des Vorstandes teile. An
Antrag, an allen Tagen, an denen aus der Tora vorgelesen würde, auch in
der Synagoge deshalb Minjan zu machen, wurde zurückgezogen und
beschlossen, dass derjenige, welcher am Jahrzeitstage aus dem angeführten
Grund nicht in den Betsaal gehen wollte, davon rechtzeitig Mitteilung an
den Vorstand machen sollte, der dann für ihn Gottesdienst in der Synagoge
abhalten lassen werde." |
Frage nach der Einführung einer Orgel in der Synagoge
(1928)
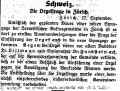 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. September 1928: "Die Orgelfrage in Zürich. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. September 1928: "Die Orgelfrage in Zürich.
Zürich, 17. September (1928). Anlässlich des geplanten Baues einer neuen
Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde in Zürich ist es dort zu
ernsten Auseinandersetzungen über die Frage der Einführung der Orgel
auch in die neue Synagoge gekommen. Gegen die Orgel treten vor allem
Rabbiner Dr. Littmann und Nationalrat Dr. Farbstein auf, der auf der
Generalversammlung der Gemeinde erklärte, dass er bei einem Beschluss der
Einführung einer Orgel gegen die Bewilligung der Baukredite stimmen
werde. Die Entscheidung über die Orgelfrage wurde einer demnächst
einzuberufenden außerordentlichen Generalversammlung
vorbehalten." |
Die Orgel in der Synagoge wird abgeschafft
(1937)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1937:
"Züricher Kultusgemeinde schafft die Orgel im Gottesdienst ab.
Zürich, 9. Mai (1937). Die Frage der Beibehaltung oder endgültige
Abschaffung der Orgel im Gottesdienst bildete den Gegenstand der
Beratungen in der letzten Generalversammlung der Israelitischen
Kultusgemeinde in Zürich. Der Antrag auf endgültige Abschaffung der
Orgel wurde mit 177 gegen 61 Stimmen angenommen. Für den Antrag stimmten
u.a. die beiden Rabbiner, die Zionisten und zahlreiche als liberal
bekannte Persönlichkeiten aller Richtungen und Gruppen der Gemeinde. In
der vorangegangenen Aussprache wurde zugunsten der Abschaffung
vorgebracht, dass die Orgel als sichtbares Symbol einer falsch
verstandenen Assimilationsepoche in unsere Zeit hineinrage. Sie sei von
der sogenannten Aufklärung eingeführt worden, die auch die Bezeichnung
Israelit an Stelle des Wortes Jude verbreitet habe. Die Orgel sei nur ein
Übergang zum Christentum und zur Abschüttelung des Judentums. Es
handelte sich hier um eine Frage der Rückkehr aus der Dekadenzperiode zu
den eigenen Werten des Judentums; die Entscheidung der Generalversammlung
sei eine historische. Die Anhänger der Beibehaltung der Orgel versuchten
an Hand der Literatur nachzuweisen, dass der Orgelfrage gar nicht eine so
hohe Bedeutung zukomme, wie man sie ihr hier beilege. Ein
Gewissenskonflikt sei unbegründet, da die Orgel religionsgesetzlich nicht
verboten sei." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1937:
"Züricher Kultusgemeinde schafft die Orgel im Gottesdienst ab.
Zürich, 9. Mai (1937). Die Frage der Beibehaltung oder endgültige
Abschaffung der Orgel im Gottesdienst bildete den Gegenstand der
Beratungen in der letzten Generalversammlung der Israelitischen
Kultusgemeinde in Zürich. Der Antrag auf endgültige Abschaffung der
Orgel wurde mit 177 gegen 61 Stimmen angenommen. Für den Antrag stimmten
u.a. die beiden Rabbiner, die Zionisten und zahlreiche als liberal
bekannte Persönlichkeiten aller Richtungen und Gruppen der Gemeinde. In
der vorangegangenen Aussprache wurde zugunsten der Abschaffung
vorgebracht, dass die Orgel als sichtbares Symbol einer falsch
verstandenen Assimilationsepoche in unsere Zeit hineinrage. Sie sei von
der sogenannten Aufklärung eingeführt worden, die auch die Bezeichnung
Israelit an Stelle des Wortes Jude verbreitet habe. Die Orgel sei nur ein
Übergang zum Christentum und zur Abschüttelung des Judentums. Es
handelte sich hier um eine Frage der Rückkehr aus der Dekadenzperiode zu
den eigenen Werten des Judentums; die Entscheidung der Generalversammlung
sei eine historische. Die Anhänger der Beibehaltung der Orgel versuchten
an Hand der Literatur nachzuweisen, dass der Orgelfrage gar nicht eine so
hohe Bedeutung zukomme, wie man sie ihr hier beilege. Ein
Gewissenskonflikt sei unbegründet, da die Orgel religionsgesetzlich nicht
verboten sei." |
Fotos
(Anmerkung: die neuen Fotos wurden erstellt im
Zusammenhang mit der Vorstellung des Buches von Ron Epstein-Mil über "Die
Synagogen in der Schweiz" am 3.6.2008; weitere Informationen zu diesem Buch
siehe Übersichtsseite zu den Synagogen der
Schweiz).
|
Historisches Foto
|
 |
| |
Historische Karte
mit der Synagoge an der Löwenstraße |
| |
|
|
| Neuere Fotos - Juni 2008 |
 |
 |
| |
Blick auf die
Synagoge an der Ecke Löwenstraße / Nüscheler Straße, rechts der
Synagoge
(auf linkem Foto erkennbar) steht das 1897 angebaute Schul- und
Gemeindehaus |
| |
|
 |
 |
 |
| Blick auf die
Fassade und den Haupteingang von der Löwenstraße mit der hebräischen
Portalinschrift aus Jesaja 56,7, übersetzt.: "Mein Haus soll ein
Bethaus für alle Völker genannt werden". |
In der Synagoge mit
Blick zum Toraschrein
|
| |
|
 |
 |
 |
| Der Synagogenchor
tritt auf |
|
| |
|
 |
 |
 |
Blick in den Betsaal (Frauen
im Bereich
der Männer nur zum Anlass
der Buchvorstellung) |
Blick auf die
Frauenempore |
Die Kuppel mit
indirekter
Beleuchtung |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Fenster |
Uhr mit hebräischen
Buchstaben,
die zugleich Zahlenwert haben |
Lampe mit Davidstern |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Blick zum Toraschrein |
Vorlesepult |
Ner tamid (ewiges Licht) |
| |
|
|
 |
 |
 |
Gebetbücher und
Gebetsschale |
Anzeiger für
Gottesdienstzeiten |
Moderner Chanukkaleuchter
im
Synagogenraum |
| |
|
|
 |
 |
|
| Traditioneller
Chanukkaleuchter im Vorraum |
|
| |
|
| |
|
|
Zwei Fotos von
Jürgen Hanke, Kronach |
 |
 |
| |
|
|
Einzelne Presseartikel
| 2012: Die
Israelitische Cultusgemeinde Zürich wird 150 Jahre alt |
Artikel in der "NZZ online" vom
29. März 2012: "'Man hat nicht nur eine Heimat' - Zürichs
Juden fühlen sich hier beheimatet - und denken oft an
Israel"
Interview mit Michel Bollag (Link zum
Artikel) |
| |
| Januar 2015:
75 Jahre
Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich - Publikation dazu
erschienen |
Artikel von Martina Läubli in der
"Neuen Züricher Zeitung" vom 10. Januar 2015: "Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich.
Jüdischer Bücherschatz.
In Zürich befindet sich eine jüdische Bibliothek, die im deutschsprachigen Raum einmalig ist. Mit einem Buch feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen und erzählt ihre bewegte Geschichte..."
Link
zum Artikel |
| |
|
Februar 2016:
Die Synagoge steht unter massivem
Sicherheitsschutz |
Artikel von Martin Sturzenegger im
"Tagesanzeiger" vom 1. Februar 2016: "Beten hinter Panzerglas in Zürich
Schussfeste Scheiben, Securitas und Überwachungskameras: Die jüdische
Gemeinde Zürich fordert staatliche Unterstützung für die steigenden
Sicherheitskosten. Ein Durchbruch zeichnet sich ab..."
Link zum Artikel |
| |
|
Juni 2016:
Über jüdisches Leben in Zürich
|
Artikel von Katrin Oller im "Zürcher
Unterländer" vom 8. Juni 2016: "Zürich. Eine fremde Welt im eigenen
Quartier. Wer sind die Juden in Zürich? Der Rundgang 'The Jewish Mile'
durch Wiedikon, die Enge und Wollishofen bringt Teilnehmern den jüdischen
Alltag in Zürich näher..."
Link zum Artikel |
| |
|
August 2017:
Rundgang mit Michel Bollag
durch das jüdische Zürich |
Artikel von Barbara Ludwig in kath.ch vom
30. August 2017: "Mit Michel Bollag durch das jüdische Zürich.
Zürich, 30.8.17 (kath.ch) Zu den erfolgreichsten Veranstaltungen des Zürcher
Instituts für interreligiösen Dialog (ZIID) gehört der Rundgang durch das
jüdische Zürich. Michel Bollag, Jude und Exponent im interreligiösen Dialog,
ist einer von zwei Führern auf der 'Jewish Mile', auf der die Teilnehmer zu
Synagogen, Lebensmittelgeschäften und Schulen mitgenommen werden. Einige
Stationen haben auch eine Bedeutung im Leben von Michel Bollag.
Seit zehn Jahren bietet das 'Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID)'
einen Rundgang durch das jüdische Zürich an. Heute läuft das Angebot unter
dem Titel 'The Jewish Mile. Jüdischer Alltag in Zürich'. Ist der Rundgang im
Programm des ZIID aufgeführt, wird er zusammen von Michel Bollag und Ralph
Weingarten durchgeführt. Wird er auf Anfrage durchgeführt, kann es
vorkommen, dass ihn Bollag alleine bestreitet. Laut dem ehemaligen
Fachleiter Judentum beim ZIID gehört 'The Jewish Mile' zu den
erfolgreichsten Veranstaltungen des Zentrums.
Orte des Gebets. Zu einzelnen Stationen hat Bollag einen persönlichen
Bezug, wie er kath.ch anvertraut. Zum einen gibt es da die Orte, die der
Jude selber zum Gebet aufsucht: Zum Beispiel die 1884 erbaute Synagoge der
Israelitischen Cultusgemeinde (ICZ) an der Löwenstrasse. Diese Synagoge
spielt zudem eine besondere Rolle im Curriculum von Bollag. Während 25
Jahren arbeitete er für die ICZ, 10 Jahre davon als Rabbinatsassistent. Der
in Genf aufgewachsene Bollag betet auch im Minjan Wollishofen, in dessen
Nähe er zuhause ist. Das ist eine etwas versteckt gelegene, unscheinbare
Synagoge, vergleicht man sie mit dem stattlichen Gebäude an der
Löwenstrasse, das im maurischen Stil erbaut wurde und stark an einen
Kirchenbau erinnert.
Einst Mitglied einer streng orthodoxen Gemeinde. Ein weiterer
Bezugspunkt ist das orthodoxe Milieu, das Bollag auf den Rundgängen
'differenziert' und mit seinen 'Sonnen- und Schattenseiten' darstellen will,
wie er gegenüber kath.ch sagt. In seinen ersten Jahren an der Limmatstadt
war der Sohn eines Schweizer Juden und einer deutschen Jüdin selbst Mitglied
in der Israelitischen Religionsgemeinschaft Zürich, einer von zwei streng
orthodoxen Gemeinden. Er habe sich aber nie jüdisch-orthodox gekleidet oder
Schläfenlocken getragen, sondern seine Zugehörigkeit zum Judentum äußerlich
stets nur mit dem Tragen der Kippa zum Ausdruck gebracht, sagt Bollag. Heute
leben laut Bollag in Zürich-Wiedikon und in Zürich-Enge insgesamt
schätzungsweise über 2000 orthodoxe, teils vom Chassidismus geprägte Juden.
So viele wie noch nie. Auf einem Rundgang Ende April und im Gespräch mit
Bollag wurde deutlich, dass er das ultraorthodoxe Judentum kritisch
betrachtet. So spricht er von einer 'Uniformierung' als einem Phänomen, das
sich nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr verstärkt habe, und deutet diese
Strömung innerhalb des Judentums als Zeichen für eine Ideologie, die eine
'Abschottung von der Moderne' anstrebt. Mitten im Zentrum des orthodoxen
Zürich, an der Bus- und Tramhaltestelle Schmiede-Wiedikon unweit der
orthodoxen Synagoge Agudas Achim, muss Bollag einräumen, dass auch er als
Jude kaum Zugang zu diesem Milieu habe.
Koschere Bagels. Dann gibt es aber auch die Orte, die Bollag dann und
wann für eine Mahlzeit aufsucht, weil er sie im Zusammenhang mit
Durchführung der 'Jewish Mile' näher kennenlernte. So etwa den 'Bagel Shop'
an der Bederstrasse. Dort durften sich die Teilnehmer zum Abschluss des
Rundgangs vom 26. April mit einem heißen Getränk aufwärmen und mit
Thunfisch, Lachs, Käse oder Ei gefüllte Bagels essen. Natürlich koscher. Auf
dem Rundgang kommt eben auch das Thema 'Ernährung' zur Sprache.
Hinweis: Die Rundgänge durch das jüdische Zürich finden zwei Mal jährlich
statt, jeweils im Frühsommer und im Herbst."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S.945-947; III,2 S.
1726-1749. |
 | 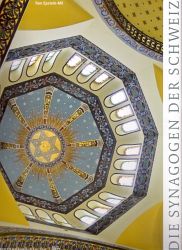 Ron
Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und Akkulturation.
Fotografien von Michael Richter Ron
Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und Akkulturation.
Fotografien von Michael Richter
Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz. Schriftenreihe des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, Band 13.
2008. S. 146-167. (hier auch weitere Quellen und
Literatur) |
 | Yvonne Domhardt / Kerstin A. Paul (Hrsg.):
Quelle lebender Bücher. 75 Jahre Bibliothek der Israelitischen
Cultusgemeinde Zürich. Edition Clandestin. Biel 2014. 272 S. Fr.
37.50. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|