|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberfranken"
Zeckendorf (Stadt
Scheßlitz, Kreis Bamberg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Zeckendorf bestand eine jüdische Gemeinde bis
1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück.
Auch im 15./16. Jahrhundert könnten schon einzelne Juden am Ort gelebt haben,
wenngleich eine angebliche Ersterwähnung im Jahr 1483 nicht eindeutig bestätigt werden
kann. Die erste sichere Nennung ist von 1586. Die Juden standen unter dem Schutz des Klosters Langheim und der Freiherren
von Künßberg.
Mitte des 17. Jahrhunderts gab es bereits 30 jüdische Familien im Ort, 1699
noch 21. Bei den
Unruhen des Jahres 1697 kam es am 22. Mai 1697 zu Überfällen der jüdischen Familien des Ortes durch
räuberische Banden aus der Umgebung. Zeitweilig lebten in Zeckendorf mehr jüdische als christliche
Familien in Zeckendorf. Auf Grund der Größe der Gemeinde wurde 1644 der Sitz
des Landesrabbinates für das Hochstift Bamberg aus Bamberg nach Zeckendorf verlegt.
Erster Landesrabbiner in Zeckendorf von 1658 bis
1665 war David Mosche Halevi. Weitere bekannte Rabbiner und talmudische Gelehrte waren
in der Folgezeit R. Moses ben Elchanan Fürth (Rabbiner 1665-1667), R. Henoch
Levi (als Wiener Exulant Rabbiner von 1674-1678), Meir Halevi und Moses Meyer
und andere mehr.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1810 134 jüdische Einwohner (48,9 % von insgesamt 276), 1837 166 (58,2 %
von 285), 1840 151 (43,3 % von 188), 1852 133 (43,6 % von 305), 1875 52 (18,8 %
von 277) und 1900 50 (17,7 % von 282). Nach der Statistik ging - wie in anderen
"Judendörfern" auch - seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zahl
der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung stark zurück.
Die jüdischen Familien lebten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts überwiegend
vom Handel mit Vieh und Waren aller Art (Lumpenhandel, Hausierhandel). Bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts kamen auch mehrere Handwerksberufe dazu, darunter
mehrere Weber, ein Schneider, ein Schuhmacher und ein Metzger.
An Einrichtungen waren eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule, ein
rituelles Bad und - gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Demmelsdorf - ein Friedhof
vorhanden. Auf Grund des zwischen den beiden Gemeinden gelegenen Friedhofes und
der traditionellen Verbundenheit der beiden Gemeinden war auch eine gemeinsame Chewra
Kadischa vorhanden (Wohltätigkeits- und Bestattungsverein). Zur Besorgung
religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein
Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorsänger und Schächter
tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Von den Lehrern ist u.a.
bekannt: Moses Hofmann, der 1875 nach Rothenburg wechselte und dort noch über 50 Jahre lang wirkte (bis 1926, gest.
1929). Um 1903 war Carl
Kaufmann Lehrer in Zeckendorf.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Jakob
Gerst (geb. 19.12.1885 in Zeckendorf, gef. 12.4.1917). David Heimann (geb.
26.12.1890 in Zeckendorf, gef. 29.7.1916), Gefreiter Heinirch Heimann (geb.
6.5.1887 in Zeckendorf, gef. 26.8.1914), Unteroffizier Max Heimann (geb.
13.12.1886 in Zeckendorf, gef. 31.10.1915), Karl Rosenbaum (geb. 3.12.1897 in
Zeckendorf, gef. 9.6.1917).
Um 1924, als noch 20 jüdische Einwohner in acht Haushaltungen gezählt
wurden, waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde Gerson Gerst, Samuel
Rosenbaum, Karl Hermann und Max Welt. Der jüdische Lehrer aus Demmelsdorf
unterrichtete damals die noch vier schulpflichtigen Kinder in Religion (1932
fünf Kinder). Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat in Bamberg. 1932
waren die Gemeindevorsteher Max Reis, Gerson Gerst und Gustav Gerst.
1933 lebten 22 jüdische Personen in Zeckendorf (9,4 % von insgesamt
235). Trotz der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden
Entrechtung und der Repressalien entschlossen sich nur wenige von ihnen in den folgenden Jahren
zum Verlassen des Ortes beziehungsweise zur
Auswanderung. Am 1. November 1938 wurden noch 20 jüdische Einwohner gezählt.
Die letzten 18 wurden am 25. April 1942 von Bamberg nach Izbica bei Lublin
deportiert.
Von den in Zeckendorf geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leo Ansbacher (1887),
Clara (Klara) Berg geb. Satzmann (1879), Jettchen Brückmann geb. Kirschbaum
(1881), Flora Gerst (1910), Gerson Gerst (1877), Gustav (Gerson) Gerst (1890), Justin
Gerst (1926), Rosa Gerst geb. Stern (1883), Selma Gerst geb. Heimann (1899), Senta Gerst
(1923), Gutta Hausmann (1885), Salomon Hausmann (1880), Regina Herrmann geb. Heimann (1885),
Klara Herz geb. Gerst (1888), Heinrich Kaufmann (1896), Frieda
Lauer geb. Satzmann (1876), Gisela Liffgens geb. Rosenbaum (1893), Heinz Reis (1925), Inge
Irene Reis (1933), Mina Reis geb.
Hausmann (1888), Robert Reis (1923), Siegfried Reis (1927), Gretchen Rollmann
geb. Satzmann (1885), Rosalie Rollmann geb. Satzmann (1877), Alice Rosenbaum
(1929), Cäcilie (Cilli) Rosenbaum geb. Herrmann (1873), Elise Rosenbaum geb. Eckmann
(1859), Felix Rosenbaum (1885), Hedwig Rosenbaum geb. Liffgens (1892),
Ilse Rosenbaum (1924), Samuel Rosenbaum (1866), Rosa (Ryfka) Sachs geb. Eisenberg
(1886), Josef Satzmann (1874), Hedwig Weinstock geb. Kaufmann (1900).
Auf dem Gedenkstein am jüdischen Friedhof sind folgende Namen
festgehalten: Gerson
Gerst / Rosa Gerst / Flora Gerst / Gustav Gerst / Selma Gerst / Justin Gerst
/ Senta Gerst / Salomon Hausmann / Minna Reiss / Robert Reiss / Heinz Reiss
/ Inge Reiss / Siegfried Reiss / Samuel Rosenbaum / Ziv
Rosenbaum / Elise Rosenbaum / Felix Rosenbaum / Hedwig Rosenbaum / Ilse
Rosenbaum / Alice Rosenbaum.
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und
Schochet 1908 / 1911
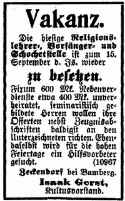 Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 27. August 1908: "Vakanz. Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 27. August 1908: "Vakanz.
Die hiesige
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schochetstelle ist zum 15. September
dieses Jahres wieder
zu besetzen.
Fixum 600 Mark Nebenverdienste etwa 400
Mark. Unverheiratete, seminaristisch gebildete Herren wollen ihre Offerten
nebst Zeugnisabschriften baldigst an den Unterzeichneten richten.
Ebendaselbst wird für die hohen Feiertage ein Hilfsvorbeter gesucht.
Zeckendorf bei Bamberg.
Isaak Gerst, Kultusvorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 9. Februar 1911: "Die hiesige
Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle ist per 1. März zu
besetzen. Garantiertes Einkommen Mark 1000.-. Auch Ausländer, welche die
deutsche Sprache beherrschen, können Berücksichtigung finden. Meldungen
sind zu richten an Herrn Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 9. Februar 1911: "Die hiesige
Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle ist per 1. März zu
besetzen. Garantiertes Einkommen Mark 1000.-. Auch Ausländer, welche die
deutsche Sprache beherrschen, können Berücksichtigung finden. Meldungen
sind zu richten an Herrn
Isaak Gerst, Kultusvorstand,
Zeckendorf,
Oberfranken". |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod von Isaac Langfeld aus Zeckendorf (gest. in
Philadelphia, USA, 1906)
Hinweis: nach der Todesanzeige on der "New York Times" vom 17.
November 1906 war Isaac Langfeld "founder of the firm of Langfeld Brothers
& Co., leather good manufacturers of Philadelphia". Isaac Langfeld war
auch Präsident der Chewra Kadischa seiner im Artikel genannten jüdischen
Gemeinde B'rith Shalom an der Ecke 6th Avenue/Girard
Avenue.
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 7. Dezember 1905: "In Philadelphia starb - 92 Jahre alt - Isaac
Langfeld, der Gründer und Präsident der dortigen kleinen orthodoxen
Gemeinde in der Girard avenue. Langfeld, der bereits im Alter von 20
Jahren aus Zweckendorf in Bayern nach Amerika kam, war der Gründer der
ersten B'nai-Berith-Loge in den Vereinigten
Staaten).
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 7. Dezember 1905: "In Philadelphia starb - 92 Jahre alt - Isaac
Langfeld, der Gründer und Präsident der dortigen kleinen orthodoxen
Gemeinde in der Girard avenue. Langfeld, der bereits im Alter von 20
Jahren aus Zweckendorf in Bayern nach Amerika kam, war der Gründer der
ersten B'nai-Berith-Loge in den Vereinigten
Staaten). |
Zur Geschichte der Synagoge
Die erste Synagoge, eine einfache Betstube, befand sich auf
dem vom Kloster Langheim zur Verfügung gestellten Grundstück. Sie wurde 1660
eingerichtet, war jedoch nach wenigen Jahrzehnten zu klein und baufällig. 1723
konnte mit dem Bau einer neuen Synagoge begonnen werden. Sie wurde nach
dem Modell der Synagoge von Bamberg gebaut und 1727 eingeweiht. Auch die Juden
aus Demmelsdorf besuchten danach für
einige Jahre die Synagoge in Zeckendorf (vermutlich auch bereits vor dem Bau
dieser Synagoge). 1742 brannte allerdings die
Synagoge in Zeckendorf ab.
Am 1. Juli 1743 wurde durch ein Dekret verordnet, dass eine neue, 50
Männer- und 45 Frauenstühle umfassende Synagoge auf einem dem Bamberger Hochstift
gehörenden Grundstück gebaut werden sollte. Das
Grundstück mit der Plan-Nr. 86 war dafür bestimmt worden. Die Plätze in
der Synagoge wurden an die Gemeindeglieder vermietet. Die
"Stuhlgelder" mussten an das Kloster Langheim abgeführt werden. Je
nach Nähe zum Toraschrein wurde der Wert des Betstuhles bestimmt. 1765 wurde
unmittelbar bei der Synagoge ein Haus für den Lehrer/Vorbeter erbaut.
An Ritualien aus der Synagoge waren bis in die 1930er-Jahre vorhanden:
ein Pokal aus dem Besitz der Chewra Kaddischa von 1738, 1 Tora-Vorhang von 1717,
1 hellblauer Toravorhang mit Schulchandecke, 1 grüner Toravorhang mit
Schulchandecke, 1 weißer Toravorhang in Häkelarbeit, 3 silbern Tassim
(Toraschilde), 2 silberne Jadim (Torazeiger), 1 paar silberne Ezchajim
(Aufwickelstäbe für die Torarolle).
Nach 1933 richteten sich gewaltsame Aktionen alsbald auch gegen die
Synagoge. Im November 1936 wurden 25 Fenster des Synagogengebäudes durch
Dorfkinder eingeworfen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Inneneinrichtung der Synagoge von SA- und SS-Leuten (davon zwei aus Scheßlitz)
zerstört. Um die Synagoge hatten sich während der Aktion etwa 100 Dorfbewohner
versammelt, Kinder und Jugendliche warfen Steine durch die Fenster in das
Gebäude. Die Inneneinrichtung der Synagoge wurde auf einem Feld verbrannt. Für
die Beseitigung des Schutts musste die jüdische Gemeinde 200 RM bezahlen. Im Herbst
1939 wurde die Synagoge auf Anweisung des Landrates von Bamberg vollständig
zerstört. An Stelle der Synagoge wurde ein Gemüsegarten angelegt.
Gegen acht der am Novemberpogrom 1938 in Zeckendorf Beteiligten fand im Juni
1948 ein Prozess vor dem Landgericht Bamberg statt. Sieben erhielten
Freiheitsstrafen von zwei Wochen bis zu einem Jahr, einer wurde
freigesprochen.
Adresse/Standort der Synagoge: Garten gegenüber
der Schule beziehungsweise Grundstück zwischen den Häusern Nr. 17 und
19.
Fotos
(Historische Fotos der
Ritualien von Theodor Harburger, Aufnahmen 1927/30; Quelle: Central Archives for the
History of the Jewish People, Jerusalem; veröffentlicht in Th.
Harburger: "Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern.
1998 Bd. 3 S. 796-799).
Ritualien aus der
ehemaligen Synagoge Zeckendorf
|
 |
 |
| |
Pokal des Wohltätigkeits- und
Bestattungsvereines Chewra Kadischa von 1738 (Silber, innen vergoldet,
seit 1938 verschollen) |
Tora-Schild (Tass, 1. Hälfte
des
19. Jahrhunderts, heute im
Israel Museum Jerusalem) |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Tora-Schild (Tass, von 1774,
hergestellt in
Oettingen, heute im Israel-Museum, Jerusalem) |
Chanukka-Leuchter aus der
Synagoge
(87 cm hoch, 78 cm breit,
seit 1938 verschollen) |
| |
| |
|
|
Das Synagogengrundstück
in
der Gegenwart |
 |
| |
Gemüsegarten an
Stelle der ehemaligen Synagoge (Foto: Jürgen Hanke, Kronach 2004
aus www.synagogen.info) |
| |
|
|
Einzelne Presseberichte
| Februar 2010:
Zum Tod des 1947 in einem PD-Lager bei Zeckendorf
geborenen Chef-Historikers von Yad Vashem David
Bankier |
Artikel von Ulrich Sahm im "Israel
Newsletter" vom 1. März 2010 (www.israelnetz.com):
"Chefhistoriker von Yad Vashem gestorben.
JERUSALEM (inn) - David Bankier, Chefhistoriker der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, ist am Wochenende infolge einer langen schweren Krankheit gestorben. Der 1947 in einem Lager jüdischer Holocaustüberlebender in
Zeckendorf nahe Bamberg geborene Bankier galt als einer der wichtigsten Forscher der deutschen Gesellschaft und des Antisemitismus unter den Nazis.
Er leitete das Internationale Institut für Holocaustforschung in Yad Vashem. Zudem war Bankier unter anderem Gastprofessor an verschiedenen amerikanischen Universitäten, in London, Südafrika und in weiteren Ländern. In Südamerika baute er Institute für Jüdische Studien auf. Bankier konzentrierte sich auf die Erforschung der Verfolger und Mitläufer in Europa.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Studien war die Frage, wie der Antisemitismus zu einem zentralen und wirksamen Mittel der Nazis geworden war, um die Massen zu mobilisieren. Bankier veröffentlichte mehrere Bücher zu dem Thema, darunter "Die Deutschen und die Endlösung: Öffentliche Meinung unter den Nazis".
In einer Trauermitteilung von Yad Vashem bezeichnete der Leiter der Gedenkstätte, Avner Schalev, den verstorbenen Forscher als einen "Eckstein der modernen akademischen Erforschung von Nazi-Deutschland". Bei einem seiner letzten Vorträge sagte Bankier, dass die Juden für Antisemiten eine "mysteriöse, mythische und böse Macht darstellen, die mit Allmacht eine finstere Rolle in der Weltgeschichte spielen".
Für Hitler sei der Nazismus eine Doktrin gewesen, um die Menschheit von der jüdisch-christlich-marxistischen Doktrin zu erlösen. Die Vorherrschaft der deutschen Rasse konnte aus Hitlers Sicht nur durch einen totalen Krieg der Deutschen gegen die Juden erlangt werden. In einem Interview mit der "New York Times" sagte Bankier, dass die Rolle der Mitläufer und untätigen Nachbarn bei zahlreichen kleineren Massenmorden in der früheren Sowjetunion Anfang der vierziger Jahre einen großen Einfluss auf heutige Völkermorde in Afrika und an anderen Orten in der Welt hatte. Infolge der Verbrechen der Nazis habe sich die Welt gewandelt. Wenn heute irgendwo ein Genozid begangen werde, reagierten die Menschen schockiert, weil ihnen so viele Details über den Holocaust bekannt seien." |
| Englischer
Artikel aus der "Jerusalem Post" vom 1. März 2010 als pdf-Datei
(mit Foto von David Bankier) |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | A. Eckstein: Geschichte der Juden im ehemaligen
Fürstbistum Bamberg, bearbeitet auf Grund von Archivalien nebst
urkundlichen Beilagen. Bamberg 1898 (Reprint 1985). |
 | ders.: Nachträge zur Geschichte der Juden im ehemaligen
Fürstbistum Bamberg. Bamberg 1899 (Reprint 1985). |
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 152-153. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 225-226. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 246-248. |
 | Klaus Guth (Hg.) u.a.: Jüdische Landgemeinden in Oberfranken
(1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch. Bamberg 1988. Zu
Zeckendorf S. 343-351 (mit weiteren Quellenangaben). |
 | 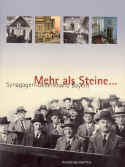 "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu.
ISBN 978-3-98870-411-3.
Abschnitt zu Zeckendorf S. 221-227 (die Forschungsergebnisse
konnten auf dieser Seite von "Alemannia Judaica" noch
nicht eingearbeitet werden). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Zeckendorf Upper Franconia. The
community was founded in 1654 and was the first seat of the Bamberg regional
chief rabbinate. R. Shemuel of Mezrich (Poland) was the first chief rabbi
(1658-1665). In 1742 the synagogue burned down and a new one was built the
following year. The Jewish population numbered 166 in 1837 (total 285),
declining to 22 in 1933. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the
synagogue was vandalized. All but one of the 18 Jews remaining in 1942 were
deported to Izbica in the Lublin district (Poland) via Bamberg on 25 April.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|