|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht:
"Synagogen im Rhein-Hunsrück-Kreis"
Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis)
mit Oberhirzenach, Perscheid und Werlau (VG St. Goar-Oberwesel)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(erstellt unter Mitarbeit von Walter Karbach)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Oberwesel bestand eine jüdische Gemeinde im Mittelalter (Oberwesel
war freie Reichsstadt seit 1237) sowie vom 18. Jahrhundert bis 1938/42.
Erstmals werden Juden in der Stadt in der Reichssteuerliste 1241/42
genannt. Mit 20 Mark Steuer zahlte die in Oberwesel ansässige Judenschaft 5
Mark weniger als die im benachbarten Boppard. 1287 war Oberwesel
Ausgangspunkt einer Welle von Verfolgungen, die in den folgenden beiden Jahren
vielen Juden im Bereich des Mittelrheins das Leben kostete. Nachdem die
Oberweseler Juden beschuldigt worden waren, am Karfreitag 1287 einen stromauf
bei Bacharach aufgefundenen christlichen Jungen
(den "Guten Werner") ermordet zu haben, wurden in der Stadt und in
Boppard vierzig Juden erschlagen. Die Leiche des Jungen wurde
in Bacharach feierlich in der
Kunibertkapelle bestattet, wo der "Gute Werner" angeblich Wunder wirkte.
Über seinem Sarkophag wurde ab 1293 eine neue Kapelle erbaut, in der er über
Jahrhunderte verehrt wurde (siehe Bacharach).
Erst auf Grund des Einschreitens von Rudolf von Habsburg konnten die Juden in
Oberwesel und Boppard wieder einigermaßen in Ruhe leben.
Nachdem der Wernerkult in Bacharach in der
Reformationszeit unterbunden und die Gebeine 1621 von Jesuiten in das Feldlager
des Generalobersten Spinola verbracht worden waren, wurde die Wernerkapelle
Oberwesel, wo man die angebliche Martersäule zeigte, zum Zentrum des Kultes.
Hier wurde 1727 ein großes Ritualmordrelief an der Außenseite der Kapelle
angebracht, das erst 1970 entfernt wurde. Eine ähnlich gearbeitete
Barockskulptur (siehe Abbildung unten) aus dieser Zeit stand bis 1966 auf dem
Altar der Pfarrkirche. 1728 wurde das Wernerfest obligatorisch, die Prozession
wurde erst 1971 abgeschafft.
1337 kam es zu
einer neuen Verfolgung durch die umherziehenden "Judenschläger"
(Armleder-Bewegung): dabei wurden wiederum Juden erschlagen und ihre Häuser
geplündert; die Beute kam in die Kapelle des "guten Werner" nach
Bacharach. Erzbischof Baldewin von Trier, dem Oberwesel seit 1312 verpfändet
war, zwang jedoch die Stadt Oberwesel, alle Schulden gegenüber den Juden - auch
im Blick auf die Ermordeten - zu begleichen und beschlagnahmte die ihnen
geraubte Habe. Am 18. März 1338 kam es zu einer Einigung zwischen Erzbischof
und der Stadt über die künftigen Lebensbedingungen von Juden in der Stadt. Die
Einnahmequelle der Juden in der Stadt war im Mittelalter die Geldleihe. Juden
gehörten zeitweise mehrere Häuser in der Stadt. 1349 kam es zu einer
neuen schweren Judenverfolgung während der Pestzeit, bei der die
mittelalterliche Gemeinde völlig vernichtet wurde.
Erst seit 1372 lassen sich wiederum jüdische Personen in Oberwesel
nachweisen, doch dürfte es damals nicht mehr zur Gründung einer Gemeinde
gekommen sein. Einige nach Oberwesel genannte Juden lebten damals in anderen Städten
(Cochem, Gelnhausen, Mayen, Straßburg und Worms). Weiterhin lebten die Juden in
Oberwesel unter dem Schutz der Erzbischöfe von Trier und waren damit auch von
der Vertreibung der Juden aus dem Erzstift Trier 1418/19 betroffen, falls damals
überhaupt noch Juden in der Stadt gelebt haben. 1462 oder kurz danach
kam es zu einer erneuten Ansiedlung. Auch im 16./17. Jahrhundert
(1563 und 1576) werden Juden in der Stadt genannt.
Der 1724 in Karlsruhe
aufgenommene 47-jährige Salomon Meyer gibt als Geburtsort Oberwesel an, wo er
somit um 1677 geboren ist (Juden in Karlsruhe 1988 S. 516).
Seit dem 18. Jahrhundert nahm die Zahl der jüdischen Einwohner langsam
zu (1779 15 jüdische Einwohner). Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die
Zahl der jüdischen Einwohner wie folgt: 1808 33 jüdische Einwohner, 1817 39,
1822 39, 1830 43, 1851 47, 1858 53, 1885 47, 1890 53, 1895 42, 1910 41. Auch die
in Oberhirzenach, Perscheid
und Werlau lebenden wenigen jüdischen
Personen gehörten zur Gemeinde in Oberwesel.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (1885 wird das
Fehlen eines Religionslehrers beklagt, siehe Text zum Brand in der Synagoge
unten; zu den Anstellungen vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). Als Lehrer
werden unter anderem genannt: K. Levi (1904), M. Moses (1905), Josef Aschenbrand (ab
1910). Die Gemeinde wurde durch den Bad Kreuznacher Rabbiner betreut.
Um 1924, als 49 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (1,4 %
von insgesamt etwa 3.500 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde
Gustav Gerson, Bernhard Mayer, H. Lichtenstein und Isidor Gerson. 1932
wurden 44 jüdische Einwohner gezählt. Damals waren die Gemeindevorsteher
Moritz Mayer (1. Vors.), Theodor Gerson (2. Vors.) und Jakob Mayer (3. Vors.).
Der Repräsentanz gehörten acht Mitglieder an unter dem Vorsitz von Gustav
Gerson (1. Vors.), Isidor Gerson (2. Vors.) und Karl Lichtenstein (3. Vors.).
Zwei Vereine waren in der Gemeinde aktiv: der Israelitische
Frauenverein (1932 unter Leitung von Frau G. Gerson; Zweck und
Arbeitsgebiet: Krankenpflege und Bestattung) sowie die "Israelitische
Bruderschaft" (gegründet 1841; 1932 unter Vorsitz von Moritz Mayer,
Liebfrauenstraße 50; Zweck und Arbeitsgebiet: Krankenpflege, Bestattung; 1932
14 Mitglieder). Im Schuljahr 1931/32 erhielten fünf schulpflichtige jüdische
Kinder Religionsunterricht.
1933 lebten noch 44 jüdische Personen in Oberwesel. In den
folgenden Jahren ist ein Teil von ihnen auf Grund der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien
weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1936 wurden noch 40 jüdische Einwohner
gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der
Synagoge zerstört (s.u.), dazu wurden die Fenster der jüdischen Häuser und
Wohnungen eingeworfen. Mit der Deportation der letzten jüdischen Einwohner
1942 endet die Geschichte der jüdischen Gemeinde Oberwesel.
In der NS-Zeit sind die jüdischen Personen, die in Oberwesel (und Perscheid)
geboren sind und/oder längere Zeit dort gelebt haben, emigriert oder wurden
deportiert und ermordet; nur wenige haben die Lager überlebt. Umgekommen sind
nach Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie auf Grund der
Recherchen von Doris Spormann und Walter Karbach [Stand 2020]: Elsa Abraham
geb. Marx (1899), Mathilde Aumann, geb. Gerson (1867), Emma Frenkel, geb.
Mayer (1881), Wilhelm Frenkel (1878), Albert Gerson (1883), Berta Gerson, geb.
Kahn (1875), Gustav Gerson (1865), Leopold Gerson (1864), Helene Holzmann, geb.
Mayer (1875), Albert Kahn (1873), Berta Kahn, geb. Löb (1883), Sara Kahn (1873),
Meta Lichtenstein (1921), Theodor Lichtenstein (1888), Herta Marx (1905), Julius
Marx (1892), Lina Marx (1897), Paula Marx, geb. Kahn (1893), Albert Mayer
(1874), Ida Mayer, geb. Wolf (1895), Jenny Mayer, geb. Mayer (1879), Karl Mayer
(1879), Leo Mayer (1881), Moritz Mayer (1876), Siegmund Mayer (1873), Wilhelm
Mayer (1885), Walter Orbach (1898), Berta Salomon (1870), Adolf Seligmann
(1869), Eugenie Seligmann, geb. Weil (1878) und Else Trum (1903).
Emigrieren konnten: Helene Corty, geb. Seligmann (1902), Ruth Frenkel
(1918), Fanny Gerson, geb. Selig (1876), Ferdinand Gerson (1872), Heinrich
Gerson (1908), Hermann Gerson (1914), Ida Gerson (1907), Isidor Gerson (1872),
Julius Gerson (1899), Lina Gerson, geb. Schlösser (1875), Lotte Gerson (1917),
Alfred Gottschalk (1930), Erna Gottschalk, geb. Gerson (1906), Max Gottschalk
(1898), Martha Gottschalk, geb. Marx (1896), Amalie Lewis, geb. Lichtenstein
(1883), Heinrich Lichtenstein (1889), Tillie Loeb, geb. Mayer (1907), Walter
Loeb (1903), Clementine Mayer, geb. Frenkel (1876), Erna Mayer (1909), Herta
Mayer (1910), Jakob Mayer (1879), Klara Opatowski, geb. Aschenbrand (1895), Emma
Perlstein, geb. Mayer (1880) und Rosalie Trum, geb. Wolf (1878).
Die Vernichtungslager überlebt haben: Günther Lichtenstein (1925),
Herbert Lichtenstein (1920), Karl Lichtenstein (1857), Karl-Heinz Lichtenstein
(1922), Ruth Lichtenstein (1931), Selma Lichtenstein, geb. Strauß (1890), Helmut
Mayer (1924) und Kurt Alexander Mayer (1921). Sie alle haben Deutschland 1946/47
verlassen.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1899 /
1903 / 1904 (Vertretung) / 1908
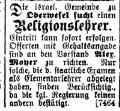 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1899: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1899:
"Die israelitische Gemeinde zu Oberwesel sucht einen Religionslehrer.
Eintritt kann sofort erfolgen. Offerten mit Gehaltsangabe
sind an den Vorstand Alexander Mayer zu richten. Nur solche, die das
staatliche Examen als Elementarlehrer abgelegt haben, finden
Berücksichtigung, da die königliche Regierung keinen anderen
bestätigt."
|
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1903:
"Die
israelitische Lehrer- und Kantorstelle
zu Oberwesel am Rhein ist ab
1. Mai neu zu besetzen. Gehalt Mark 1.200, nebst freier Wohnung.
Reflektierende, die das Examen bestanden, wollen Zeugnisse und Lebenslauf
an den Vorstand Alexander Mayer baldigst einsehen. Schochet
bevorzugt." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1904: " Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1904: "
Vertreter
gesucht
per 1. April dieses Jahres, der eventuell auch die hiesige
Lehrerstelle sofort definitiv übernehmen könnte. Lehrer mit angenehmer
Stimme wollen sofort Bewerbungen richten an
K. Levi, Lehrer,
Oberwesel am Rhein." |
| |
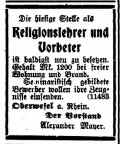 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908:
"Die hiesige Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
ist
baldigst neu zu besetzen. Gehalt Mark 1.200 bei freier Wohnung und Brand.
Seminaristisch gebildete Bewerber wollen ihre Zeugnisse einsenden.
Oberwesel am Rhein. Der Vorstand Alexander Mayer." |
| Anmerkung: 1910 konnte Josef Aschenbrand aus
Hottenbach als jüdischer
Religionslehrer in Oberwesel angestellt werden. |
Der jüdische Lehrer M. Moses erhält eine Anstellung
an der katholischen Stadtschule (1905)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Februar 1905: "In Oberwesel wurde der jüdische Lehrer
M. Moses auch an der katholischen Stadtschule angestellt und zwar
für den deutschen Unterricht. In derselben Stadt hat noch vor einigen
Jahren eine Judenhetze stattgefunden."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Februar 1905: "In Oberwesel wurde der jüdische Lehrer
M. Moses auch an der katholischen Stadtschule angestellt und zwar
für den deutschen Unterricht. In derselben Stadt hat noch vor einigen
Jahren eine Judenhetze stattgefunden." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod des langjährigen Gemeindevorstehers Alexander
Mayer (1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1912:
"Oberwesel. Unter ungewöhnlich großer Beteiligung ist der
langjährige verdienstvolle Vorsitzende unserer Gemeinde Alexander Mayer
zu Grabe getragen worden." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1912:
"Oberwesel. Unter ungewöhnlich großer Beteiligung ist der
langjährige verdienstvolle Vorsitzende unserer Gemeinde Alexander Mayer
zu Grabe getragen worden." |
Zum Tod der Frau von Alexander Mayer (1930)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. September 1930:
"Oberwesel am Rhein, 14. September (1930). In tiefe Trauer versetzt
wurde die hiesige israelitische Gemeinde durch den Heimgang ihres
ältesten Mitgliedes, der Frau Alexander Mayer, die im Alter von 76 Jahren
aus ihrer tatenreichen irdischen Laufbahn abberufen worden ist. Wer sie
gekannt hat, weiß, was dieser Verlust für die aussterbenden Gemeinden
bedeutet. Sie war eine gute wackere Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Wo
es zu schlichten, zu helfen oder zu lindern gab, da war ihr Platz. Die
jüdische Frauenkippe, der sie 50 Jahre angehörte, verliert ihr vorbildliches
Mitglied. Durch ihre überragende Lebensklugheit, Selbstlosigkeit und
ihren Gerechtigkeitssinn wirkte sie im Stillen anregend auf das orthodoxe
jüdische Leben am Mittelrhein. Herr Rabbiner Dr. Bamberger, Mainz,
würdigte in vortrefflichen Worte diese jüdische Frau. Die Beliebtheit
auch bei Andersgläubigen gaben die Trauerkundgebungen und das Geleite
kund. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. September 1930:
"Oberwesel am Rhein, 14. September (1930). In tiefe Trauer versetzt
wurde die hiesige israelitische Gemeinde durch den Heimgang ihres
ältesten Mitgliedes, der Frau Alexander Mayer, die im Alter von 76 Jahren
aus ihrer tatenreichen irdischen Laufbahn abberufen worden ist. Wer sie
gekannt hat, weiß, was dieser Verlust für die aussterbenden Gemeinden
bedeutet. Sie war eine gute wackere Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Wo
es zu schlichten, zu helfen oder zu lindern gab, da war ihr Platz. Die
jüdische Frauenkippe, der sie 50 Jahre angehörte, verliert ihr vorbildliches
Mitglied. Durch ihre überragende Lebensklugheit, Selbstlosigkeit und
ihren Gerechtigkeitssinn wirkte sie im Stillen anregend auf das orthodoxe
jüdische Leben am Mittelrhein. Herr Rabbiner Dr. Bamberger, Mainz,
würdigte in vortrefflichen Worte diese jüdische Frau. Die Beliebtheit
auch bei Andersgläubigen gaben die Trauerkundgebungen und das Geleite
kund. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Über Rabbiner Dr. Alfred Gottschalk (geb. 1930 in
Koblenz, gest. 2009 in Cincinatti)
 Alfred
Gottschalk ist am 7. März 1930 in Koblenz geboren (seine Mutter wollte
vermutlich nicht im St.-Werner-Krankenhaus in Oberwesel entbinden und zog
das Ev. Stift in Koblenz vor). Alfred Gottschalk ist in Oberwesel
aufgewachsen. 1939 ist er gemeinsam mit seiner
Mutter Erna Gottschalk geb. Gerson in die USA emigriert. In Brooklyn
fanden sie eine neue Heimat. Nach der Ausbildung zum Rabbiner wurde Alfred
Gottschalk 1957 ordiniert. Er wurde in der Folgezeit zu einem der
bedeutendsten Rabbiner im amerikanischen Judentum. 1971 bis 1995 war er
Präsident des Hebrew Union College, danach Chancellor des College; von 2000
bis zum seinem Tod 2009 Chancellor emeritus. Alfred
Gottschalk ist am 7. März 1930 in Koblenz geboren (seine Mutter wollte
vermutlich nicht im St.-Werner-Krankenhaus in Oberwesel entbinden und zog
das Ev. Stift in Koblenz vor). Alfred Gottschalk ist in Oberwesel
aufgewachsen. 1939 ist er gemeinsam mit seiner
Mutter Erna Gottschalk geb. Gerson in die USA emigriert. In Brooklyn
fanden sie eine neue Heimat. Nach der Ausbildung zum Rabbiner wurde Alfred
Gottschalk 1957 ordiniert. Er wurde in der Folgezeit zu einem der
bedeutendsten Rabbiner im amerikanischen Judentum. 1971 bis 1995 war er
Präsident des Hebrew Union College, danach Chancellor des College; von 2000
bis zum seinem Tod 2009 Chancellor emeritus.
Im
Herbst 2007 war ihm eine von Victor Sanovec konzipierte Ausstellung in der
ehemaligen Synagoge in Oberwesel gewidmet.
Oben: Plakat der Ausstellung für Dr. Alfred Gottschalk 2007.
Link: Seite des Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion über Dr.
Alfred Gottschalks Return to the German Home He Fled |
| |
| September 2009:
Zum Tod von Rabbiner Dr. Alfred Gottschalk -
Übernahme der von Verein Rabbi Hillel e.V. - Barbara Fuchs und Victor
Sanovec - verfassten Mitteilung aus www.victorat.de: |
 "Am
Schabbat Nachmittag, dem 12. September 2009, verstarb Rabbiner Gottschalk im Alter von 79 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Deanna, 2 eigene und 2 Stiefkinder sowie 9 Enkel. "Am
Schabbat Nachmittag, dem 12. September 2009, verstarb Rabbiner Gottschalk im Alter von 79 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Deanna, 2 eigene und 2 Stiefkinder sowie 9 Enkel.
Der Verein Rabbi Hillel und wir, Barbara Fuchs und Victor Sanovec, persönlich verlieren einen Freund und Unterstützer, dessen Interesse an seinem Geburtsort Oberwesel über all die Jahre nie nachgelassen hat. Mit 9 Jahren wurde Gottschalk aus Oberwesel vertrieben, große Teile seiner Verwandtschaft wurden im 3. Reich ermordet. Trotzdem hat Alfred Gottschalk die Versöhnung mit dem Ort seiner Kindheit ein Leben lang gesucht. Artikel "Denkmal – Ein Schritt zurück in die Zukunft".
Von dem Sohn eines kleinen Viehhändlers in Oberwesel zum renommierten Rabbiner in Amerika war es ein harter Weg, auf dem ihm seine Mutter die wichtigste Stütze war. Sein Vater war früh verstorben, er konnte in der neuen Welt nie richtig Fuß fassen.
Video
"Alfred Gottschalk Testimony".
Rabbiner Gottschalk hat sein Leben lang als Pionier für die Sache des Reformjudentums gekämpft und einige Meilensteine auf seinem Weg hinterlassen. So ordinierte er die erste Rabbinerin in Amerika 1972. Unter seiner Leitung als Kanzler des Hebrew Union Colleges in Los Angeles, New York und Cincinnati wurden die Institute erweitert und ausgebaut und der Campus in Jerusalem errichtet. Nach seiner Emeritierung überwachte er den Ausbau des Museums of Jewish Heritage´in New York und war maßgeblich beteiligt an der Gründung des United States Holocaust Museums in Washington. Seine Liebe und Unterstützung galt immer auch dem Land Israel, dem er auf vielfältige Weise verbunden war.
Wir werden Alfred Gottschalk vermissen mit seinem in der Jugend in Brooklyn geschärften Witz und seiner warmherzigen Gastfreundschaft.
Artikel
in der "LA Times". Die Beisetzung war am Montag, den 14. September
2009 in Cincinatti.
Rabbi Hillel e.V. . Barbara Fuchs, Victor Sanovec |
Gedenkblätter aus Yad
Vashem, Jerusalem
 |
 |
 |
Gedenkseite für Berta
Gerson geb. Kahn aus Hillesheim
(Rheinhessen),
Tochter von Theodor Gerson, verheiratet mit Leo Kahn, wohnhaft in
Oberwesel, umgekommen im Ghetto Theresienstadt 1942 |
Gedenkseiten
für den Kaufmann Albert Kahn, geb. 9. Januar 1873 in Hillesheim
(Rheinhessen), Sohn von Leopold Kahn und
Fanny geb. Ostheimer, wohnhaft in Hillesheim Obergasse 1, ab Dezember 1938
in Oberwesel, Simmernerstraße 8a;
1942 deportiert in das Ghetto Theresienstadt, später in das
Vernichtungslager Auschwitz, ermordet. |
Zur Geschichte der Synagoge
Bereits im Mittelalter gab es eine Synagoge
("Judenschule"), von der eine Quelle aus dem Jahr 1452
berichtet.
Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird wiederum eine Synagoge
unbekannten Alters genannt.
Bei einem Großbrand ist die
Synagoge zerstört worden (1834)
 Artikel
in der "Karlsruher Zeitung" vom 26. April 1834:
"Oberwesel, 20. April (1834). In vergangener Nacht brach gegen
12 Uhr in dem Hause des Israeliten Jakob Meyer, Leopolds Sohn, dahier Feuer
aus, zerstörte zwei Häuser, worunter auch die Synagoge, gänzlich, und
beschädigte außerdem noch drei Häuser mehr oder weniger, welche in der Nähe
gelegen haben. Zum Glück waren diese Gebäude im Augenblick des Frühjahrs von
brennbaren Materialien ziemlich leer, wie das in jeder anderen Jahreszeit
bei ländlichen Wirtschaften gewöhnlich nicht der Fall ist, und der Wind sehr
stille; sonst hätte das Unglück noch schrecklicher werden können, da gerade
in diesem Stadtteile die Gebäude noch sehr enge zusammen gebaut sind.
Sämtliche in Flammen aufgegangene oder beschädigte Häuser sind bei der
Provinzialsozietät versichert." Artikel
in der "Karlsruher Zeitung" vom 26. April 1834:
"Oberwesel, 20. April (1834). In vergangener Nacht brach gegen
12 Uhr in dem Hause des Israeliten Jakob Meyer, Leopolds Sohn, dahier Feuer
aus, zerstörte zwei Häuser, worunter auch die Synagoge, gänzlich, und
beschädigte außerdem noch drei Häuser mehr oder weniger, welche in der Nähe
gelegen haben. Zum Glück waren diese Gebäude im Augenblick des Frühjahrs von
brennbaren Materialien ziemlich leer, wie das in jeder anderen Jahreszeit
bei ländlichen Wirtschaften gewöhnlich nicht der Fall ist, und der Wind sehr
stille; sonst hätte das Unglück noch schrecklicher werden können, da gerade
in diesem Stadtteile die Gebäude noch sehr enge zusammen gebaut sind.
Sämtliche in Flammen aufgegangene oder beschädigte Häuser sind bei der
Provinzialsozietät versichert." |
Nach einem Brand erhielt die jüdische Gemeinde Bauholz zum Wiederaufbau der
Synagoge. 1853 erfährt man von einer "ganz neuen, geräumigen mit einer
Empore versehenen Synagoge". 1865 wurde eine neue Torarolle
eingeweiht. Am 16. August 1885 brannte auch diese Synagoge ab.
Der Brand der Synagoge im August 1885
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1885: "Oberwesel,
17. August (1885). Gestern Abend, als die Gemeinde sich zum Mincha-Gebet
in der Synagoge versammelt hatte, ertönte plötzlich in der Nähe
derselben Feuerlärm. Nach einer Stunde war unser Gotteshaus ein Raub der
Flammen. So beklagenswert das Unglück ist, so hatte dasselbe doch
das Gute zur Folge, dass dadurch die Gemeinde aus ihrer religiösen
Indifferenz aufgerüttelt wurde, und es steht sicher zu hoffen, dass es
dem Vorsteher, Herrn Alexander Mayer, gelingen wird, binnen kurzem einen
Religionslehrer anzustellen, sowie die anderen fehlenden religiösen
Institutionen einzuführen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1885: "Oberwesel,
17. August (1885). Gestern Abend, als die Gemeinde sich zum Mincha-Gebet
in der Synagoge versammelt hatte, ertönte plötzlich in der Nähe
derselben Feuerlärm. Nach einer Stunde war unser Gotteshaus ein Raub der
Flammen. So beklagenswert das Unglück ist, so hatte dasselbe doch
das Gute zur Folge, dass dadurch die Gemeinde aus ihrer religiösen
Indifferenz aufgerüttelt wurde, und es steht sicher zu hoffen, dass es
dem Vorsteher, Herrn Alexander Mayer, gelingen wird, binnen kurzem einen
Religionslehrer anzustellen, sowie die anderen fehlenden religiösen
Institutionen einzuführen." |
Die Gemeinde beschloss einen schnellen Neubau einer
Synagoge. Ein neues Grundstück am Schaarplatz konnte erworben werden. Für
den Bau selbst fehlten dann doch die Finanzen, sodass öffentlich für die
Unterstützung des Synagogenbaus geworben werden musste:
Spendenaufruf für den Bau der neuen Synagoge
(1885)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1885:
"Der unterzeichnete Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu
Oberwesel am Rhein erlaubt sich seinen Glaubensgenossen und
Menschenfreunden folgende Bitte und Mitteilung zu unterbreiten: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1885:
"Der unterzeichnete Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu
Oberwesel am Rhein erlaubt sich seinen Glaubensgenossen und
Menschenfreunden folgende Bitte und Mitteilung zu unterbreiten:
Am 16. August brannte leider unsere Synagoge vollständig nieder und war
auch dieselbe sehr schwach versichert. Der Grund und Boden, worauf
dieselbe gestanden, war nur teilweise Eigentum der Israelitischen Gemeinde
und dadurch war dieselbe genötigt, einen anderen Platz zu kaufen, sodass
nur eine Summe von 600 Mark aus der Kasse zum Aufbau da ist. Da nun unsere
Israelitische Gemeinde sehr klein und nicht so bemittelt ist, um dieses
Opfer zum Aufbau allein aufbringen zu können, so bitten wir unsere
Glaubensbrüder und Mitmenschen ganz ergebenst, zu diesem edlen Zwecke ihr
Scherflein beitragen zu wollen. Indem wir hoffen, keine Fehlbitte zu tun,
zeichnen hochachtungsvoll
Der Vorstand: Alexander Mayer. G. Loeb.
Vorstehendes ist der Wahrheit gemäß vorgetragen. Die Israelitische
Gemeinde kann Freunden der Sache und Wohltätern nur empfohlen werden. St.
Goar, 2. Oktober 1885. Der Königliche Landrat:
Movius, Geheimer Regierungsrat.
Wir sind gern bereit, Gaben entgegenzunehmen und weiterzubefördern. Die
Expedition des 'Israelit'." |
Bis zur Fertigstellung der neuen Synagoge
wurden die Gottesdienste im Haus des Handelsmannes Simon Mayer abgehalten.
Nachdem die Spendensammlung offenbar einigen Erfolg hatte, konnte die neue
Synagoge durch Maurermeister Joseph Kipper aus Oberwesel erbaut werden. Am
20. Oktober 1886 wurde sie festlich eingeweiht. Maurermeister Kippel hatte
einen dreigeschossigen Backsteinbau erstellen lassen. Der Synagogenraum mit
Frauenempore erstreckte sich über zwei Geschosse (siehe Pläne unten).
Ein halbes Jahrhundert war die Synagoge am Schaarplatz Zentrum des jüdischen Lebens in der Stadt. Daran nahmen teilweise auch die Juden aus
Werlau teil, die sich 1888 der Gemeinde in Oberwesel angeschlossen hatten, jedoch weiterhin einen eigenen Betraum benutzten.
Die NS-Zeit brachte das Ende des gottesdienstlichen Lebens im Gebäude: beim
Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge demoliert und auf die Straße geworfen. Die Trümmer der Einrichtung, rituelle Gegenstände und die Torarollen wurden zwischen Stadtmauer und Bahnkörper in den damals noch offenen Oberbach geworfen. Der 74-jährige Gustav Gerson, Repräsentant der jüdischen Gemeinde, konnte Teile der geschändeten Tora aus dem Oberbach bergen. Im Januar 1939 wollte die Stadt das Synagogengebäude erwerben - im folgenden Jahr 1940 kam es in den Besitz der Stadt. Nach 1945 blieb das Gebäude erhalten. 1957 wurde es umgebaut und war bis 1974 Sitz der örtlichen Polizeibehörde, danach Wohnhaus.
2006 entstand der Verein "Rabbi Hillel - Verein zur Jüdisch-Christlichen Verständigung
e.V." in Oberwesel. In Zusammenarbeit mit der Kunsthistorikerin Barbara Fuchs wurde ein Denkmal der Oberweseler Bürger für ihre jüdischen Nachbarn konzipiert. Spenden aus der Oberweseler Bürgerschaft ermöglichten die Realisierung. Noch im selben Jahre wurde das Denkmal vor der Synagoge am Schaarplatz feierlich eingeweiht. Besondere Aktivitäten
gingen regelmäßig vom "Victorat, Forum für Kunst und Kultur" von Victor Sanovec aus (Fotodokumentationen, Ausstellungen wie im Herbst 2007 zu "Dr. Alfred Gottschalk - ein amerikanischer Rabbiner aus Oberwesel"), das wie auch der Verein "Rabbi Hillel e.V."
von 2007 bis 2011 in der ehemaligen Synagoge seinen Sitz hatte.
Adresse/Standort der Synagoge: Schaarplatz
3
Fotos / Pläne
(Quelle: Foto der Barockskulptur: Werner Dupuis / bearb. von
Walter Karbach;
Abbildungen der Pläne zum Bau der Synagoge 19. Jahrhundert: Landesamt [s.Lit.] S. 297)
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Veranstaltungen und Berichte
 Ausstellung
im September 2010 - Eröffnung am "Tag der
Europäischen Jüdischen Kultur" am 5. September 2010: Ausstellung
im September 2010 - Eröffnung am "Tag der
Europäischen Jüdischen Kultur" am 5. September 2010:
"Nur einen
Teil davon..."
Schrift und Malerei von Victor Sanovec
Rabbiner Alfred Gottschalk e.V. +
Victorat
Synagoge, Schaarplatz 3, 55430 Oberwesel
5.-30. September 2010
Eröffnung am Sonntag, 5. September 2010 um 15.00 Uhr in der
Synagoge
|
| Oktober 2011:
Hinweis auf ein Buch von Victor
Sanovec |
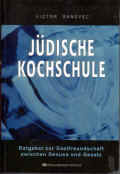 Victor
Sanovec: Jüdische Kochschule. Ratgeber zur Gastfreundschaft
zwischen Genuss und Gesetz. Victor
Sanovec: Jüdische Kochschule. Ratgeber zur Gastfreundschaft
zwischen Genuss und Gesetz.
14,95 €. 231 S. Gebr.
Kornmayer Verlag. ISBN 13: 879-3942051248.
Kurzbeschreibung: Diese Kochschule stellt das Essen der Juden als erlebbaren Teil ihrer Kultur und der langen Entwicklung des Judentums vor. Durch das Essen wurde in der Geschichte ein wichtiger Teil der jüdischen Identität bewahrt als ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und der Feste.
Es gibt nicht nur die eine jüdische Tradition, sondern es sind deren viele. Man erlebt sie besonders bei festlichen Einladungen und dafür bietet das jüdische Jahr genug Gelegenheit.
Die Auswahl der über 100 Speisevorschläge orientiert sich an dem was heute gegessen wird und an Waren die auch in normalen Geschäften angeboten werden. Es bietet den Juden und interessierten Nichtjuden eine Gelegenheit sich mit den jüdischen Essensregeln in der Gegenwart vertraut zu machen.
Um die Speisen gemäß der Jüdischen Speisegesetze zuordnen zu können tragen alle Rezepte im Buch eine entsprechende Bezeichnung. M für Milchig, F für Fleischig und P für Parewe aus Sicht der jüdischen Speisegesetze neutrale Speisen.
Über den Autor: Victor Sanovec, geboren: 1943 in Olmütz/Olomouc in Tschechien - seit
1968 in Deutschland - 1969 bis 1974: Kunststudium in Frankfurt - zahlreiche Ausstellungen - seit 2010: wieder in Frankfurt am
Main. "Nach meiner Ankunft in Deutschland und seit dem Anfang des Kunststudiums habe ich entdeckt, dass die Fähigkeiten meiner Sinne über das Sehen hinaus weiter ausbaubar sind. Deshalb habe ich angefangen, selbst zu kochen, weil ich nicht nur irgendetwas essen wollte, was satt macht, sondern es auch so zubereitet essen wollte, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Zugleich interessiert mich immer, wie es anderen dabei geht, wie sie das
machen. Was verbirgt sich dahinter, wenn Menschen einiges essen und anderes nicht? So wandelte sich bei mir die ursprüngliche Notwendigkeit, selber zu kochen, um überhaupt ordentlich essen zu können, zu einer schöpferischen Tätigkeit. Dabei habe ich Folgendes entdeckt: Schon die Tatsache, dass Menschen mit mir an demselben Tisch sitzen und bereit sind, dort auch die von mir gekochten Speisen ohne Vorbehalt zu essen, beglückt mich ganz einfach. Das wiegt den mit dem Akt des Kochens verbundenen Aufwand und die Arbeit mehrfach auf.."
|
| Hinweis: Victor Sanovec steht für
Lesungen aus seinem Buch für Interessierte gerne zur Verfügung - Kontakt
über Tel. 0170 - 1803685 |
| |
| Februar 2014
(Februar 2006): Erinnerungen von Alfred
Gottschalk an die Erlebnisse als jüdischer Junge in der NS-Zeit |
Artikel von Dirk Eberz in der
"Rhein-Zeitung" vom 15. Februar 2006: "Oberwesel: Am Wernertag bezogen jüdische Kinder Prügel
Oberwesel - Alfred Gottschalk ist gerade acht Jahre alt, als seine kleine Welt zusammenbricht. Im November 1938 wird der jüdische Junge in Oberwesel Zeuge der Reichspogromnacht. Er muss miterleben, wie braune Horden in den Straßen der Stadt wüten, die Synagoge am Schaarplatz schänden und die Thorarollen in den Oberbach werfen. Trotz aller Schikanen gelingt der Familie schließlich die Flucht in die USA..."
Link
zum Artikel |
Artikel von Dirk Eberz in der
"Rhein-Zeitung" vom 15. Februar 2006: "Neustart in New York ohne einen Cent: Alfred Gottschalk macht Karriere
Oberwesel/New York - "Von welcher Zeitung sind Sie?", fragt eine freundliche Stimme am Ende der Leitung. Von der RHZ hat Alfred Gottschalk noch nichts gehört. Wie sollte er auch: Der 75-Jährige hat seinen Geburtsort Oberwesel vor fast 70 Jahren verlassen müssen. Alfred Gottschalk ist Amerikaner - und stolz darauf. Nach den Schrecken der Nazi-Diktatur bietet ihm das Land eine neue Heimat. Das hat er nicht vergessen..."
Link
zum Artikel |
| |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 618-622; III,2 S.
1053-1055.
|
 | Doris Spormann: Die Synagogengemeinden in St. Goar
und Oberwesel im 19. und 20. Jahrhundert: Spuren landjüdischen
Gemeindelebens am Mittelrhein. - In: SACHOR. Beiträge zur jüdischen
Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von
Matthias Molitor und Hans Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der
Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag
Matthias Ess in Bad Kreuznach. 2. Jahrgang, Ausgabe 2/1992 Heft Nr. 3 S. 22-30. -
Ill. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt) |
 | dies.: Wie der Name Gerson in der Familie blieb. Fragmente
einer jüdischen Familienchronik in Perscheid und Oberwesel. In: SACHOR.
Beiträge zur jüdischen Geschichte in Rheinland-Pfalz (wie oben). 2. Jahrgang, Ausgabe
2/1992 Heft Nr. 3 S. 31-36. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | dies. / mit Willi Wagner: Oberwesel. In: Jüdisches
Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis / Hunsrücker Geschichtsverein. Christof Pies.
Hrsg. vom Hunsrücker Geschichtsverein. [Schriftenreihe des Hunsrücker
Geschichtsvereins Band 40]. Argenthal 2004. S. 148-163. - Ill. |
 | dies.: Das Mahnmal am Rhein. I. Christlich-jüdischer
Gottesdienst in der Ruine der Wernerkapelle in Bacharach am 8 Juni 1997. II.
Christlicher Antijudaismus am Beispiel des Wernerkultes.
In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 8. Jahrgang
Ausgabe 1/1998 Heft Nr. 15. S. 5-22. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 296-298 (mit weiteren Literaturangaben). |
 |
 Walter Karbach: Werner von Oberwesel.
Ritualmordlüge und Märtyrerkult. Über den "Guten Werner", bestattet 1287 zu
Bacharach. Mit einem Vorwort von Gerd Mentgen. 616 S. 89 Abb. ISBN
978-3-00-064849-6 Verlag Josef Karbach
Oberwesel Nachf., Trier 2020. 45,00 €. Walter Karbach: Werner von Oberwesel.
Ritualmordlüge und Märtyrerkult. Über den "Guten Werner", bestattet 1287 zu
Bacharach. Mit einem Vorwort von Gerd Mentgen. 616 S. 89 Abb. ISBN
978-3-00-064849-6 Verlag Josef Karbach
Oberwesel Nachf., Trier 2020. 45,00 €.
Informationsblatt des Verlages (eingestellt als pdf-Datei).
|
 | ders.: "Das antijüdische Ritualmordrelief von 1727 an der
Wernerkapelle von Oberwesel und seine widerwillige Entfernung 1970." In:
Aschkenas Band 30 Heft 1 2020. S. 37-60. Beitrag online zu erwerben:
https://www.degruyter.com/view/journals/asch/30/1/article-p37.xml
bzw. Anfrage an den Verfasser über
https://www.researchgate.net/publication/341665725_Das_antijudische_Ritualmordrelief_von_1727_an_der_Wernerkapelle_von_Oberwesel_und_seine_widerwillige_Entfernung_1970.
Abstract: This article describes a relief that was sculpted in 1727. The
relief depicts a Good Friday scene in 1287, when Jews allegedly tortured and
killed Werner of Oberwesel, who came to be venerated as a Christian saint.
Attached to the Oberwesel Werner Chapel, the relief was near the vault of
the chapel, where the ritualized murder of Werner supposedly took place.
After his burial in neighbouring Bacharach, hundreds of Jews were attacked
and murdered in Oberwesel, Boppard, as well as along the Rhine and Moselle
Rivers. This story contributed to the defamation of Jews for centuries. It
was, in fact, not until 1963 that the Diocese of Trier expunged Werner’s
memorial day from its liturgical calendar. This article also demonstrates
how the Nazis incorporated this relief into their anti-Semitic propaganda
campaigns and shows how the relief was part of traditional worship in the
area until it was reluctantly removed in 1970. |
 | ders.: Sacras autem reliquias. Über den Verbleib
der Gebeine des einstigen Bistumsheiligen Werner von Oberwesel († 1287).
Kleine Schriftenreihe Nr. 36. Verein für die Geschichte der Stadt Bacharach
und der Viertäler e. V.. Bacharach 2020. |
 | Walter Karbach / Doris Spormann: Die
Thorafetzen zusammensetzen. Auf den Spuren der Oberweseler Juden. Mit einem
Vorword von Avadislav Avadiev. Gefördert von der Kulturstiftung
Rheinland-Pfalz, der Stadt Oberwesel und dem Rhein-Hunsrück-Kreis. 598 S.,
294 Abb. Verlag Josef Karbach Oberwesel Nachf. Trier 2024. ISBN
978-3-00-07761-9 - € 26,00.
Informationen zum Buch siehe eingestellte pdf-Datei.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Oberwesel Rhineland. A
Jewish community was already in existence in the mid-13th century. Forty Jews
from Oberwesel and from neighboring Boppard were murdered in 1287 in riots
brought on by a blood libel in which Jews were accuded of murdering a Christian
youth before Easter. The community was again victimized in 1337 in the Armleder
massacres and in 1349 it was destroyed in the Black Death persecutions. Jews
were again present in the early 19th century, their population ranging from 30
to 55 until the Nazi period. In 1932, the Jewish population was 44. Eighteen
Jews perished in the Holocaust. The synagogue built in 1886 was wrecked on Kristallnacht
(9-10 November 1938).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|