|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Hessen"
Zur Übersicht "Jüdische
Friedhöfe in Frankfurt"
Frankfurt am Main
Jüdischer Friedhof Battonstraße (häufig auch unter
"Battonnstraße"; Börneplatz)
Übersicht:
- Vgl.
auch den Wikipedia-Artikel Jüdischer Friedhof Börneplatz
Zur Geschichte des Friedhofes
Battonstraße
Beim jüdischen Friedhof Battonstraße handelt es sich um den ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof in Frankfurt
und den nach Worms zweitältesten erhaltenen jüdischen Friedhof in Deutschland.
Die älteste - 1883 dokumentierte - Grabinschrift war vom Juli 1272. 1333 wurde der zunächst außerhalb der Stadt angelegte Friedhof in die Stadtmauern
eingeschlossen. Die letzte Beisetzung auf dem Friedhof war am 26. September 1828.
Nach Angaben vom Ende des 19. Jahrhunderts standen damals noch etwa 8.000
Grabsteine (siehe Berichten unten), nach Angaben zu Beginn des 20. Jahrhunderts
etwa 6.500 Grabsteine auf
dem 11.850 qm umfassenden Areal.
1943 fiel der Friedhof weitgehend der
nationalsozialistischen Zerstörungspolitik zum Opfer. Ein großer Teil der
Steine wurde mit Maschinen auf dem Friedhof zerschlagen. Die Steine sollten in
zur Wiederverwendung in Bruchsteinmauern geeignete Stücke zerschlagen werden. Nach 1945 wurde der
Friedhof - soweit möglich - wieder hergestellt. Entlang der Innenmauer wurden historisch
oder künstlerisch besonders wertvolle Steine wieder aufgestellt. Einer der
bekanntesten hier beerdigten Personen ist Mayer Amschel Rothschild.
Die Umfassungsmauer des Friedhofes dient heute auch dem Gedenken an die in der
NS-Zeit ermordeten jüdischen Personen aus Frankfurt. Es sind über 11.000
Namensteine angebracht.
Hinweis auf Führungen über den Friedhof. Tagesführungen über den
Friedhof finden regelmäßig statt;
Informationen unter www.juedischesmuseum.de.
Wer den Friedhof auf eigene Faust besuchen will, kann sich den Schlüssel für die Pforte im Museum Judengasse (Battonnstraße 47) abholen.
Beiträge zur Geschichte des Friedhofes
(aus jüdischen Periodika des 19./20. Jahrhunderts) -
Hinweis: die Beiträge
konnten noch nicht alle abgeschrieben werden - zum Lesen bitte die
Textabbildungen anklicken
Ein altes Gemälde zeigt einen Leichenzug vom alten Friedhof
im Jahr 1761 (Artikel von 1899)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni
1899: "Ein Leichenzug vom alten Friedhofe im Jahre 1761 in
Frankfurt am Main (Das Originalgemälde befindet sich in einer
Wandnische des jüdischen Hospitals).
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni
1899: "Ein Leichenzug vom alten Friedhofe im Jahre 1761 in
Frankfurt am Main (Das Originalgemälde befindet sich in einer
Wandnische des jüdischen Hospitals).
Mitten unter neuen Straßenzügen und Durchbrüchen hat sich die
Gedenkstätte der alten Frankfurter Gemeinde erhalten. Der im Jahre 1828
geschlossene, am südlichen Ende der ehemaligen Judengasse gelegene
jüdische Friedhof war seit Anfang des 13. Jahrhunderts in Benutzung.
Dieser Friedhof wurde schon 1316 als jüdischer 'Kirchhof ussenwendig der
Stadt' genannt (vgl. Horovitz, 'Frankfurter Rabbinen' S. S. IOX), bestand
also bei seiner Schließung länger als 500 Jahre. Schudt bemerkt in
seinen 'Jüdischen Merkwürdigkeiten' II, S. 362: 'unsere Frankfurter
Juden hatten ihren Kirchhoff vor alten Zeiten auf dem Garküchen Platz, in
welcher Gegend sie damahlen gewohnt und ihr Synagog gehabt, jetzo haben
sie darzu einen sehr großen mit Mauren beschlossenen Platz hinter der
Judengasse am Wollgraben, zwischen der Juden Mauer, stößet hinten auf
das Bollwerk des Fischerfeldes, und sind nach ihrer Art, gemeine rothe Steine,
etwa eines halben, auch wohl gantzen Mannes hoch, an den Gräbern, zu
Häupten des Todten, auffgerichtet, auf welchen des Verstorbenen Name,
Geschlecht, Lob und Alter samt Todt enthalten; Ohnerachtet nun ihr
Kirchhoff lang und breit genug ist, so haben sie doch An. 1694 |
 den
19. Juni dazu erkaufft den Völckerischon Bleich-Garten hinter der
Juden-Mauer, um dardurch ihren Kirchhoff zu erweitern, welches letzter
aber nachgeblieben, und sie disen, insgemein den Juden-Bleichgarten,
genannten Garten zu ihrem bleichen behalten, biß sie An. 1713 die fünff
große Backöfen und über dieseligen Wohnungen gestanden haben.' Diese
wenigen Worte geben uns in Kürze die Entstehungsgeschichte dieses
Friedhofs, dessen ältester Denkstein aus den Jahren 1272 stammt, (vgl.
Horovitz das. S. 92) und der, ein Wahrzeichen aus alter Zeit in die
Gegenwart hineinragend, uns erzählt von der großen Vergangenheit der
alten Frankfurter Gemeinde, von den Männern, die hier gelebt und gewirkt,
und deren Wort weithin gehört und als maßhebend geachtet
wurde. den
19. Juni dazu erkaufft den Völckerischon Bleich-Garten hinter der
Juden-Mauer, um dardurch ihren Kirchhoff zu erweitern, welches letzter
aber nachgeblieben, und sie disen, insgemein den Juden-Bleichgarten,
genannten Garten zu ihrem bleichen behalten, biß sie An. 1713 die fünff
große Backöfen und über dieseligen Wohnungen gestanden haben.' Diese
wenigen Worte geben uns in Kürze die Entstehungsgeschichte dieses
Friedhofs, dessen ältester Denkstein aus den Jahren 1272 stammt, (vgl.
Horovitz das. S. 92) und der, ein Wahrzeichen aus alter Zeit in die
Gegenwart hineinragend, uns erzählt von der großen Vergangenheit der
alten Frankfurter Gemeinde, von den Männern, die hier gelebt und gewirkt,
und deren Wort weithin gehört und als maßhebend geachtet
wurde.
Das Bild, das unsere heutige Nummer bringt, lässt uns in das Innere des
Frieshofs einen Blick werfen. Die heilige Brüderschaft der Kabronim hat
den Sarg der Brüderschaft der Gemiluth-Chassodim am Eingang abgenommen,
um dem dahingeschiedenen Glaubensgenossen den letzten Liebesdienst zu
erweisen, in langem Zuge folgen Freunde und Verwandte. Es sind nicht
bezahlte Totengräber und Leichenbestatter, es sind die angesehensten und
wohlhabendsten Männer der Gemeinde, die mit großen Opfern an materiellem
Aufwand und persönlicher Hingabe die Ehrenpflicht hier ausüben zu
dürfen, sich erwerben. Denn eine Ehre war es, in eine dieser
Brüderschaften aufgenommen zu werden; vor allem war ein frommer,
fleckenloser Lebenswandel die Vorbedingung für die Zulassung zu diesen
Vereinigungen. Das Innere des Friedhofs ist sehr einfach, Steine, nur Steine,
Pomp und Luxus liebte man nicht, das Grab des Reichen sollte nicht vor dem
des Armen in prunkhafter Ausstattung sich hervortun; das Einzige, was man
sich erlaubte, war, der Gelehrsamkeit die Huldigung zu erwiesen, dass man
für die Grabsteine der Gelehrten ein höheres Maß als für die anderen
gestattete. Am Auffallendsten wird es für den Uneingeweihten erscheinen,
dass der Zeichner ein Tier auf dem Friedhof umherlaufen lässt. Es ist
dies ein 'Bechor', ein Erstgeborenes, das von dem Eigentümer nicht
genutzt werden darf, es kam nicht selten vor, dass ein Kohen morgens ein
munteres Rindchen vor seiner Tür angebunden fand, dieser schickte es dann
auf den Friedhof, wo es graste, bis es entweder starb oder von einem
Gebrechen befallen wurde, das es, während der Tempel noch stand, für die
Opferung untauglich gemacht hätte, worauf es dann dem 'Kohen' zum Genuss
gestattet war. Über die Mauer hinaus erhebt sich ein dreistöckiges Haus,
das ist das alte Gemeinde-Hospital, höchst einfach, bei dem natürlich
von einer Anlage nach hygienischen Grundsätzen keine Rede sein konnte;
doch war man, wenn man in dasselbe eintrat, über die peinliche Sauberkeit,
die dort herrschte, überrascht, und die Sorgfalt, welche die Kranken,
deren es zwar nie viele dort gab, gewidmet wurde, war eine solche, wie sie
heute, abgesehen von den medizinischen und hygienischen Verhältnissen der
Neuzeit, nicht besser sein kann. Als die Familie Königswarter vor nunmehr
zwanzig Jahren der Gemeinde ein neues Krankenhaus in der Außenstadt
errichtete, wurde dieses alte außer Tätigkeit gesetzt, und bald musste
es der an dieser Stelle errichteten neuen Gemeindesynagoge den Platz
räumen." |
Der "Holzverein" sucht einen Platz für sein Magazin
- auf dem Friedhof gibt es jedoch Schwierigkeiten
(1844)
Anmerkung: der Abschnitt ist leicht abgekürzt wiedergegeben; einige
hebräische Wendungen blieben unübersetzt; Hinweise zur korrekten Wiedergabe
bitte an den Webmaster, Adresse siehe Eingangsseite.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 14. Mai
1844: "Frankfurt am Main, 3. Mai (1844). Herr
Kirchheim ist wieder bis auf Weiteres mit den hiesigen Orthodoxen
überworfen. Das ist denn aber auch ein wunderliches, unerträgliches und
unverträgliches Volk, mit dem nicht leicht ein Bündnis zu schließen
ist. Lassen Sie sich die Geschichte in Kürze erzählen, sie ist
charakteristisch! Seit vielen Jahren hatte der hiesige Verein zur
Verteilung von Brennholz unter den israelitischen Armen sein Magazin auf
einem der israelitischen Gemeinde angehörenden Platze und zahlte dafür,
bloß um der Gemeinde das Eigentumsrecht zu reservieren, einen
unbedeutenden Mietpreis. Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 14. Mai
1844: "Frankfurt am Main, 3. Mai (1844). Herr
Kirchheim ist wieder bis auf Weiteres mit den hiesigen Orthodoxen
überworfen. Das ist denn aber auch ein wunderliches, unerträgliches und
unverträgliches Volk, mit dem nicht leicht ein Bündnis zu schließen
ist. Lassen Sie sich die Geschichte in Kürze erzählen, sie ist
charakteristisch! Seit vielen Jahren hatte der hiesige Verein zur
Verteilung von Brennholz unter den israelitischen Armen sein Magazin auf
einem der israelitischen Gemeinde angehörenden Platze und zahlte dafür,
bloß um der Gemeinde das Eigentumsrecht zu reservieren, einen
unbedeutenden Mietpreis.
Durch den Bau des neuen Schul- und Gemeindehauses sah sich nun der
Vorstand genötigt, dem Verein den Platz zu kündigen. Die Herren
Raphael Kirchheim und Jakob Baß, die zwei tätigsten Mitglieder der
Verwaltung des 'Holzvereins', hatten nun die schwierige Aufgabe, einen
anderen Platz für das Magazin aufzutreiben, der 1) geräumig genug, 2)
sicher gegen Entwendung, 3) nahe genug an der Stadt sei, um den Armen das
Holz durch die sehr wohlfeilen Stadtfuhren ('Einzelner') ans Haus führen
zu können und nicht zu den äußerst kostspieligen Extrafuhren seine
Zuflucht nehmen zu müssen - und der endlich 4) keine Kräfte des Vereins
übersteigenden Mietpreis koste. Letzteres war nun eine ebenso schwierige
als unerlässliche Bedingung, da ein ähnlicher Platz hier nicht wohl
unter 40-50 Karolin jährlich zu haben ist, die jährlich Einnahme des
Vereins jedoch nicht 1.200 Gulden übersteigen. Die Herren Kirchheim und
Baß wendeten sich an den Vorstand und baten um Zuweisung eines
neuen Platzes. Der Vorstand bot darauf dem Verein einen alle
erforderlichen Requisiten in sich vereinigenden Platz innerhalb der
Ringmauer des ehemaligen - seit 1828 geschlossenen - Friedhofes
an, und zwar zunächst dem Eingange, an dem Orte, so sonst die Bachurim
(das erstgeborene männliche Rind- und Kleinvieh) eingescharrt wurden. Die
nötigen Zurüstungen, Umzäunungen etc. erbot sich der Vorstand, auf
Gemeindekosten vornehmen zu lassen. Das Anerbieten wurde sofort akzeptiert
und auch von Seiten des Vorstandes waren die nötigen Vorkehrungen bereits
getroffen, als auf einmal sich ein Zetergeschrei über Entweihung der
Gräber (?) erhob und sofort etwa 20 Mitglieder erklärten, sie würden -
nicht etwa auf ihre Kosten einen anderen Platz mieten, was
sie, als sehr reiche Leute, wohl tun könnten - sondern sie würden, wenn
das Magazin auf den ehemaligen Gottesacker verlege, die Armen dafür
bestrafen, indem sie ihre Beiträge nicht ferner zahlten. Dass auf
dem Platze keine Gräber von Menschen sind; dass die Möglichkeit,
es könne einmal hier ein Mensch beerdigt worden sein, auch fast
ebenso von einem andern Platze angenommen werden könnte, dass das
Verbot nur vom Grabe, also von dessen innerer Höhle, nicht
aber von dem Raum über demselben gilt; dass man zu Gunsten der Bedürfnisse
Vieler und dem Bedürfnis der Befolgung eines religiösen Gebotes
in der rabbinischen Praxis für die Gesamtheit entscheidet; dass
überhaupt das Sorgen für Zedaka als hohes Bedürfnis zu betrachten ist,
auf welche ein solches Verbot gar keine Anwendung leidet - alle diese
Gründe reichten nicht hin, um den Eifer einiger Laien... zu
beschwichtigen - und was den nur noch mit Einem Fuße im Rabbinat
stehenden Herrn Trier betrifft, so würde Herr Kirchheim ihm wohl
gerne die Frage unterbreitet haben, wenn er nicht, um Interesse der Armen,
die bekannte Maxime des Herrn Trier gefürchtet hätte, wonach dieser
geistliche Herr, um sich die Mühe einer kasuistischen Untersuchung zu
ersparen...
So stehen die Sachen jetzt; auf die Reis, Zucker, Reform- und
Beschneidungsfragen ist jetzt eine Holzfrage gefolgt, in welcher
nun auch einmal die Ultraorthodoxen die Heiligkeit der Gräber bis zu
deren subtilsten Konsequenzen aufrecht erhalten wissen wollen, nachdem die
Koryphäen derselben Partei erst kürzlich bei Gelegenheit des Tumults auf
dem Friedhofe zu Breslau diese nämliche Heiligkeit in Abrede gestellt
haben - weil es eben damals so dienlich war und auch das Recht des lieben
Schulchan Aruch eine wächserne Nase (?) zu haben scheint. Also die 'Holzfrage!.
Die Verwaltung des 'Holzvereins' hat nun in ihrer neuesten Plenarsitzung ihren
sämtlichen Mitgliedern zur Pflicht gemacht, sich binnen 14 Tagen um einen
anderen Platz umzusehen, der die erforderlichen Eigenschaften hätte und -
nicht mehr als 200 fl. jährlicher Miete koste! Was man nicht Alles suchen
muss, wenn man Vorsteher eines Vereins ist! Ob sich aber hier der
neutestamentliche Spruch 'Suchet, so werdet ihr finden': bewähren wird,
ist mehr als zweifelhaft - und dennoch ist es noch weit eher möglich, als
dass unsere starrfrommen ungebildeten Volksgenossen sich eines
Besseren belehren lassen." |
Über den alten israelitischen Friedhof (Beitrag von
1883)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 17. April 1883: "Der alte Friedhof der israelitischen
Gemeinde zu Frankfurt am Main. Herr Direktor Dr. Baerwald hat
dem diesjährigen Programm der Real- und Volksschule der israelitischen
Gemeinde (Philanthropie), die, beiläufig bemerkt, 850 Zöglinge zählt,
eine Abhandlung über den alten Friedhof der Gemeinde vorangeschickt, die
vieles Bemerkenswerte enthält. Dieselbe beginn: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 17. April 1883: "Der alte Friedhof der israelitischen
Gemeinde zu Frankfurt am Main. Herr Direktor Dr. Baerwald hat
dem diesjährigen Programm der Real- und Volksschule der israelitischen
Gemeinde (Philanthropie), die, beiläufig bemerkt, 850 Zöglinge zählt,
eine Abhandlung über den alten Friedhof der Gemeinde vorangeschickt, die
vieles Bemerkenswerte enthält. Dieselbe beginn:
'Von den Festern der Nordseite unseres Schulhauses überblickt man ein
weithin sich erstreckendes, fast baumloses Feld. Zwischen dichtem Gestrüpp
und niedrigem Gebüsch ragen aus dem unebenen Boden Tausende von senkrecht
in das Erdreich eingelassenen breiten, massiven Tafeln von rotem Sandstein
hervor. Die meisten sind tief in den Boden eingesunken, verwittert,
fahlgrün, mit Moos bedeckt; alle tragen auf der einen breiten Vorderseite
Inschriften, durchweg in hebräischer Quadratschrift. Während nach der
Ostseite zu die Steine massenhaft sich erheben, mindert sich ihre Zahl
nach Westen zu, wo sie, hier vereinzelt, dort in Gruppen hervortauchend,
von hügeligen Grasflächen umgeben sind. Der weite, von einer hohen
Mauer, von der Rückseite und den Höfen belebter Straßen umschlossene
Raum ist ein Bild völliger Abgeschiedenheit. Von keiner Seite der ihn
umgebenden Straßen zugänglich oder nur sichtbar, ist er nicht bloß den
Hunderten von Menschen, die sich täglich in seiner nächsten Nähe
geschäftig bewegen, verborgen, sondern wohl auch den meisten Bewohnern
dieser Stadt unbekannt; nur wenige haben ihn je betreten. Und doch ist es
eine geweihte, geschichtlich merkwürdige Stätte: der alte Friedhof der
israelitischen Gemeinde zu Frankfurt am Main. Vor länger als 54 Jahren,
am 26. September 1828, fand auf demselben die letzte Beerdigung statt;
seitdem ist er geschlossen. Von Jahr zu Jahr mindert sich die Zahl
derjenigen, welche, von Pietät getrieben, sich die Pforte dieses
Friedhofes öffnen lassen, um eine ihnen teure Grabstätte zu besuchen;
nicht lange, und es wird niemand mehr vorhanden sein, der einen der dort
Ruhenden noch mit eigenen Augen gesehen hat. Da war es denn an der Zeit,
bevor die Steine gänzlich verwittern und die auf ihnen eingegrabene Schrift
völlig unleserlich wird, gleichsam ein Inventarium aufzunehmen, die
Steine zu zählen und mit Nummern zu versehen, die Inschriften, soweit sie
noch leserlich sind, abzuschreiben und in einem Archiv aufzubewahren. Das
ist im letzten Jahre geschehen. Vor mir liegen die Abschriften von nahezu
siebentausend Grabschriften.' - Die hierzu erforderlichen Arbeiten wurden
besonders durch den Rabbiner Dr. Horovitz gefördert. Die älteste
Inschrift datiert aus dem Monat ab 5032, d.i. vom Juli 1272. Geschlossen
wurde der Friedhof 1828 und zugleich bestimmt, dass er 1000 Jahre
unberührt und unbesetzt liegen solle. Allerdings ist es sicher, dass die
jüdische Gemeinde schon früher einen anderen Friedhof besessen hat. Die
Schicksale der hier in Rede stehenden sucht der Verfasser zusammenzustellen.
Wurde er ja doch mehrere Male bei |
 Belagerungen
in den Kreis der Verteidigungsposten gezogen, mit Kriegsknechten besetzt,
und die Mauern mit Erkern versehen. Wer keine Kenntnis von den
Steuerlasten hat, unter welchen die mittelalterlichen Juden seufzten, die
bald vom Kaiser und Reich, bald von Erzbischöfen und Feudalherren, bald
von den städtischen Behörden ausgesogen wurden, sodass die Juden darob
in die größten Verlegenheiten und Bedrängnisse gerieten, kann sich von
dem S. 7 berichteten darüber unterrichten lassen. Die Gemeinde war
genötigt zur Bestreitung der geforderten Abgaben ihren Friedhof, ihre
Synagoge und andere Grundstücke zu verpfänden und zwar bei christlichen
Mitbürgern (1316). Man sieht also, dass der den Juden zugeschriebene
Reichtum nicht vorhanden war; der wahre Reichtum bestand nur in ihrer
Geschäftsgewandtheit. Mit der Zeit lösten sie die verpfändeten
Grundstücke wieder ein. - Eine solche Sammlung von Grabschriften aus
beinahe sechs Jahrhunderten hat einen vielfach geschichtlichen Wert. Die
bildende Kunst geht dabei allerdings leer aus. Der Verfasser sagt
hierüber: Belagerungen
in den Kreis der Verteidigungsposten gezogen, mit Kriegsknechten besetzt,
und die Mauern mit Erkern versehen. Wer keine Kenntnis von den
Steuerlasten hat, unter welchen die mittelalterlichen Juden seufzten, die
bald vom Kaiser und Reich, bald von Erzbischöfen und Feudalherren, bald
von den städtischen Behörden ausgesogen wurden, sodass die Juden darob
in die größten Verlegenheiten und Bedrängnisse gerieten, kann sich von
dem S. 7 berichteten darüber unterrichten lassen. Die Gemeinde war
genötigt zur Bestreitung der geforderten Abgaben ihren Friedhof, ihre
Synagoge und andere Grundstücke zu verpfänden und zwar bei christlichen
Mitbürgern (1316). Man sieht also, dass der den Juden zugeschriebene
Reichtum nicht vorhanden war; der wahre Reichtum bestand nur in ihrer
Geschäftsgewandtheit. Mit der Zeit lösten sie die verpfändeten
Grundstücke wieder ein. - Eine solche Sammlung von Grabschriften aus
beinahe sechs Jahrhunderten hat einen vielfach geschichtlichen Wert. Die
bildende Kunst geht dabei allerdings leer aus. Der Verfasser sagt
hierüber:
'Umso eingehendere Beachtung wird darum der Form und dem Inhalte der
Inschriften zu widmen sein. Als Denkmäler der Schrift und Sprache bieten
sie für Entwicklung beider dem Forscher das chronologisch am besten
beglaubigte Material, bei weitem am wichtigsten aber werden sie durch den
Einblick, den sie in die Sitten- und die Lebensanschauung der Juden
gewähren, Materien, über welche die mittelalterlichen Chronisten gar nichts
oder nur Missverstandes berichten.
Der Tod versöhnt, mit den Toten sind wir nur durch die Liebe vereint, am
Grabe spricht die Pietät. Und doch charakterisiert sich der Einzelne wie
die Gesamtheit durch die Vorstellungen von dem Jenseits, durch die Art,
wie er über diejenigen, die ihm vorhergegangen sind, denkt und sich
äußert. Was wir von dem Toten als rühmenswert hervorheben, muss uns
doch selbst erstrebenswert erscheinen; in dem Bilde, in dem wir das Ergebnis
seines Leben zusammenfassen, zeichnen wir unser Ideal: so möchten wir
selbst sein, wie wir nun in erhöhter Liebe uns den Heimgegangenen denken,
so möchten wir in unserer Sphäre wirken, wie wir uns den Heimgegangenen
in seinem einstigen Wirkungskreise
vorstellen.
Wie redeten nun die mittelalterlichen Juden von den Toten? wie dachten sie
von dem Jenseits` welche Ideale vom Menschen schwebten ihnen vor? Die
Grabschriften belehren uns darüber.
Der Tote heißt 'der Ruhende', sein Name wird niemals genannt, ohne dass
hinzugefügt wäre: 'Über ihn der Friede!' oder 'Sein Andenken zum
Segen', oder 'Das Andenken des Gerechten zum Segen'. - Formeln, mit denen
die Grabschriften schließen, sind: 'Seine Seele sei dem Lebensbunde
einverleibt', oder 'Seine Seele im Garten Eden. Amen, Sela', oder 'Seine
Seele sei dem Lebensbunde einverleibt mit den andern Seelen der Gerechten
im Garten Eden. Amen, Sela'.
Von den Eltern spricht der Sohn nie anders als 'mein Herr Vater, mein
Lehrer', 'meine Mutter, meine Lehrerin', oder 'meine Mutter, meine
Lehrerin, Heil der, der sie geboren.'
Eine edle Frau, jung an Jahren all ihr Tun anmutend, herrlich wie eine
Königstochter im Prunkgemacht, ihre Hand streckte sie entgegen den
Armen.' 'Sie redete zu Jedermann sanft und demütig'. 'Sie war ehrbar,
edel, lieblich in ihrem Walten wie eine Rose.' 'Sie war
gottesfürchtig von Jugend auf im Hause ihres Vaters, sie liebte den
Frieden, leitete ihre Kinder den geraden Weg.' 'Sie war bemüht zu
schaffen für die Bedürfnisse ihres Hauses, zu ehren ihren Gatten zur
Zeit seines Alters.' 'Sie erzog mit Aufwand aller Kraft ihre Kinder für
das Studium der Tora, in ihren kaufmännischen Geschäften waltete sie mit
Treue, viele Schmerzen waren ihr beschieden in schweren Stunden, alles hat
sie ertragen in Liebe'. 'Sie pflegte Kranke, erwies den Toten die letzten
Liebesdienste'. 'Sie sorgte für Beleuchtung des Gotteshauses.' 'Ihr
Gebet war mit Andacht, sie übte Werke der Mildtätigkeit, besonders an
der studierenden Jugend.'
'Hier ruht ein Mann, der war schlicht und gerade, er wich vom Bösen und
tat Gutes. Von Jugend auf verachtete er die Nichtigkeiten der Welt und
ihre Vergnügungen und wählte das Gute und beschäftigte sich mit der
Tora und mit profaner Wissenschaft; er war ein geübter Gesetzeskundiger,
vieler Sprachen kundig und weltlicher Dinge. In seiner Juden schon setzte
er sich Zeiten fest für Torastudium, in seinem Geschäfte waltete er mit
Treue, ihm war ein reines Herz zu beten mit Andacht, er machte milde
Stiftungen, übte Werke der Barmherzigkeit.' 'Er ehrte Vater und
Mutter'. ' Er hat Fremde in sein gastliches Haus genommen und sie
mit freundlichem Blick empfangen.' 'Redlich und gerade hat er getan
nach dem Wort: Du sollst darüber sinnen Tag und Nacht.' 'Er hat
unser hiesiges Lehrhaus gegründet.' 'Er hat Waisenkinder erzogen
und ihnen einen häuslichen Herd gegründet'. 'Unrecht ward nicht gefunden
auf seinen Lippen'. 'Er gehörte zur heiligen Vereinigung für
Krankenpflege und Leichenbestattung'. 'Er wandelte untadelig und übte
Recht, war täglich einer der zehn Ersten im Gotteshause, ein treuer Hirt
war er unserer Gemeinde drei und dreißig Jahre, er strebte nach Wahrheit
und Frieden, er gehörte zu denen, die zwei Kaisern die Geschenke unserer
Gemeinde darbrachten'. 'Ein Greis, der sich Wahrheit erworben. Heil
der, die ihn geboren, er hat sein Alter nicht beschämt. Er lernte und
lehrte.' |
 'Ihm
ist Schweigen Lob; denn so hat er angeordnet vor seinem Tode, dass man
kein Lob auf seinen Grabstein schreibe.' 'Ihm
ist Schweigen Lob; denn so hat er angeordnet vor seinem Tode, dass man
kein Lob auf seinen Grabstein schreibe.'
Wer von den mittelalterlichen Annalen, in denen die gegen die Juden und
ihre Religion erhobenen Beschuldigungen und Verfolgungen aufgezeichnet
sind, sich abwendend, sich mit den Schriften der gleichzeitigen jüdischen
Gesetzeslehrer, Philosophen und Dichter bekannt macht, wird ergriffen von
der schlichten Festigkeit, der der die Juden unter allen Umständen
unbeirrt dem Idealen zugewandt blieben. Mit der gleichen Empfindung wird
jeder, der mit der äu0eren Geschichte der Juden bis zum Anfange unseres
Jahrhunderts bekannt ist, die Grabschriften des hiesigen alten
israelitischen Friedhofes lesen.'
Der Verfasser teilt in einem Anhange mehrere den Friedhof betreffende
Urkunden und dann drei Grabinschriften mit. Wir geben hier die älteste
aller Grabinschriften vom Juli 1272 wieder: (hebräisch und deutsch:) Ich
bin errichtet als Denkstein zu Häupten der geehrten Frau Channah Tochter
des Herrn Alexander . . . die gestorben ist . . . Ab [Monatsname = Aw]
des Jahres 5032 in der Zahl. Ihre Seele weile im Garten Eden. Amen! Selah!" |
Publikation von Rabbiner Dr. Markus Horovitz zu den Inschriften des alten Friedhofes
(1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August
1901: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August
1901: |
 |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August
1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August
1901: |
Aufruf zur Unterstützung der Erhaltung und einer
Dokumentation des alten Friedhofes
(1904)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27.
Oktober 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27.
Oktober 1904: |
Planungen zur Dokumentation und weiterer Arbeiten am alten
israelitischen Friedhof (1904)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28.
Oktober 1904:
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28.
Oktober 1904: |
 |
Publikation zum alten jüdischen Friedhof
(1913)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. September 1913: "Frankfurt am Main, 29. August
(1913). Der hiesige alte jüdische Friedhof, der urkundlich seit dem Jahre
1250 als Begräbnisstätte diente und ununterbrochen bis 1825 in Benutzung
war, ist eines der ältesten Frankfurter Kultur- und Kunstdenkmäler.
Achttausend Grabsteine aus sechs Jahrhunderten liegen zutage, Tausende
sind im Erdreich begraben. Sie zeigen in fortlaufender Reihe alle
Stilarten von der ältesten romanischen bis zur Biedermeierzeit. Diese
Grabsteine haben eine große Bedeutung für die Geschichte des Judentums
in Frankfurt und haben deshalb bereits durch Rabbiner Dr. Horowitz eine
Beschreibung gefunden, doch sind hier die Inschriften nur in hebräischer
Sprache wiedergegeben. Nun wird aber, wie Professor Hülfen bei einer
Führung des Kunstgewerbevereins 'Schnörkel' durch den alten jüdischen
Friedhof mitteilte, in einigen Monaten der erste Band einer neuen
Publikation über den Friedhof erscheinen, die auch die deutsche
Übersetzung der Grabinschriften enthalten wird. Die Herausgabe erfolgt
durch ein Komitee, das sich vor vierzehn Jahren unter dem Vorsitz von
Rafael Kirchheim zur Erhaltung des jüdischen Friedhofs am Börneplatz
gebildet und bereits viel für die Wiederherstellung beschädigter Steine
getan und auch die Registrierung der sämtlichen Denkmäler durchgeführt
hat. Es wird das Memorbuch bearbeitet, in dem alle Daten über die
Grabsteine enthalten sind und auch sonstige Aufzeichnungen von allgemeinem
historischen Interesse. Da auch meist die Todesarten der Verstorbenen
angegeben sind, wird das Werk auch für die medizinische Wissenschaft von
Interesse sein." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. September 1913: "Frankfurt am Main, 29. August
(1913). Der hiesige alte jüdische Friedhof, der urkundlich seit dem Jahre
1250 als Begräbnisstätte diente und ununterbrochen bis 1825 in Benutzung
war, ist eines der ältesten Frankfurter Kultur- und Kunstdenkmäler.
Achttausend Grabsteine aus sechs Jahrhunderten liegen zutage, Tausende
sind im Erdreich begraben. Sie zeigen in fortlaufender Reihe alle
Stilarten von der ältesten romanischen bis zur Biedermeierzeit. Diese
Grabsteine haben eine große Bedeutung für die Geschichte des Judentums
in Frankfurt und haben deshalb bereits durch Rabbiner Dr. Horowitz eine
Beschreibung gefunden, doch sind hier die Inschriften nur in hebräischer
Sprache wiedergegeben. Nun wird aber, wie Professor Hülfen bei einer
Führung des Kunstgewerbevereins 'Schnörkel' durch den alten jüdischen
Friedhof mitteilte, in einigen Monaten der erste Band einer neuen
Publikation über den Friedhof erscheinen, die auch die deutsche
Übersetzung der Grabinschriften enthalten wird. Die Herausgabe erfolgt
durch ein Komitee, das sich vor vierzehn Jahren unter dem Vorsitz von
Rafael Kirchheim zur Erhaltung des jüdischen Friedhofs am Börneplatz
gebildet und bereits viel für die Wiederherstellung beschädigter Steine
getan und auch die Registrierung der sämtlichen Denkmäler durchgeführt
hat. Es wird das Memorbuch bearbeitet, in dem alle Daten über die
Grabsteine enthalten sind und auch sonstige Aufzeichnungen von allgemeinem
historischen Interesse. Da auch meist die Todesarten der Verstorbenen
angegeben sind, wird das Werk auch für die medizinische Wissenschaft von
Interesse sein." |
Publikation mit Foto des alten jüdischen Friedhof
(1924)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18.
Dezember 1924: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18.
Dezember 1924: |
 |
Über den alten israelitischen Friedhof
(1932)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni
1932: "Der alte Judenfriedhof in Frankfurt Zeuge jüdischen
Martyriums. Als Professor Dr. Julius Hülsen im September 1031
gestorben war, beschloss der Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu
Frankfurt am Main, das Andenken des Gelehrten, eines der besten Kenner der
jüdischen Vergangenheit, durch Herausgabe eines seiner Vorträge zu
ehren. Die Wahl fiel auf ein Thema, das von Prof. Hülsen mit Vorliebe
behandelt worden ist; den alten Frankfurter Judenfriedhof. Der mit 13
Abbildungen versehenen Broschüre ist zu entnehmen: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni
1932: "Der alte Judenfriedhof in Frankfurt Zeuge jüdischen
Martyriums. Als Professor Dr. Julius Hülsen im September 1031
gestorben war, beschloss der Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu
Frankfurt am Main, das Andenken des Gelehrten, eines der besten Kenner der
jüdischen Vergangenheit, durch Herausgabe eines seiner Vorträge zu
ehren. Die Wahl fiel auf ein Thema, das von Prof. Hülsen mit Vorliebe
behandelt worden ist; den alten Frankfurter Judenfriedhof. Der mit 13
Abbildungen versehenen Broschüre ist zu entnehmen:
Es gibt nun in Frankfurt ein in seiner räumlichen Ausdehnung nicht zu
übersehendes Kultur- und Kunstdenkmal, einzigartig unter seinesgleichen,
umwoben von vielhundertjährigen schicksalsreichen Erinnerungen,
ausgezeichnet durch die vollende Harmonie im ganzen und durch
künstlerische Einzelheiten - es ist der alte Judenfriedhof am
Börneplatz. Hinter der altersgrauen, unscheinbaren Bruchsteinmauer
erstreckt sich ein weit ausgedehntes, hügelig gewelltes Gebiet, auf dem
etwa 7000 Grabsteine sich erheben. Sie sind bedeckt mit hebräischen
|
 Inschriften
und geschmückt mit flach gemeißelten Ornamenten. Welche Fülle von
geschichtlichen Erinnerungen, die gleichlaufend sind mit den
wechselvollen, oft tief tragischen Schicksalen des benachbarten
Alt-Frankfurter Ghettos, haften an dieser Stätten; die vielen
Beschränkungen, die der alten Judengasse auferlegt waren, haben auch hier
ihren Ausdruck gefunden. Als der Friedhof überall mit Gräbern besetzt
war, gab es kein anderes Mittel, als sein Gelände durch Erdaufschüttung künstlich
zu erhöhen und in dieser neuen Schicht weiter zu beerdigen, ein
Verfahren, das im Laufe der Jahrhunderte mehrmals wiederholt wurde. Die
alten Grabsteine der unteren Schichten wurden dabei immer wieder mit in
die Höhe genommen, um fernerhin die Namen der früher Bestatteten und die
Stelle ihres Grabes mit Sicherheit feststellen zu können, und dieser
pietätvolle Brauch hat dem Friedhof seine heute noch bestehende,
unangetastete, einzigartige Signatur verliehen. Alle Steine stehen hinter
und nebeneinander dicht gedrängt gemeinsam auf demselben grünen Plan,
gleichsam ein ganzer Wald von Steinen mit Dickichten und Lichtungen - ein
'Ghetto der Toten'. Inschriften
und geschmückt mit flach gemeißelten Ornamenten. Welche Fülle von
geschichtlichen Erinnerungen, die gleichlaufend sind mit den
wechselvollen, oft tief tragischen Schicksalen des benachbarten
Alt-Frankfurter Ghettos, haften an dieser Stätten; die vielen
Beschränkungen, die der alten Judengasse auferlegt waren, haben auch hier
ihren Ausdruck gefunden. Als der Friedhof überall mit Gräbern besetzt
war, gab es kein anderes Mittel, als sein Gelände durch Erdaufschüttung künstlich
zu erhöhen und in dieser neuen Schicht weiter zu beerdigen, ein
Verfahren, das im Laufe der Jahrhunderte mehrmals wiederholt wurde. Die
alten Grabsteine der unteren Schichten wurden dabei immer wieder mit in
die Höhe genommen, um fernerhin die Namen der früher Bestatteten und die
Stelle ihres Grabes mit Sicherheit feststellen zu können, und dieser
pietätvolle Brauch hat dem Friedhof seine heute noch bestehende,
unangetastete, einzigartige Signatur verliehen. Alle Steine stehen hinter
und nebeneinander dicht gedrängt gemeinsam auf demselben grünen Plan,
gleichsam ein ganzer Wald von Steinen mit Dickichten und Lichtungen - ein
'Ghetto der Toten'.
Die ältesten über dem Boden befindlichen Steine stammen nachweislich aus
dem Jahre 1272. Damals bestand noch kein Ghetto; in dieses mussten die
Frankfurter Juden erst 1462 einziehen. Die älteste Geschichte der
Frankfurter Juden ist in Dunkel gehüllt. Sie beginnt dokumentarisch
eigentlich erst kurz vor 1241, dem Jahre der ersten Judenschlacht, in der
fast alle Einwohner des Judenviertels am Dom, bis auf wenige, die
entkamen, den Tod erlitten. Nachweisloch wohnten schon im viertel
Jahrhundert Juden in Deutschland, und die Gemeinden von Köln, Mainz,
Speyer, Worms, Würzburg, Regensburg, Erfurt zum Beispiel blicken auf ein
hohes Alter zurück. Es sind nicht zwingende Gründe, die dagegen sprechen
würden, dass auch schon etwa in karolingischer Zeit Juden in Frankfurt
ansässig waren, ja dass auch damals schon der alte Friedhof an derselben Stelle
in Benutzung stand. Die ältesten Steine aus dieser frühen Zeit würden
alsdann in der untersten, jetzt nicht mehr erreichbaren Schicht tief unter
dem heutigen Gelände begraben sein. Da dieser Friedhof im Jahre 1828
geschlossen wurde, so hat er, wenn man das Datum des ältesten über der
Erde stehenden Steins (1272) in Betracht zieht, mindestens 656 Jahre
seinem Zwecke gedient.
Hunert Jahre nach der ersten Judenmetzelei von 1241 brach im Jahr 1349 die
zweite furchtbare Katastrophe über die Frankfurter Judenheit herein.
Wiederum wurden sie fast alle getötet, und die Erde nahm barmherzig die
Erschlagenen auf. Im östlichen Teile liegt der Hügel der Märtyrer, wie
er in den späteren Beerdigungsregistern noch genannt wird; dort liegen
alle beisammen, die im Laufe der Jahrhunderte für ihren Glauben lieber
alle Martern und den Todesstreich erlitten, als durch feige Fahnenflucht
die äußere Freiheit zu erkaufen. Das Studium der Inschriften der
Grabsteine stößt auf mancherlei Schwierigkeiten. Da sie in hebräischer
Sprache eingemeißelt sind und Abkürzungen enthalten, so wird nur ein
gründlicher Kenner der hebräischen Philologe sich hier zurechtfinden
können. Ein riesiges steinernes Geschichts- und Schicksalsbuch mit
unzähligen inhaltsschweren Seiten. Die Inschriften bergen ein bedeutendes
historisches und kulturhistorisches Material, wertvoll für die Geschichte
der Frankfurter Juden und auch für die Geschichte der Stadt Frankfurt.
Der verewigte Rabbiner Dr. Marcus Horovitz hat vor fünfzig Jahren die
ersten Schritte zur Hebung dieser Schätze getan. Das wohlerworbene volle
Eigentumsrecht der Jüdischen Gemeinde auf den Friedhof wird schon durch
eine Urkunde vom 15. Oktober 1316 ausdrücklich beglaubigt.
Kriegerische Ereignisse haben die Stätte des Friedens nicht
verschont. Während der Belagerung Frankfurts im Jahr 1552 wurden
Geschütze und Mannschaften auf dem Friedhofe aufgestellt. In der Schreckensnacht
vom 22. zum 23. August 1644, flüchteten die durch den Fettmilch'schen
Aufstand ihrer Habe beraubten Juden aus Furcht vor der blinden Wut der von
Fettmilch aufgestachelten Volksmenge auf den Friedhof. Alt und Jung,
Männer und Frauen, alle waren da im Dunkel der Nacht versammelt. Sie
hatten ihre weißen Sterbekleider angelegt und bereiteten sich an den
Gräbern der Vorfahren auf ihr Ende vor, entschlossen, den Tod der Schande
vorzuziehen." |
Neuer Grabstein für Rabbi Jakob Josua Falk (gest. 1756;
Artikel von 1934)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. September
1934: "Ein neuer Grabstein für Rabbi Jakob Josua Falk
(Pne Joschua). Am Montag, den 17. September, 17.30 Uhr, findet auf dem
alten Friedhof am Börneplatz (Eingang Stoltzestraße 2/10) eine
Gedenkfeier aus Anlass der Enthüllung eines neuen Grabsteines für den
weltberühmten Frankfurter Rabbiner Rabbi Jacob Josua Falk, gestorben am
17. Januar 1756, statt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. September
1934: "Ein neuer Grabstein für Rabbi Jakob Josua Falk
(Pne Joschua). Am Montag, den 17. September, 17.30 Uhr, findet auf dem
alten Friedhof am Börneplatz (Eingang Stoltzestraße 2/10) eine
Gedenkfeier aus Anlass der Enthüllung eines neuen Grabsteines für den
weltberühmten Frankfurter Rabbiner Rabbi Jacob Josua Falk, gestorben am
17. Januar 1756, statt." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
21. September 1934: "Ein neuer Denkstein für den 'Pne
Jehoschua'. Nach einem kampfreichen Leben hat Rabbi Jakob Josua Falk,
der Größten aller Zeiten einer, im Jahre 1756 in der Rabbinerreihe auf
dem alten Frankfurter Friedhof am Börneplatz seine letzte Ruhe gefunden.
Der Grabstein war nun verwittert, die Schrift unleserlich geworden. Ein
nichtgenanntseinwollendes Mitglied der Gemeinde und des 'Vereins zur
Erhaltung der alten Gräber' stiftete einen neuen Stein, dem der Bildhauer
Leo Horovitz aus rotem Sandstein in voller Anpassung an den alten und mit
derselben hebräischen Inschrift hergestellt hat, und am Montag, den 17.
September nachmittags, fand auf dem alten Friedhof die feierliche
Enthüllung statt. Vor einer stattlichen Versammlung heilt Herr
Gemeinderabbiner Dr. J. Hoffmann eine längere Gedenkrede, in der er
Werdegang, Geschichte und Wirksamkeit des großen Mannes schilderte und
die Bedeutung des Werkes 'Pne Jehoschua' in allen Talmudschulen auf dem
Erdenrunde kennzeichnete. An die biographischen Angaben schlossen sich
einige passende Schriftenklärungen und Mahnungen zur Ehrung der Großen
durch Beherzigung und Nachahmung ihrer Lehren an. Herr Oberkantor Groß
sang stimmungsvoll das Amir-Gebet, worauf die Besichtigung des
neuen Grabmales erfolgte." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
21. September 1934: "Ein neuer Denkstein für den 'Pne
Jehoschua'. Nach einem kampfreichen Leben hat Rabbi Jakob Josua Falk,
der Größten aller Zeiten einer, im Jahre 1756 in der Rabbinerreihe auf
dem alten Frankfurter Friedhof am Börneplatz seine letzte Ruhe gefunden.
Der Grabstein war nun verwittert, die Schrift unleserlich geworden. Ein
nichtgenanntseinwollendes Mitglied der Gemeinde und des 'Vereins zur
Erhaltung der alten Gräber' stiftete einen neuen Stein, dem der Bildhauer
Leo Horovitz aus rotem Sandstein in voller Anpassung an den alten und mit
derselben hebräischen Inschrift hergestellt hat, und am Montag, den 17.
September nachmittags, fand auf dem alten Friedhof die feierliche
Enthüllung statt. Vor einer stattlichen Versammlung heilt Herr
Gemeinderabbiner Dr. J. Hoffmann eine längere Gedenkrede, in der er
Werdegang, Geschichte und Wirksamkeit des großen Mannes schilderte und
die Bedeutung des Werkes 'Pne Jehoschua' in allen Talmudschulen auf dem
Erdenrunde kennzeichnete. An die biographischen Angaben schlossen sich
einige passende Schriftenklärungen und Mahnungen zur Ehrung der Großen
durch Beherzigung und Nachahmung ihrer Lehren an. Herr Oberkantor Groß
sang stimmungsvoll das Amir-Gebet, worauf die Besichtigung des
neuen Grabmales erfolgte." |
Lage des Friedhofes
Battonstraße
Link zu den Google-Maps
(der grüne Pfeil markiert die Lage des Friedhofes)
Größere Kartenansicht
Fotos
Einzelne Presseberichte
| Pressebericht vom Oktober
2010: Über die vermutlich ältesten
jüdischen Grabsteine aus Frankfurt |
Über Grabsteine, die in
Bommersheim entdeckt wurden.
Artikel von Sophia Bernhardt in der "Frankfurter Neuen Presse"
vom 15. Oktober 2010 (Artikel):
"Vom Friedhof gestohlen?
Die jüdischen Grabsteine, die bei den archäologischen Ausgrabungen im Sommer 2007 gefunden wurden, stammen aus Frankfurt. Die Funde sind wichtiger als zunächst angenommen.
Bommersheim/Frankfurt. In die Bommersheimer Burg wurden jüdische Grabsteine als Fenster- und Türeinfassungen
(Gewände) eingesetzt. Was heute pietätlos und makaber klingt, war in der damaligen Zeit kein Einzelfall. Das belegen Funde in Trier, Köln, Berlin und Würzburg. Galten Grabsteine im 14. Jahrhundert doch als materiell sehr wertvoll.
Inzwischen steht fest, woher die in Bommersheim entdeckten Steine stammen.
'Bei den Funden in Bommersheim handelt es sich mit um die ältesten jüdischen Grabsteine aus Frankfurt', berichtet Heimatforscher Manfred Kopp.
Zu diesem Ergebnis ist Dr. Andreas Lehnardt, Professor für Judaistik an der Gutenberg-Universität Mainz, gekommen.
'Das beweist, wie sehr Oberursel mit Frankfurt verbunden war', so Kopp. Die Funde wurden bei archäologischen Grabungen im Sommer 2007 entdeckt (TZ berichtete).
Was mit den Grabsteinen geschehen soll, ist bis heute nicht geklärt. 'Es wäre sinnvoll, zwei typische Exemplare im Vortaunusmuseum als Zeugnis des Geschichtsprozesses auszustellen und die übrigen ins jüdische Museum nach Frankfurt zu geben', meint Kopp. Der Ort, an dem die Steine derzeit lagern, wird – aus Furcht vor Vandalismus – nicht
bekanntgegeben.
Prof. Lehnardt und Nathanja Hüttenmeister ('Die Fragmente mittelalterlicher jüdischer Grabsteine in Bommersheim',
Trumah, Band 18, 2008) gehen davon aus, dass die Grabsteine, die in die Bommersheimer Burg eingebaut wurden, im Jahr 1349 vom Frankfurter Friedhof gestohlen und weiter verkauft wurden. In jenem Jahr wurde die jüdische Gemeinde in Frankfurt bei einem Pogrom vernichtet.
Bei den Ausgrabungen der Bommersheimer Raubritterburg wurden insgesamt 75 Fragmente jüdischer Grabsteine aus rötlichem Sandstein gefunden. Auf 19 Teilen ist hebräische Schrift eingraviert.
'Sie weisen die typischen Schriftfelder mittelalterlicher jüdischer Epitaphien auf, wie man sie auf Friedhöfen in Mainz, Worms und Frankfurt finden kann', schreibt Nathanja Hüttenmeister in ihrem Aufsatz
'Baruch ben Kalonymos' in der Zeitschrift Kalonymos.
Das jüngste Fragment. Fünf der Grabsteine datiert die Forschung in die Jahre 5050 bis 5070 – nach unserer Zeitrechnung zwischen 1289/90 bis 1310. Auch das jüngste Fragment des Grabsteins eines Knaben namens
Kalon(ymos) ist, so die Experten für Judaistik, typisch für die Frankfurter Grabsteine aus dem 13. und 14. Jahrhundert.
Dort sind 40 Grabsteine aus den Jahren 1272 bis 1382 erhalten. Sie wurden 1952 bei Aufräumarbeiten am durch Bomben geschädigten Frankfurter Dom gefunden. Einige sind bis heute im Dom verbaut. In Sachen Material, Stil und Formulierung weisen sie große Übereinstimmungen mit den Steinen auf, die heute auf dem alten jüdischen Friedhof in Frankfurt
(Battonstraße) aufgestellt sind, so die Forscher.
Die Forscher sind sich sicher, dass die in Bommersheim gefundenen Grabsteine alle in der Burg verbaut waren. Denn jüdisches Leben in
Oberursel ist urkundlich erstmals 1636 erwähnt. Auch die jüdischen Friedhofe in der Umgebung sind erst nach 1636 entstanden.
Die fränkische Burg in Bommersheim wurde bereits 1382 zerstört – eine Strafaktion, die von Frankfurt angeordnet wurde, weil die Burgbewohner Reisende und Händler auf den Reichsstraßen ausraubten. Bei der Schleifung fielen die rötlichen Sandsteine in die Burggräben. Dort wurden sie von Schlamm bedeckt. Deshalb sind sie nicht verwittert."
Info: Was die Inschriften erzählen. Obwohl nur Fragmente der jüdischen Grabsteine erhalten sind, konnten die Forscher die Textlücken rekonstruieren, indem sie andere jüdische Grabsteine aus dieser Zeit zum Vergleich heranzogen und es sich bei den Inschriften meist um formelhafte Sätze handelt. Ein Beispiel einer rekonstruierten Grabinschrift eines Steins, von dem nur noch ein Bruchstück der rechten Hälfte existiert:
'Dieses Zeichen wurde errichtet zu Häupten der Frau Sara, Tochter des Schlomo, verschieden'. Die Jahresangabe fehlt. Danach war dort sehr wahrscheinlich die gängige Formulierung
'Und ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens. Amen, Amen, Amen. Sela', zu lesen. Das Wort
'verschieden' deutet darauf hin, dass Sara eines natürlichen Todes gestorben ist. Das Wort
'verschieden' wird auf allen erhaltenen Frankfurter Grabsteinen bis 1400 für Personen verwendet, die nicht ermordet wurden. Der Grabstein hat die Maße 90 mal 37 mal 19 Zentimeter." |
| |
| März 2017: Friedhofsführungen mit
Taschenlampen |
Artikel von Katja Sturm in der "Bürstädter
Zeitung" vom 23. März 2017: "Rhein-Main.
Mit der Taschenlampe unterwegs auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Frankfurt.
FRANKFURT - Die Dunkelheit hat sich bereits über die Stadt gelegt. Auf dem Alten Jüdischen Friedhof, nicht weit vom Brummen der Frankfurter City entfernt, weisen nur ein paar Leuchten und vorne, entlang der Mauer, das hereinfallende Licht der Straßenlaternen den Weg. Mehrere hundert Jahre Geschichte schlummern hier. Die beiden ältesten Grabsteine datieren aus dem Jahr 1272. Doch womöglich wurden auch vorher schon Menschen jüdischen Glaubens auf dem knapp 12 000 Quadratmeter großen Areal an der heutigen Battonnstraße beerdigt, erklärt Michael
Lenarz.
Ein dichtes Meer an Monumenten.
Der stellvertretende Direktor des Jüdischen Museums leitet in den dunkleren Monaten sogenannte Taschenlampenführungen über diese Ruhestätte, die zweitälteste ihrer Art nördlich der Alpen. Die Idee dazu kam vor einem Jahr auf, als zur Wiedereröffnung des Museums Judengasse ein so hohes Interesse an fachkundig begleiteten Rundgängen über das Gräberfeld bestand, dass diese bis in die Abendstunden hinein angeboten wurden.
'Danach haben wir uns überlegt, dass wir das wieder machen sollten', erzählt
Lenarz.
Dabei hat sich herausgestellt, dass die von den Spuren der Zeit nicht unberührt gebliebenen Inschriften auf den Grabsteinen im schrägen Schein der kleinen, jedem Teilnehmer vor Beginn ausgehändigten LED-Lämpchen bisweilen besser zu erkennen sind als am Tag. Ihre Bedeutung allerdings wird nur denjenigen klar, die des Hebräischen mächtig sind. Sofern sie, wie Lenarz erklärt, die oft verwendeten Abkürzungen zu deuten wissen.
Er selbst hat Übersetzungen parat für einige der insgesamt 6500 Grabsteine, die hier bis 1828 aufgestellt wurden. Ein dichtes Meer an Gedenkmonumenten bedeckte damals den Friedhof. Denn im jüdischen Glauben behält ein Toter seinen Ruheplatz für die Ewigkeit. Dabei konnte sich längst nicht jeder einen Grabstein leisten.
'Nach schriftlichen Zeugnissen', so Lenarz, 'liegen hier 26 000 Menschen.' Darunter viele jung Verstorbene, die unterhalb des sogenannten Kinderberges, einer kleinen Anhöhe rechter Hand des Eingangs, aufgehäuft wurden.
Unter den Steinen, die bis heute gut erhalten sind, befinden sich die bekannter Rabbiner, aber auch, fast ein wenig unscheinbar, der von Mayer Amschel Rothschild (1744-1812). Der Begründer des bekannten Bankhauses wohnte einst selbst in der Judengasse, die direkt auf den Friedhof zulief, und offenbar, so Lenarz, scheuten die Nationalsozialisten bei ihrer Zerschlagung zahlreicher Gedenksteine vor dem seinen zurück. 1943 hatten sie damit angefangen, die Grabstätten zu zerstören, um das Gelände einzuebnen. Eine schmale Schneise zeugt noch heute davon, dass der Schutt mit einer kleinen Eisenbahn abtransportiert wurde. Doch die Arbeiten kamen zum Erliegen, als Bomben auf Frankfurt niederregneten. Die bereits frei gelegten Flächen wurden als Ablageflächen für Trümmer genutzt. Das Glitzern, das vor allem bei Regen auf dem Boden auszumachen ist, stammt von dem Glas der Fenster aus Häusern der Altstadt, das immer wieder nach oben gespült wird, erklärt
Lenarz.
Auch mit spielerischen Elementen.
In einem Forschungsprojekt wurden von 1991 bis 2001 die noch erhaltenen Grabsteine und Bruchstücke dokumentiert. Nicht bei allen ließen sich die ursprünglichen Aufstellorte rekonstruieren; entsprechend stehen sie heute entlang der Mauern oder nicht weit entfernt davon, während diejenigen, von denen nur noch
Fragmente übrig sind, in der Mitte des Friedhofs zu Häufchen aufgeschichtet wurden. Einige der ursprünglich auf dem Alten Friedhof platzierten Steine durften vor der Zerschlagung durch die Nazis vom Historischen Museum zwecks Erhalt aussortiert werden und finden sich heute auf der Parzelle, die auf dem Frankfurter Hauptfriedhof jüdischen Begräbnissen vorbehalten ist.
Der nächtliche Gang über den Totenacker enthält bei allem Respekt auch ein spielerisches Element. Anhand der Hauszeichen, die auf vielen Grabsteinen zu finden sind, Abbildungen von Bären, tanzenden Männern oder Reusen, lässt sich der Familienname der Verstorbenen erraten. Bei der Aussprache allerdings sorgt nicht zuletzt der Frankfurter Dialekt für einige Verwirrung. Und zu der Einsicht, dass sich selbst bei hellerem Licht nicht alle Geheimnisse offenbart hätten." |
| Link zum Artikel: Mit der Taschenlampe unterwegs auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Frankfurt (Bürstädter Zeitung, 23.03.2017) |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Markus Horovitz: Frankfurter
Rabbinern. Ein Beitrag zur Geschichte der israelitischen Gemeinde in
Frankfurt am Main. Frankfurt am Main 1882-1885 (2. Auflage mit
Ergänzungen von Josef Unna. Jerusalem 1969). |
 | ders.: Avne zikaron. Die Inschriften
des alten Friedhofs der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt am Main.
Frankfurt am Main 1901. |
 | Gedenkbuch der Frankfurter Juden. Nach
Aufzeichnungen der Beerdigungs-Bruderschaft. Hg.: Komitee zur Erhaltung und
Wiederherstellung der Grabdenkmäler auf dem alten Israelitischen Friedhofe
am Börneplatz zu Frankfurt am Main, bearbeitet und ins Deutsche übertragen
von Simon Unna. Erster Band 1624-1680. Frankfurt am Main 1914. |
 | Arno Lustiger: Grabinschriften des
Alten Judenfriedhofs in Frankfurt am Main. Eine Auswahl. Texte,
Kurzbiographien und Übersetzung. Frankfurt am Main 1984. |
 |  Michael
Brocke u.a.: Der alte jüdische
Friedhof zu Frankfurt am Main. Unbekannte Denkmäler und Inschriften. Hg.
Kommission zur Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden. Sigmaringen
1996. Michael
Brocke u.a.: Der alte jüdische
Friedhof zu Frankfurt am Main. Unbekannte Denkmäler und Inschriften. Hg.
Kommission zur Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden. Sigmaringen
1996. |
 | 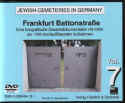 Hinweis
auf eine Dokumentation des jüdischen Friedhofes Battonstraße: Hinweis
auf eine Dokumentation des jüdischen Friedhofes Battonstraße:
(Erschienen und bestellbar im Verlag
Friedhof + Denkmal, Inh. Norbert Heyeckhaus, D-65624 Altendiez, Berg Straße
17,
Tel.: 06432-98240-0 - Fax.: 06432-84297 - E-Mail
- Informationsseiten/Website) |



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
|