|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht "Synagogen im
Kreis Bad Kreuznach"
Becherbach (VG
Kirn-Land, Kreis
Bad Kreuznach)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Becherbach
bestand eine kleine jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert. Ihre Entstehung geht
in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Zwischen 1782 und 1785 werden
in den Gemeinderechnungen des Ortes die jüdischen Familien von David, Isaak und
Salomon genannt. Jeder der "Schutzjuden" hatte damals jährlich zehn
Gulden "Schutzgeld" an die Landesherrschaft zu bezahlen.
1808 lebten in der Mairie Schmidthachenbach, zu der Becherbach gehörte,
insgesamt 57 jüdische Personen: in Becherbach 13 (drei Ehepaare, fünf
Knaben, zwei Mädchen), in Schmidthachenbach zwölf (zwei Ehepaare, drei Knaben,
vier Mädchen, eine Witwe), in Weierbach 30 (fünf Ehepaare, zehn Knaben, neun Mädchen,
eine Witwe), in Otzweiler zwei (ein Ehepaar).
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1867 18 jüdische Einwohner, 1887 16 (von insgesamt 489
Einwohnern), 1895 20 (von 490).
Beim Großbrand von Becherbach am 9. September 1854 wurden 29 Wohnhäuser
und 54 einzelne Ökonomiegebäude zerstört und weitere Gebäude beschädigt.
Auch die "Synagoge" (s.u.) wurde damals zerstört.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (bis um 1870) sind die
folgenden zehn jüdischen Familien in Becherbach in den Unterlagen des
Standesamtes und der Bürgerbücher festgehalten: 1) Isaak Moritz (1749-1827,
Handelsmann) und Frau Sophie geb. David mit drei Kindern; 2) Peter Moritz
(1788-1856) und Frau Edeline Binnes (1786 - ?, nach Tod ihres Mannes nach
Amerika ausgewandert) mit sechs Kindern; 3) Simon Moritz (1783-1862) mit Frau
Nannette geb. Gottschalk aus Hennweiler (1797-1859) mit acht Kindern; 4) Michael
Moritz (1795-1856) und Frau Karoline geb. Wendel aus Rachtig (1794-1859) mit
vier Kindern; 5) Joseph Wolf aus Löllbach (1803-1837) mit Frau Johannetta geb.
David (1793-?) mit drei Kindern; 6) Emanuel Marx (geb. 1817-) und 1. Frau
Henriette geb. Salomon aus Waldmoor (1819-1851) und 2. Frau Christina geb.
Salomon (1829-) mit zusammen vier Kindern; 7) Ferdinand Moritz (1822-?) und Frau
Judith geb. Haas (1818-?) mit fünf Kindern (alle 1863 nach Amerika
ausgewandert); 8) David Wolf (1832-?, Spezereihändler) und Frau Mina geb. Loeb
(1830-?) mit sechs Kindern (alle nach Kirn verzogen); 9) David Moritz
(1821-1881) und Frau Regina geb. Löser aus Laufersweiler (1828-1897) mit vier
Kindern; 10) Ferdinand Moritz II (1830-?) und Frau Wilhelmine geb. Löser aus
Laufersweiler (1835-?) mit acht Kindern.
An Einrichtungen bestanden eine Betstube (s.u.) und ein Friedhof.
Da es in Becherbach auf Grund der zu geringen Zahl jüdischer Einwohner kaum möglich
war, zu den Gottesdiensten regelmäßig Minjan zu bekommen (zehn
religionsmündige Männer), schlossen sich die Becherbacher jüdischen Familien
der Gemeinde in Hundsbach
an, spätestens in den 1920er-Jahren der Gemeinde in Kirn.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Max Alfred
Moritz (geb. 16.5.1890 in Becherbach [oder in Meisenheim, vor 1914 in Kirn
wohnhaft] als Sohn des Kaufmanns Isidor Moritz und der Regina geb. Wendel), gef.
20.6.1916). Sein Name steht auf der Ehrentafel für die Gefallenen der beiden
Weltkriege im Becherbacher Friedhof.
Um 1924, als nur noch fünf jüdische Personen am Ort lebten, gehörten
diese - wie erwähnt - inzwischen zur Gemeinde in Kirn.
Es handelte sich um vier Mitglieder der Familie Moritz und einen älteren Mann
namens Eisick (Isaak). Nach dem Novemberpogrom 1938 haben die
letzten jüdischen Einwohner den Ort verlassen. Beim Novemberpogrom 1938 war das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Moritz
angegriffen und beschädigt worden. Herr Moritz wurde in das Kirner Gefängnis
gebracht, danach für drei Monate in das KZ Dachau verschleppt. 1939 floh die
Familie Moritz über Luxemburg nach Frankreich, wo sie die Zeit des Holocausts
überlebte.
Die noch in Becherbach geborenen Ernst Moritz und Alfred Moritz (siehe Bericht
unten) sind inzwischen gestorben (August 2010 beziehungsweise Januar 2011).
Von den in Becherbach geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Claire Löb geb.
Moritz (1889), Alfred Moritz (1886), Frieda Moritz (1890).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
| In jüdischen Periodika des 19./20.
Jahrhunderts wurden zur jüdischen Geschichte in Becherbach noch keine
Berichte gefunden. |
Zur Geschichte der Betstube ("Synagoge")
Die jüdischen Familien am Ort hatten eine Betstube
eingerichtet. Bei einem großen Brand des Ortes am 9. September 1854,
durch den 29 Familien des Ortes obdachlos wurden, ist auch diese Betstube
("Synagoge" genannt) zerstört worden. Es ist nicht bekannt, in
welchem Haus die Einrichtung war. Nach dem Brand wurde die Betstube nicht wieder
eingerichtet - die jüdischen Einwohner des Ortes besuchten die Gottesdienste in
Hundsbach.
Adresse/Standort der Betstube: unbekannt
Fotos
Außer zum
Friedhof sind noch keine Fotos zur jüdischen Geschichte in Becherbach
vorhanden;
über Hinweise oder Zusendungen freut sich der Webmaster der
"Alemannia Judaica";
Adresse siehe Eingangsseite. |
|
| |
|
|
| |
|
Informationstafel
zur jüdischen Geschichte
in Becherbach am jüdischen Friedhof
(Fotos: Ruth Eckhoff, Sien,
Fotos vom Januar 2011) |
 |
 |
| |
Die
neue Informationstafel am Friedhof - zum Lesen des Textes kann das Foto
rechts
auch in
höherer Auflösung angesehen werden (unterstrichener Link - bitte
anklicken). |
| |
|
Links und Literatur
Hinweis auf eine Website mit einer
eindrücklichen Darstellung zur
Geschichte der Familie Moritz in Becherbach,
verfasst von dem aus Becherbach stammenden Alfred Moritz:
"Survival in WW II, 1933-1944".
 Foto
links: Alfred Moritz (geb. 1930 in Becherbach, zuletzt in Washington DC,
gest. im Januar 2011). Foto
links: Alfred Moritz (geb. 1930 in Becherbach, zuletzt in Washington DC,
gest. im Januar 2011).
Der Anfang der Darstellung: "Als Kind, wohlbehütet aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Pfalz in Deutschland, hätte sich Alfred Moritz niemals vorstellen können, welches bewegte Schicksal ihm dieses turbulente 20. Jahrhundert noch bescheren sollte.
Obwohl er die sogenannte Reichskristallnacht erleben musste, den Exodus nach Frankreich und auch die deutsche Besetzung dieses Landes, war es ihm gegeben, dem grausamen Schicksal von eineinhalb Millionen israelitischen Kindern zu entkommen, die dem "Holocaust" zum Opfer fielen.
Jahre später machte er in seinem Beruf als Diplomarchitekt Karriere bei der führenden amerikanischen Ingenieur-, Bau- und
Projektleitungsfirma. In diesem Erinnerungsbuch versucht Alfred Moritz die Verfolgung von Menschen zu verstehen und zu dokumentieren, deren einziges "Verbrechen" es war, anders zu sein als die Mehrheit..." |
| |
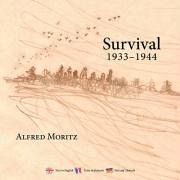 Die Memoiren von Alfred Moritz sind
auch als Buch erhältlich (€ 33.95): Die Memoiren von Alfred Moritz sind
auch als Buch erhältlich (€ 33.95):
Bei www.buecher.de: direkter
Link zum Buch
Bei www.amazon.de: direkter
Link zum Buch |
| Nachkommen: Descendants
of Isaak Beit Mosis Moritz (vom 18. Jahrhundert bis
2010) |
| |
| Januar 2011:
Zum Tod von Alfred Moritz |
Zum Tod von Alfred Moritz erstellte Nikolaus
Furch einen Presse-Artikel für die "Allgemeine Zeitung" im
Januar 2011:
"Alfred Moritz gestorben.
BECHERBACH – Am 8.Januar 2011 starb in Washington DC Alfred Moritz, in Fachkreisen weithin
angesehener Architekt.
Noch im letzten Jahr, als Achtzigjähriger, besuchte er die ehemalige Heimat Becherbach bei Kirn, in die er jedes Jahr
zurückkehrte, um an den Grabstätten seiner Vorfahren das Kaddisch für die Verstorbenen zu sprechen. Die
Landschaft an der Nahe und der Mosel liebte er zeitlebens. Mit der 'Reichskristallnacht' war, zusammen mit dem
zertrümmerten Mobiliar und Porzellan des väterlichen Textilgeschäfts, die Heimatidylle zerschlagen. Zu überleben
gelang dem jungen Alfred nur mit äußerster Mühe und viel Glück.
Alfred Moritz war ein außergewöhnlich talentierter Hobby-Künstler. Als Zeichner hielt er mit Stift und Skizzenbuch
Landschaft, Geschichten und Geschichte fest.
Ehemaligen Nachbarn, die der 'nicht-arischen' Familie Moritz hatten helfen wollen und anderen, die ihre Solidarität
bekundeten, vergalt er es mit spontaner Freundschaft und Aufgeschlossenheit. Mit den Siener Freunden Ruth und
Ulrich Eckhoff verbrachte er häufig gemeinsame Urlaubstage und regelmäßige Radtouren durch die geliebte
Nahelandschaft und bis nach Wien. Außerordentlich lesenswert ist das auch mit ihnen in lebhaftem Gedankenaustausch
entstandene Erinnerungsbuch 'Survival - Trotz allem überlebt'." |
Links:
Literatur:
 | Rudolf Franzmann: Becherbach. Beiträge zur
Geschichte des Dorfes und seiner Umgebung. Becherbach 1987 S.
243. |
 | Hans-Werner Ziemer: Die jüdischer Familien in
Becherbach bei Kirn und Hundsbach. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen
Geschichte und Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. 5. Jahrgang Ausgabe
2/95 Heft. Nr. 10. Online
zugänglich (pdf-Datei).
|
 | Dokumentation Jüdische Grabstätten im Kreis Bad
Kreuznach. Geschichte und Gestaltung. Reihe: Heimatkundliche Schriftenreihe
des Landkreises Bad Kreuznach Band 28. 1995. S. 121-128. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 98 (mit weiteren Literaturangaben). |
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|