|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
zur
Übersicht "Synagogen im Kreis Darmstadt-Dieburg"
Arheilgen (Stadt
Darmstadt)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Arheilgen bestand eine jüdische
Gemeinde bis nach 1933. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts
zurück. Spätestens in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde eine erste jüdische
Familie aufgenommen. Am Anfang des 17. Jahrhunderts gab es fünf
jüdische Familien am Ort, am Ende des Jahrhunderts (1696) waren es wieder sechs
Familien. Dazwischen hatte der Dreißigjährige Krieg auch für die jüdischen
Einwohner schlimmste Not und Vertreibung mit sich gebracht (1628 beantragte der
aus seinem Heimatort geflohene Hayum aus Arheilgen Niederlassungsrecht beim
Mainzer Domkapitel). 1776 wurden neun jüdische Familien
gezählt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1802 13 jüdische Familien, 1828 111 jüdische Einwohner, 1861 98 (4,3 % von
insgesamt 2.265 Einwohnern; um 1865 mehrere Familien Kahn, Adler, Simon,
Bauer, vgl. Spendenliste 1865 s.u.), 1880 48 (1,5 % von 3.155), 1900 31 (0,7 % von
4.408), 1910 24 (0,4 % von 6.391). Zwischen 1823 und 1876 wurden nach den
erhaltenen jüdischen Standesamtsregistern Arheilgen im Blick auf die jüdischen
Familien 172 Geburten, 85 Sterbefälle und 38 Eheschließungen
registriert.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.) mit einem jüdischen
Gemeindehaus, eine jüdische Schule
und ein rituelles Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden im jüdischen
Friedhof Groß-Gerau
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war im 19.
Jahrhundert zeitweise ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter tätig
war (siehe Ausschreibungen der Stelle 1870/71). Der 1839 in Arheiligen geborene
Journalist Josef Oppenheim (siehe unten) war Sohn des damaligen jüdischen
Lehrers in Arheiligen. Von jüdischen Vereinen wird
bereits 1843 am Ort ein Israelitischer Kranken-Verpflegungsverein genannt (Jahrbuch
der Jüdisch-literarischen Gesellschaft 1929 S. 207). Die
Gemeinde gehörte nach dem Verzeichnis 1924 zum orthodoxen Bezirksrabbinat
Darmstadt II, nach dem Verzeichnis 1932 zum liberalen Bezirksrabbinat Darmstadt
I.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1888/1901 H. Adler.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Leopold Kahn (geb.
8.7.1877 in Arheilgen, vor 1914 in Freiburg i.Br. wohnhaft, gef.
13.1.1916).
Um 1924, als noch 23 jüdische Einwohner am Ort gezählt wurden (0,3 %
von insgesamt 7.619 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Aron Reinhardt, J. Simon und Leopold Harlsberg. Den Religionsunterricht für die
vier schulpflichtigen Kinder der jüdischen Gemeinde erteilte Lehrer Elias
Hauser aus Darmstadt. Als Schochet war Jakob Fränkel tätig. Er hatte das
Amt auch in umliegenden Orten wie Gräfenhausen
inne.
1933 lebten noch 24 jüdische Personen in Arheilgen (0,3 % von 8.263). In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Bereits am 5. März
1933 war es (wie auch in Darmstadt) zu antisemitischen Ausschreitungen
gekommen. Unter anderem musste der schwerkranke Heinrich Wechsler mit einer
Hakenkreuzfahne Spießruten laufen; er starb an den Folgen am 21. März 1933. Beim Novemberpogrom
1938 überfielen SA- und NSDAP-Leute die Wohnung der Familie Wechsler in der
Felchesgasse. Danach drangen sie gewaltsam in das Haus in der Obergasse ein, in
dem Aron Reinhardt (einige Jahre zuvor noch Herausgeber des "Arheilger
Anzeigers") mit seiner 32-jährigen Tochter Johanna wohnte. In ihrer
Todesangst stürzte sich Johanna Reinhardt aus dem Fenster; zwei Tage später
starb sie an einer Rückgratverletzung. Ihr Vater erhängte sich unmittelbar
nach der Nachricht vom Tode seiner Tochter. In der Hundsgasse warfen die
Nationalsozialisten einen Stein durch die Fensterscheiben, der Dora Stern am
Kopf traf; wenige Tage später starb sie im Jüdischen Krankenhaus in Mainz. 1939 wurden noch 15
jüdische Einwohner gezählt.
Von den in Arheilgen geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma Friedländer
geb. Hirsch (1862), Bettche (Betty) Kahn (1868), Rosa (Rosalie) Lorch geb. Simon
(1876), Aron Reinhardt (1871),
Johanna (Hanna) Reinhardt (1903), Betty Reiß geb. Simon (1874), Alexander
Sander (1857), Jenny (Jettchen) Simon (1875), Dora Stern (1870), Auguste Wechsler
geb. Simon (1870), Heinrich Wechsler (1901), Lina Wechsler geb. Plaut (1893), Siegfried Wechsler
(1893)m Adolf (Adolph) Wolff (1869).
An den jüdischen Bäcker und Getreidehändler Heinrich Wechsler (1901-1933)
erinnert seit dem 13. März 1974 in Arheilgen die "Wechslerstraße".
Auch wurden für ihn und seine in Auschwitz ermordete Mutter Auguste geb. Simon
im November 2009 vor dem Haus Felchesgasse 2 "Stolpersteine"
verlegt. Weitere "Stolpersteine" wurden in Arheiligen verlegt vor dem
Gebäude Frankfurter Landstraße 54 für Lina und Siegfried Wechsler sowie für
vor dem Gebäude Aron-Reinhardt-Straße 2 (frühere Obergasse) für Aron
Reinhardt und seine Tochter Johanna Reinhardt.
Vgl. Liste der "Stolpersteine" in Darmstadt http://www.dfg-vk-darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/Stolpersteine.htm.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters / Schochet 1870 /1871
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1870: "Die
israelitische Gemeinde Arheiligen bei Darmstadt beabsichtigt, einen Lehrer
und Vorbeter aufzunehmen. Fixer Gehalt 250 Gulden nebst 14 Gulden für
Heizung des Schullokals und freie Wohnung. Durch die Nähe der
Residenzstadt ist dem anzustellenden Lehrer, im Fall derselbe sich
musikalische Ausbildung will, Gelegenheit zur Fortbildung geboten.
Zeugnisse sind an den unterzeichneten Vorstand franco einzusenden. Simon
Fs. Kahn." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1870: "Die
israelitische Gemeinde Arheiligen bei Darmstadt beabsichtigt, einen Lehrer
und Vorbeter aufzunehmen. Fixer Gehalt 250 Gulden nebst 14 Gulden für
Heizung des Schullokals und freie Wohnung. Durch die Nähe der
Residenzstadt ist dem anzustellenden Lehrer, im Fall derselbe sich
musikalische Ausbildung will, Gelegenheit zur Fortbildung geboten.
Zeugnisse sind an den unterzeichneten Vorstand franco einzusenden. Simon
Fs. Kahn." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Die hiesige
israelitische Gemeinde beabsichtigt, einen Lehrer und Vorbeter
aufzunehmen. Die Stelle hat einen fixen Gehalt von 250 Gulden nebst 15
Gulden für Heizung des Schullokals und freie Wohnung; ist auch mit
Nebeneinkommen verbunden. Die Bewerber um diese Stelle wollen sich bei dem
unterzeichneten Vorsteher portofrei melden. Die Stelle kann gleich besetzt
werden. Arheiligen. Simon Js. Kahn". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1871: "Die hiesige
israelitische Gemeinde beabsichtigt, einen Lehrer und Vorbeter
aufzunehmen. Die Stelle hat einen fixen Gehalt von 250 Gulden nebst 15
Gulden für Heizung des Schullokals und freie Wohnung; ist auch mit
Nebeneinkommen verbunden. Die Bewerber um diese Stelle wollen sich bei dem
unterzeichneten Vorsteher portofrei melden. Die Stelle kann gleich besetzt
werden. Arheiligen. Simon Js. Kahn". |
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Ergebnis einer Spendensammlung in
der Gemeinde (1865)
Anmerkung: die jüdischen Gemeinden sammelten regelmäßig für die
unterschiedliche Zwecke; viele Ergebnisse solcher Sammlungen wurden in jüdischen
Periodika bekanntgegeben.
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 27. September 1865: "Durch Isaac Oppenheimer in
Arheiligen gesammelt: Simon Kahn 2 fl. 42 kr., Simon Adler 1 fl., Aaron
Adler, Witwe 1 fl., Marx Kahn 30 kr., Joseph Kahn 1 fl, Joseph Adler, Moses
Adler 30 kr., E. Adler 18 kr., A. Simon 18 kr., D. Bauer, Witwe 30 kr., A.
Kahn, 30 kr., I. Oppenheimer 30 kr., zusammen 9 fl. 36 kr., abzüglich Porto
9 fl. 27 kr.". Mitteilung
in "Der Israelit" vom 27. September 1865: "Durch Isaac Oppenheimer in
Arheiligen gesammelt: Simon Kahn 2 fl. 42 kr., Simon Adler 1 fl., Aaron
Adler, Witwe 1 fl., Marx Kahn 30 kr., Joseph Kahn 1 fl, Joseph Adler, Moses
Adler 30 kr., E. Adler 18 kr., A. Simon 18 kr., D. Bauer, Witwe 30 kr., A.
Kahn, 30 kr., I. Oppenheimer 30 kr., zusammen 9 fl. 36 kr., abzüglich Porto
9 fl. 27 kr.". |
Berichte
über Persönlichkeiten aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod des aus Arheiligen stammenden Journalisten und
Redakteurs Josef Oppenheim (1839 Arheiligen - 1900 Baden bei Wien)
Anmerkung: vgl. -
https://www.deutsche-biographie.de/pnd11713726X.html?language=en
- Geschichte Wien - Wiki:
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/index.php?curid=25311
-
https://apis.acdh.oeaw.ac.at/person/53476
 Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 20. Juli 1900: "Wien, im Juli. Einer der
hervorragendsten und beliebtesten Redakteure der 'Neuen Freien Presse',
Josef Oppenheim, ist am 12. dieses Monats in Baden gestorben. Josef
Oppenheim war in Arheiligen bei Darmstadt als Sohn eines jüdischen
Lehrers im Jahre 1839 geboren. Er begann seine journalistische Laufbahn bei
der 'Ostdeutschen Post'. Hierauf kam er zur 'Presse' und später zur
'Deutschen Zeitung'. Im Jahre 1872 kam Oppenheim zur 'Neuen Freien Presse'.
Seinen glänzenden Ruf begründete er durch die Veröffentlichung seiner
'Briefe einer Schauspielerin', die wegen ihres Geistes und Witzes viel
gelesen wurden..." Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 20. Juli 1900: "Wien, im Juli. Einer der
hervorragendsten und beliebtesten Redakteure der 'Neuen Freien Presse',
Josef Oppenheim, ist am 12. dieses Monats in Baden gestorben. Josef
Oppenheim war in Arheiligen bei Darmstadt als Sohn eines jüdischen
Lehrers im Jahre 1839 geboren. Er begann seine journalistische Laufbahn bei
der 'Ostdeutschen Post'. Hierauf kam er zur 'Presse' und später zur
'Deutschen Zeitung'. Im Jahre 1872 kam Oppenheim zur 'Neuen Freien Presse'.
Seinen glänzenden Ruf begründete er durch die Veröffentlichung seiner
'Briefe einer Schauspielerin', die wegen ihres Geistes und Witzes viel
gelesen wurden..." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige des Buchdruckers A. Reinhard
(1903)
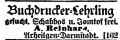 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1903:
"Buchdrucker-Lehrling gesucht. Schabbos und Jomtof (= Feiertag) frei. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1903:
"Buchdrucker-Lehrling gesucht. Schabbos und Jomtof (= Feiertag) frei.
A. Reinhard,
Arheilgen - Darmstadt". |
Haushaltshilfe von M. Barczynski
gesucht (1921)
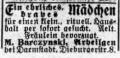 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 16. Juni 1921: "Ein ehrliches,
braves Mädchen für einen kleinen, rituellen Haushalt per sofort gesucht.
Älteres Fräulein bevorzugt. Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 16. Juni 1921: "Ein ehrliches,
braves Mädchen für einen kleinen, rituellen Haushalt per sofort gesucht.
Älteres Fräulein bevorzugt.
M. Barczynski, Arheiligen bei Darmstadt, Dieburger Straße 8." |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
der aus Arheilgen
stammenden Rosa Lorch geb. Simon |

|
|
| |
Rosa (Rosalie) Lorch geb.
Simon ist am 1. Mai 1876 in Arheilgen geboren. Sie lebte später in Dieburg.
Am 25. März 1942 wurde sie ab Mainz über Darmstadt in das Ghetto Piaski
deportiert. Sie ist umgekommen. |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Die Synagoge in Arheiligen wurde 1799 eingeweiht. Bei
dieser Einweihung bekam die Gemeinde Probleme mit dem zuständigen Landrabbiner
Callmann Mengenberg, da sie gegen das Verbot des Rabbiners eine
Tanzveranstaltung zur Synagogeneinweihung erlaubte.
Landrabbiner Callmann Mengenburg
versucht vergeblich, eine Tanzveranstaltung zur Einweihung der Synagoge zu
unterbinden (1799, Bericht von 1929)
 Artikel
im "Jahrbuch der Jüdisch-literarischen Gesellschaft" 1929 S. 187: "Landrabbiner
Callman Mengenburg war streng gesetzestreu und auf Erhaltung der Ordnung im
Rabbinats Bezirk. Unter anderem liegt eine Eingabe des Rabbinats an den
Landgrafen aus dem Jahre 1799 vor um Schutz der Autorität seines Amtes. Als
Oberlandrabbiner beklagt er sich über die Juden von Arheiligen, die bei der
Einweihung der neuen Synagoge zu Arheiligen gegen sein Verbot getanzt hatten
und dafür mit zwei Taler Strafe - halb gnädigster Herrschaft verfallend
-belegt worden waren. Das Verbot hatte er deshalb erlassen, 'weil dabei
immerhin solche Exzesse unterlaufen, die mit der Feierlichkeit einer solchen
Handlung in strackstem Widerspruch stehen, sowie darum auch solche mit den
noch fortdauernden kriegerischen Zeitläuften1,
wo unnötiger Aufwand, Luxus und Verschwendung am unrechten Orte angebracht
sind, sich gar nicht räumen lassen2.
Da der Befehl des Rabiners nicht befolgt wurde, so bat dieser zur Erhaltung
von Zucht und Ordnung bei den Judengemeinden, welche dann doch mit der
Erhaltung des status politicis in die engsten Bande geschlagen ist, zur
Erledigung der andiktierten zwei Thaler Geldbuße gnädigst anhalten zu
lassen. Artikel
im "Jahrbuch der Jüdisch-literarischen Gesellschaft" 1929 S. 187: "Landrabbiner
Callman Mengenburg war streng gesetzestreu und auf Erhaltung der Ordnung im
Rabbinats Bezirk. Unter anderem liegt eine Eingabe des Rabbinats an den
Landgrafen aus dem Jahre 1799 vor um Schutz der Autorität seines Amtes. Als
Oberlandrabbiner beklagt er sich über die Juden von Arheiligen, die bei der
Einweihung der neuen Synagoge zu Arheiligen gegen sein Verbot getanzt hatten
und dafür mit zwei Taler Strafe - halb gnädigster Herrschaft verfallend
-belegt worden waren. Das Verbot hatte er deshalb erlassen, 'weil dabei
immerhin solche Exzesse unterlaufen, die mit der Feierlichkeit einer solchen
Handlung in strackstem Widerspruch stehen, sowie darum auch solche mit den
noch fortdauernden kriegerischen Zeitläuften1,
wo unnötiger Aufwand, Luxus und Verschwendung am unrechten Orte angebracht
sind, sich gar nicht räumen lassen2.
Da der Befehl des Rabiners nicht befolgt wurde, so bat dieser zur Erhaltung
von Zucht und Ordnung bei den Judengemeinden, welche dann doch mit der
Erhaltung des status politicis in die engsten Bande geschlagen ist, zur
Erledigung der andiktierten zwei Thaler Geldbuße gnädigst anhalten zu
lassen.
1) es war die Zeit der
Koalitionskriege, wobei Hessen wiederholt von den Franzosen besetzt wurde.
2) soll wohl heißen 'vermeiden'
lassen."
|
1903 wurde die Synagoge umfassend renoviert, worüber ein Bericht
vorliegt:
Renovierung der Synagoge 1903
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September
1903: "Arheilgen bei Darmstadt. Die Synagoge der hiesigen
israelitischen Gemeinde, die einer gründlichen Renovierung unterworfen
war, ist nun soweit fertig gestellt und macht dieselbe infolge des neuen
Verputzes einen recht schönen Eindruck. Schwerlich wäre die
israelitische Gemeinde in der Lage gewesen, die Synagoge auf eigene
Rechnung dergestalt zu errichten, wenn nicht ein Wohltäter, der der
eigentliche Veranlasser war, sich erboten hätte, 500 Mark
beizusteuern." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September
1903: "Arheilgen bei Darmstadt. Die Synagoge der hiesigen
israelitischen Gemeinde, die einer gründlichen Renovierung unterworfen
war, ist nun soweit fertig gestellt und macht dieselbe infolge des neuen
Verputzes einen recht schönen Eindruck. Schwerlich wäre die
israelitische Gemeinde in der Lage gewesen, die Synagoge auf eigene
Rechnung dergestalt zu errichten, wenn nicht ein Wohltäter, der der
eigentliche Veranlasser war, sich erboten hätte, 500 Mark
beizusteuern." |
Beim Novemberpogrom 1938 war das
Synagogengebäude bereits in nichtjüdischem Besitz. Sie war kurz zuvor
verkauft worden. In der kurzen Mitteilung wird auch auf das Gemeindehaus der
jüdischen Gemeinde hingewiesen, das gleichfalls im Sommer 1938 verkauft wurde.
Der Verkaufserlös kam bedürftigen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Arheilgen
zugute. Über die Bedürftigkeit entschied das Rabbinat in Darmstadt.
Verkauf des Synagogengebäudes im
Sommer 1938
 Mitteilung im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. September 1938:
"Darmstadt-Arheiligen. Infolge starken Rückganges der jüdischen
Gemeinde wurde unsere Synagoge nebst Gemeindehaus dieser Tage
verkauft. "
Mitteilung im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. September 1938:
"Darmstadt-Arheiligen. Infolge starken Rückganges der jüdischen
Gemeinde wurde unsere Synagoge nebst Gemeindehaus dieser Tage
verkauft. " |
Im September 1944 brannte das Synagogengebäude ab - der Sohn von August
Lücker hatte sie angezündet.
Adresse/Standort der Synagoge: Kleine
Brückenstraße 14 (früher Kleine Hundsgasse)
Fotos
Eine
Rekonstruktion und Grafik der Synagoge in Arheiligen siehe
Beitrag von Helmut W. Diedrichs, zugänglich über Link unten
Literaturübersicht. |
|
| |
|
|
Jüdischer
Friedhof in Darmstadt:
Grabstein für den 1933 auf
Grund der Folgen
der antisemitischen Ausschreibungen
verstorbenen Heinrich Wechsler
(Foto: Siegmund Krieger) |
 |
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| November 2009:
In Arheilgen werden "Stolpersteine"
verlegt |
Artikel von Annette Wannemacher-Saal in "Echo online" vom 12.
November 2009 (Artikel):
"Stolpersteine für die Arheilger Opfer
Gedenken: An drei Häusern werden jeweils zwei Pflastersteine verlegt, um an die verfolgten jüdischen Bürger zu erinnern.
'Ein Tag der Schande ' sei der 10. November 1938 für Arheilgen gewesen. 'Nun soll es ein Tag des Gedenkens
sein', sagt am Dienstag Horst A. Härter vom Arheilger Geschichtsverein..."
|
| |
| August 2010:
Ausstellung über Pfarrer Karl Grein
(1881-1957) |
Artikel in "Echo online" vom
August 2010 (Artikel):
"Unbeugsam im Widerstand: Ausstellung über Pfarrer Karl Grein.
DARMSTADT. Er ließ sich von dem nazihörigen Darmstädter Bischof nicht aus dem Amt jagen und bereitete die Neugründung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nach dem Krieg vor: Eine Ausstellung in Darmstadt-Arheilgen würdigt das Leben des Pfarrers Karl Grein (1881-1957) an dem Ort seines jahrzehntelangen Wirkens..." |
| |
Mai 2018:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Arheiligen zur Erinnerung an die Familie Karlsberg
Anmerkung: In der Darmstädter Straße 3 wurden
drei Stolpersteine zur Erinnerung an die Familie Karlsberg verlegt.
|
Artikel von Bettina Bergstedt in "Echo
online" vom 17. Mai 2018: "Erinnerung an Familie Karlsberg.
ARHEILGEN - Erna führte ein Leben wie alle Mädchen ihres Alters: Sie
ging in Arheilgen zur Schule, wurde mit 17 Jahren Lehrmädchen, 'aber
plötzlich änderte sich alles, plötzlich spielte es eine Rolle, dass sie
Jüdin war'. So berichtet eine Schülerin der Klasse G9a der Stadtteilschule
Arheilgen, 'da war sie gerade mal zwei Jahre älter als ich.' In Darmstadt
waren nationalsozialistische Tendenzen früh zu spüren; bereits im März 1933
erzielte die NSDAP bei der Wahl 50 Prozent der Stimmen; es kam zu ersten
Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. 1934 machte sich Erna
Karlsberg deshalb allein auf den Weg nach New York. Die Eltern schickten sie
auf eine ungewisse Reise, weil sie sich für ihre Tochter eine lebenswerte
Zukunft wünschten. Martha folgte ihrer großen Schwester vier Jahre später:
Sie war 15 Jahre alt, als sie 1938 über Hamburg, die Niederlande und London
nach New York floh – ebenfalls ohne Begleitung. Johanna und Leopold
Karlsberg, die Eltern der Mädchen, blieben und wurden am 25. März 1942 ins
jüdische Ghetto nach Piaski deportiert und später für tot erklärt. Als die
Schüler in der siebten Klasse anfingen, sich im Unterricht mit dem Thema
'Judentum in Geschichte und Gegenwart' auseinanderzusetzen, stießen sie auf
die Familie Karlsberg und beschlossen, nicht nur für Johanna und Leopold
Stolpersteine im Stadtteil zu verlegen, sondern auch für Erna und Martha,
die den Holocaust in Amerika überlebten. 'Denn Opfer sind Ermordete wie
Verfolgte und Geflüchtete', sagen die Schüler bei der kleinen Gedenkfeier
anlässlich der Stolperstein-Verlegung in der Darmstädter Straße in Arheilgen.
Dort hat die Familie Karlsberg einmal gelebt; der Vater verkaufte Schuhwerk
mit einem Fuhrwerk und im eigenen kleinen Laden. Viele Menschen sind zur
Verlegung der Stolpersteine gekommen. Anwohner sind da, Interessierte,
ehemalige Schüler, die im Hof und bis auf die Straße hinaus stehen. Die
Klasse hat im Religionsunterricht mit ihrer Lehrerin Ulrike Volke ein
kleines Programm auf die Beine gestellt. 'Nicht immer sind Hausbesitzer
begeistert, wenn sie hören, dass vor ihrem Haus Stolpersteine verlegt werden
sollen', meint Volke. Im Hof am Haus in der Darmstädter Straße werden die
Anwesenden sogar bewirtet. Sechstklässler spielen auf Blasinstrumenten; die
Klasse G 9a berichtet über das Leben der Familie; vier Steine werden in das
vorbereitete Loch im Gehweg gesetzt, festgeklopft und verfugt. Vier Rosen
legen die Schüler zu den Steinen, und alle gemeinsam singen 'Die
Moorsoldaten', jenes Lied, das Häftlinge des Konzentrationslagers Börgermoor
(Emsland) 1933 verfassten. 'Erinnern – warum?/Ich bin nicht schuldig!/Ich
kenne niemanden ... will unbelastet in die Zukunft gehen”, zitieren Frauke,
Robin, Philip und Merle aus einem Gedicht. Dabei gibt es immer noch
Vertreibung und Flucht. Auch Sara gehört inzwischen zur G9a, die Kuchen
gebacken und verkauft hat, um die Stolpersteine spenden zu können. Sie ist
vor einem Jahr aus Syrien geflüchtet.
Mit Blumen aus Eberstadt. Natürlich gehe sie die Vergangenheit etwas an,
bemerken Lotta und Ismail später. 'Ausgrenzung passiert noch heute.' Die
Adresse der vermutlich schon verstorbenen Schwestern konnten sie nicht
ausfindig machen, sonst hätten sie Kontakt aufgenommen. 'Ich bin
verantwortlich, was sein wird, nicht was war', endet das Gedicht,
'hoffentlich erinnern wir uns'.
Zwei Schwestern der evangelischen Marienschwesternschaft sind mit Blumen aus
Eberstadt zur Feier gekommen, Schwester Laurentia sagt am Rande: 'Erinnern
reicht nicht, die Menschen müssen sich ändern.'"
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 46. |
 | Keine Artikel bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 und dies. Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 54-55. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 80-81. |
 | W. Andres: Alt-Arheilgen. Geschichte eines Dorfes.
Darmstadt 1978 S. 206-213. |
 | Helmut W. Diedrichs: Die Arheilger Synagoge.
Publikation der Arheilger Geschichtsvereins. Version vom 19.5.2022 -
online
eingestellt. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Arheilgen
Hesse. Established around 1800, the community numbered 111 in 1828 but dwindled
to 24 (0,4 % of the total) in 1910. The Nazis, who failed to gain wide support
in Arheilgen before 1933, organized murderous outrages in Kristallnacht
(9-10 November 1938). The synagogue (previously acquired by non-Jews) remained
intact, but Torah schrolls removed to Darmstadt were burned there. Some of the
remaining Jews emigrated; others perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|