Zur Übersicht der Jahrestagungen
30 Jahre "Alemannia Judaica" - Feier in Tübingen 2022
Die Arbeitsgemeinschaft "Alemannia Judaica" besteht 2022
- seit ihrer Gründung in
Hohenems 1992 - nun 30 Jahre. Die Website alemannia-judaica.de besteht seit ungefähr
zwanzig Jahren, nachdem zu ihrer Gestaltung Joachim Hahn bei der
Jahrestagung in Emmendingen 2003 den Auftrag erhielt. Er
war bis zur Gegenwart nicht nur Webmaster der Website, sondern hat auch mit den
Organisationen vor Ort zu den Jahrestagungen eingeladen und den Kontakt mit den
Mitgliedern aufrechterhalten. Der "Arbeitskreis Jüdisches Schwaben" an der
Universität Tübingen (Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische
Hilfswissenschaften) lud auf Grund der beiden Jubiläen zu einem Festakt ein am
27. Oktober 2022, 18 – 21 Uhr im Großen Senat der Neuen Aula,
Geschwister-Scholl-Platz in Tübingen.
Den Festvortrag hielt Professorin Dr. Miriam Rürup, Direktorin des Moses
Mendelssohn Zentrum für europäische-jüdische Studien in Potsdam. Beim
anschließenden Empfang gab es Gelegenheit zum Austausch.
Im Namen des Arbeitskreis luden ein und gestalteten die Veranstaltung Prof. Dr.
Sigrid Hirbodian und Prof. Dr. Benigna Schönhagen.
Programmablauf und Fotos von der Feier der Jubiläen von "Alemannia Judaica":
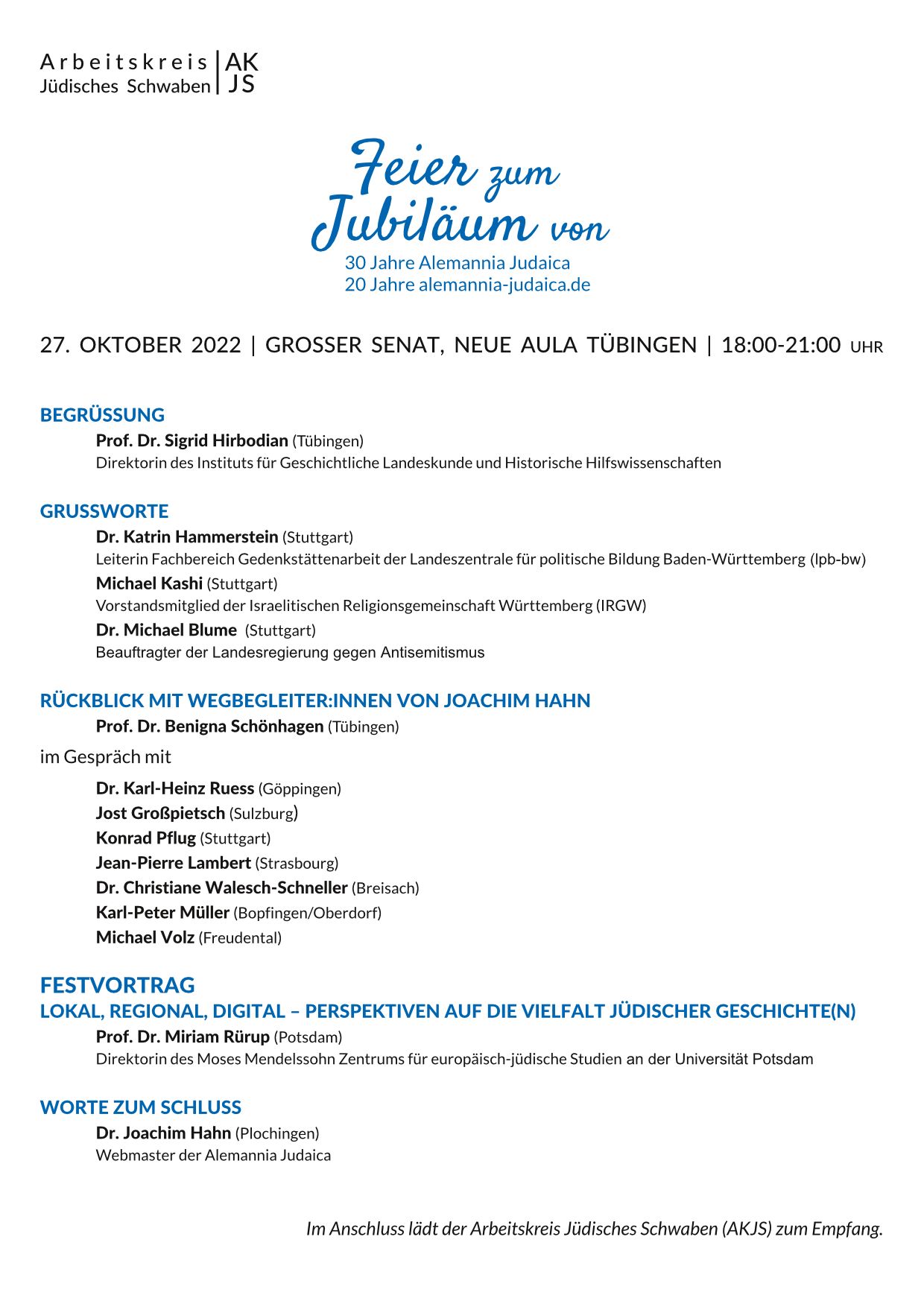

Bericht zur
Veranstaltung von Jochen Mauer:
Jubiläum "Alemannia Judaica": 30 Jahre Gründung der Arbeitsgemeinschaft - 20
Jahre Webpräsenz -
Festakt zum 30. Jahrestag der Gründung der Alemannia Judaica - zu Ehren von Dr.
Joachim Hahn in Tübingen am 26. Oktober 2022
30 Jahre besteht sie bereits, die Arbeitsgemeinschaft Alemannia Judaica. Am 24.
Mai 1992 wurde sie in Hohenems (Vorarlberg) gegründet: Ihr Ziel ist die
Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum. Seit
2002 ist die gleichnamige Website online und bietet Informationen zu etlichen
hundert Ortschaften: zunächst vor allem aus Baden-Württemberg, dem Elsass, der
Deutschschweiz, Vorarlberg und in Bayrisch-Schwaben, dann aber auch zu Orten in
Bundesländern weit darüber hinaus. Unzählige Bilder und schriftliche Quellen
wurden im Lauf der Jahre dort eingestellt – auf diese Weise ist die Website ein
ergiebiges Rechercheinstrument geworden. Und sollte jemand weiteres, bisher
nicht bekanntes Material haben, wächst sie weiter.
Anlässlich der Jubiläen der Arbeitsgemeinschaft und ihrer Website lud der
Arbeitskreis Jüdisches Schwaben am Institut für Geschichtliche Landeskunde und
Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen am 26. Oktober zu einer
Feier mit Festvortrag in den großen Senat der Uni Tübingen. Viele aus der Schar
der Gäste sind Weggefährtinnen und -gefährten, spüren wie Joachim Hahn schon
seit langem die Spuren jüdischen Lebens auf, sichern und dokumentieren – leisten
'Erinnerungsarbeit'. Woher dieses anhaltende Interesse? Dafür gibt es sicher
eine ganze Reihe von Antworten.
Eine Rolle spielt bestimmt, dass es sich um ein spannendes Kapitel unserer
regionalen Geschichte handelt, noch sehr frisch, aber zugleich abgekapselt vom
Alltag, eben kein Thema. Daraus wuchs der Impuls, das Unrecht, das vielen
deutschen Juden angetan worden war, nicht weiter zu beschweigen. Je länger desto
mehr wuchs schließlich die Einsicht, dass da eben nicht nur Opfer waren, sondern
auch Täter – hier war und ist Erinnerungsarbeit besonders anstrengend. Und wenn
man Joachim Hahn oder jemand anderen selbst fragt, ist es vor allem die
Erfahrung, dass der Einsatz für die stummen Zeugen über die Jahre so viele
überaus lebendige Kontakte geknüpft hat: Zu Überlebenden oder aber deren
Angehörigen und Nachkommen und nicht zuletzt auch zu den früheren Nachbarn und
Zeugen hierzulande. Wie aber wird jemand überhaupt 'Erinnerungsarbeiter*in'?
Ein anschauliches Beispiel dafür gab Prof. Miriam Rürup in ihrem
Festvortrag 'Lokal, regional, digital – Perspektiven auf die Vielfalt jüdischer
Geschichten(n)': Bei einem Urlaubsaufenthalt in Müllheim (Baden) stolpert
der Blick am Rand eines Parkplatzes im Ort über einen Gedenkstein. Dort hatte
die Synagoge ihren Ort und zwar, weitgehend erhalten, sogar bis 1968! Über die
Website der Alemannia Judaica fand sich etliches zur jüdischen Geschichte des
Ortes – und zum auffällig späten Abriss des Gotteshauses.
https://www.alemannia-judaica.de/muellheim_synagoge.htm. Es wurde deutlich:
Ein Gedenkstein – der aber vor allem ein Stein des Anstoßes ist und fast
greifbar das Interesse hinter dem Abrissbeschluss, diese materiellen
Erinnerungen abzuräumen, die ja sowohl die gewaltsam beendete Geschichte belegen
wie auch eine zuvor bestehende Nähe und Nachbarschaft.
Die Gründungsmitglieder der Alemannia Judaica hatten es freilich nicht so
einfach: Steine waren schon da, aber keine Tafeln, wenig Erzählungen, keine
Website und noch wenige Informationen aus Büchern. Oft waren es Zugezogene, die
aufmerksam wurden auf die Nachrichten der stummen Zeugen, die nachfragten, sich
mit anderen Interessierten zusammentaten und die Erinnerungsarbeit aufnahmen.
Historisches oder judaistisches Fach- und Methodenwissen? Die Wenigsten
verfügten darüber – aber es fanden sich Leute vom Fach, ausgewiesene Experten
waren bereit zur Unterstützung. So begannen die Steine zu reden, will sagen:
weckten Neugierde auf das, was jüdisches Leben ausmacht, wie jüdische Geschichte
geschrieben wurde – ganz alltäglich und lokal und immer wieder mit den ganz
großen Lettern, mit Beziehungen in alle Welt. Wo die Fluchtrouten eben
hingeführt haben, wo Menschen leben, die in der Verfolgung der
Familiengeschichte auf Namen stießen, die jüdische Gemeinden im alemannischen
Raum bezeichneten. Namen von Orten – Namen von Familien: Ein jüngerer Spross der
Erinnerungsarbeit, ist hierzu eine genealogische Datenbank: Jüdische Familien
mit Bezug zum Südwesten Deutschlands (www.juedische-familien.de).
Die akademische Geschichtswissenschaft bemüht sich durch den reflektierten
Einsatz ihrer Methoden bei der Erschließung von Quellen aller Art, seien es
archäologische Funde, schriftliche oder auch mündliche Zeugnisse, um einen
objektiven Zugang zum Gegenstand der Forschung, der Erweiterung der Kenntnis der
Lebenszusammenhänge der Menschen vergangener Zeiten. Die Menschen, die sich in
der Alemannia Judaica zusammengetan haben, teilen dieses Bemühen. Neben der
Erhaltung der steinernen Zeugnisse und der Dokumentation der Präsenz jüdischer
Menschen sind ja viele historische Forschungsprojekte daraus erwachsen und
wichtige Publikationen vorgelegt worden.
Wer die Beteiligten fragt, was für sie und ihr Engagement über das akademische
Interesse hinausgeht, wird vielfach zu hören bekommen, dass sie einen aktiven
Beitrag für eine demokratische und freie Gesellschaft leisten wollen. Das ist
wohl der Zukunftsaspekt der Erinnerungsarbeit. 'Lokal, regional, digital' –
so fasst der Titel des Vortrags von Prof. Dr. Miriam Rürup aus Potsdam einige
wichtige Aspekte, die im Lauf des Abends immer wieder sicht- und hörbar werden.
Fast an allen Orten, die auf der Website Alemannia Judaica Spuren jüdischen
Lebens dokumentiert, sei er persönlich auch gewesen, sagt Dr. Joachim Hahn zum
Ende des Abends in Tübingen: Hunderte von Einträge kommen da zusammen, zu denen
er maßgeblich mit Fotos, Texten und Arbeiten beigetragen hat - es wird deutlich,
dass dieser Einsatz im besten Sinn Heimatkunde ist.
Ergänzen könnte man, spätestens mit dem Start der Website, noch das Adjektiv
'global': eingebunden in die Geschichte und Geschichten jüdischer Familien, mit
Kontakten zu Kindern und Enkeln, deren Vorfahren Nachbarn unserer Vorfahren
waren und die Teil der Weltgeschichte des jüdischen Volkes sind. Nun geht es
darum, die Website technisch zu aktualisieren – die vielen Informationen sollen
zugänglich bleiben und Alemannia Judaica als wichtiges Rechercheinstrument auch
künftig nutzbar sein.
Einen tiefen Dank Dr. Joachim Hahn und den Mitgliedern der Alemannia Judaica
sowie allen Erinnerungsarbeit-Leistenden für diesen großen und nachhaltigen
Einsatz für die Dokumentation und Erhaltung der steinernen Zeugen und dafür,
dass sie diese zum Sprechen gebracht haben! Jochen Maurer